Alfred Lang
University of Berne, Switzerland
Booklet Section 1991-89
Alfred Lang | |
|---|---|
University of Berne, Switzerland | |
Booklet Section 1991-89 | |
Handpostille für Studierende: Kapitel 3a
Titel / Inhalt | 1 Vom Studieren | 2 Angebot | 3a Eigentätigk. | 3b Schriftl.Arbeiten
3. Studierformen: die Eigentätigkeit der Studierenden
[Erster Teil]
3.1 Selbststudium 333.1.1 Lesen, Verstehen, Behalten 333.1.2 Vom Umgang mit Fachliteratur 38
3.1.3 Ordnung und Erschliessung des gesammelten Materials 40
3.1.4 Weitere nützliche Hilfsmittel und Tätigkeiten 42
3.1.5 Arbeitsmilieu und -gewohnheiten 43
3.1.6 Teamarbeit 44
Naturgemäss können die Studienformen, welche primär die Eigentätigkeit der Studierenden betonen (ich nenne sie deshalb Studierformen), nicht einfach aufgezählt werden wie das Angebot der Institution. Ich muss deshalb etwas weiter ausholen, und die nachstehenden Punkte sind auch keine abschliessende Aufzählung und Charakterisierung. Warum beim Studieren nach unserer Meinung die Eigentätigkeit auch im Hinblick auf Berufe ausserhalb der Wissenschaft wichtiger ist als das Angebot, wird vielleicht anhand einiger Gedanken zur akademischen Tätigkeit verständlicher. Eine sogenannte akademische Tätigkeit, dh das Arbeiten in einem Beruf, der ein wissenschaftliches Studium voraussetzt, hat meines Erachtens drei wesentliche Merkmale:
(a) Zum einen geht es um Aufgaben oder Probleme, für welche die Lösungen nicht einfach einem Repertoire von überlieferten und bewährten Vorgehensweisen (Verfahren, Fertigkeiten, Rezepten) entnommen und an die konkrete Aufgabensituation angepasst werden können. Solche Aufgaben nennen wir technisch-praktische; Beispiele dafür sind Handwerk, Facharbeit, Ausführungsarbeit, Routinearbeit, Hilfsarbeit. Für solche Tätigkeiten wird man geschult oder ausgebildet. Bei Aufgaben für wissenschaftlich fundierte Lösungen sind jedoch die Probleme meistens komplexer, und sie fordern insbesondere die Erarbeitung neuer Lösungswege. Es liegt also im Wesen dieser Aufgaben, dass man sich für ihre Lösung nicht spezifisch vorbereiten, sondern nur die allgemeinen Voraussetzungen dazu erwerben kann. Selbstverständlich will man auch beim wissenschaftlich begründeten Handeln auf die von früheren Generationen gesammelten Erfahrungen, also auf die Tradition, abstellen; im Unterschied zur direkten Praxis steht aber nicht die Handlungserfahrung, sondern die Wissenserfahrung im Zentrum, dh die tradierte Kenntnis über Sachverhalte und die ihnen immanenten Gesetzmässigkeiten. Beispiele dafür sind Planungsarbeit, Stabsarbeit, Problemlösungen, Problemverhütung, Lenkungsaufgaben, Bewältigung von bisher unbekannten und/oder sich ständig verändernden Situationen. Oft besteht die entscheidende Tätigkeit vor allem im Definieren des Problems, weil die relevanten Aspekte nicht offensichtlich, sondern verborgen sind. Daher dürfte klar sein, dass eben Akademiker nur exemplarisch auf solche Tätigkeiten vorbereitet werden können. Sie werden über sowohl breite wie tiefe Kenntnisse allgemeiner Art und über sehr allgemeine und anpassungsfähige Verfahrensmöglichkeiten verfügen müssen, damit sie ein Problem angemessen einordnen und begreifen können. Die spezifischen Kenntnisse werden sie idR erst im Hinblick auf das jeweils anstehende Problem sich aneignen oder aktualisieren wollen. Vor allem werden sie kontrolliert kreativ sein müssen: einerseits sind sie wie Künstler, die Neues schaffen, und anderseits wie Buchhalter, die über ihre Transaktionen Rechenschaft ablegen können müssen. Natürlich können kreative Lösungswege dann, wenn sie gut begründet oder gar rational sind und sich bewähren und wenn sich die Problemlage wirklich oder vermeintlich wiederholt, später zu einer Praxis oder Technik werden, deren Anwendung die Akademikerin oder den Akademiker nicht mehr oder nur mehr als Überwacher benötigen.
Nebenbei bemerkt liegt für mich hier die Begründung dafür, dass im professionellen Umgang mit menschlichen Belangen, seien sie an die Allgemeinheit gerichtete oder fürs Individuum bestimmte Dienstleistungen, nur eine Akademikerin oder ein Akademiker "gut genug" ist. Denn der ganze Mensch als ein komplexes und sich entwickelndes Wesen in seiner persönlichen Existenz kann nicht mit Rezepten behandelt werden, ohne dass er seine Würde verlöre. Wenn die Psychologen die wissenschaftliche Rechtfertigung ihres Tuns aufgäben, dann müssten sie in unserer Gesellschaft rasch ihr Ansehen verlieren. Nicht dass sie Akademiker sind, dh Personen mit Universitätsabschluss, rechtfertigt jedoch ihre Zugehörigkeit zur Elite, sondern nur die wiederholt belegte Tatsache, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben in adäquater Weise zu bewältigen vermögen.
(b) Zum zweiten fordern akademische Tätigkeiten die eigene Initiative, oder besser die Umsicht und das Gespür dafür, unter welchen Umständen nach tradierten Regeln gehandelt werden kann und wann solches Handeln die Probleme nicht oder nur vorübergehend löst und im Endeffekt eigentlich verschärft. Die Kehrseite der Initiative ist also die Verantwortlichkeit. Akademische Tätigkeiten sind im Kern selbständige und kritische Tätigkeiten. Das schliesst nicht aus, dass auch an Akademiker Aufträge erteilt werden und dass Akademiker intra- und interdisziplinär zusammenarbeiten. Vielleicht verlangen das eigentlich die meisten Probleme. Eine wesentliche Kompetenz des guten Akademikers ist deshalb auch zu spüren, wann und wo Fachleute anderer Disziplinen beigezogen werden müssen; um zu wissen welche, muss man benachbarte Disziplinen wenigsten grundsätzlich kennen.
 Die
wertvollste Eigenschaft guter Akademiker aus der Sicht ihres
Auftraggebers und aus der Sicht der Allgemeinheit ist aber wohl die,
dass sie letzten Endes ihre Aufgaben selber definieren
können und sich auch herausnehmen, sie selber zu definieren. Sie
müssen dazu fähig sein, dem Auftraggeber sagen zu
können, dass angesichts dieser und jener durch ihr Wissen und
Können blossgelegter Umstände das Problem nicht so
aufgefasst werden sollte, wie es der Auftraggeber zunächst
wollte. Es ist offensichtlich, dass sie gerade dadurch auch unbequeme
Beauftragte werden können und dass sie fähig sein
müssen, andere und auch sich selbst in eine wenig komfortable
Lage manövrieren und die daraus sich ergebenden Folgen mit
Geschick bewältigen zu können.
Die
wertvollste Eigenschaft guter Akademiker aus der Sicht ihres
Auftraggebers und aus der Sicht der Allgemeinheit ist aber wohl die,
dass sie letzten Endes ihre Aufgaben selber definieren
können und sich auch herausnehmen, sie selber zu definieren. Sie
müssen dazu fähig sein, dem Auftraggeber sagen zu
können, dass angesichts dieser und jener durch ihr Wissen und
Können blossgelegter Umstände das Problem nicht so
aufgefasst werden sollte, wie es der Auftraggeber zunächst
wollte. Es ist offensichtlich, dass sie gerade dadurch auch unbequeme
Beauftragte werden können und dass sie fähig sein
müssen, andere und auch sich selbst in eine wenig komfortable
Lage manövrieren und die daraus sich ergebenden Folgen mit
Geschick bewältigen zu können.
(c) Schliesslich bringt es die Komplexität der üblicherweise den Akademikern übertragenen Aufgaben mit sich, dass sie Problemdefinition und Lösungsweg in aller Regel nicht allein in der konkreten Problemsituation selbst bewältigen, sondern dass, um alle relevanten Voraussetzungen und Konsequenzen berücksichtigen zu können, die Aufgabensituation zunächst in ein symbolisches Medium abgebildet und der Lösungsweg nachher wieder in die Wirklichkeit zurücktransformiert werden muss. Die Verwendung von Fachsprachen und Jargons hat zweifellos oft mit sozialer Differenzierung und manchmal sogar Dünkel zu tun; in vielen Fällen muss man ihr aber auch einen sachlichen Vorteil zugestehen. Die Sprache, die Fachsprache und die allgemeine Sprache, ist das primäre Medium, in dem akademische Tätigkeiten ausgeführt und übermittelt werden. Von Fall zu Fall treten dazu Medien wie bildliche Darstellungen, Mathematik, Aussagenlogik, Computermodell u.a.m. Alle diese Medien haben eine doppelte Funktion: sie repräsentieren Sachverhalte und sie ermöglichen die Kommunikation über diese Sachverhalte. Dass damit auch Entstellungen, Ausblendungen von und Zufügungen zu den gemeinten Sachverhalten verbunden sind, liegt in der Natur solcher Übersetzungen, versteht sich aber leider nicht immer von selbst. Vorzüge und Nachteile des Arbeitens mit symbolischen Repräsentationen sind sorgfältig gegeneinander abzuwägen; nicht für alle Problemlagen erweist sich wissenschaftliches Vorgehen als sinnvoll, doch können wir, nachdem unsere Kultur darin sehr weit gegangen ist, nicht einfach darauf verzichten.
Man darf aber nie vergessen, dass Symbolsysteme -- die erwähnten externen Medien ebenso wie die internen Wissensstrukturen im Ihrem Kopf -- niemals die Welt selber sind, sondern Spiegelungen eigener Art, mit einer nie ganz zu füllenden Kluft zur Wirklichkeit.
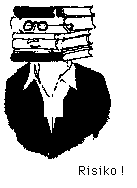 Dennoch
ist Auseinandersetzung mit Wissenschaft einer Abenteuerreise
vergleichbar: es gibt Karten und Berichte von Vorausreisenden; aber
immer wieder brechen sie ab, und man muss in den kleinen und grossen
weissen Flecken selber Wege, Verzweigungen entwerfen und gehen,
Gebirge erklimmen und Sümpfe durchwaten, ohne den Kontakt mit
den Einheimischen und den andern Reisenden, die oft andere Sprachen
sprechen, ganz zu verlieren. Hilfsmittel sind unentbehrlich, vor
allem beim Sichern der Wege und Brücken, beim Errichten von
Wegmarken und Leuchttürmen. Allerdings weiss man nicht einmal,
wohin es eigentlich geht. Auch der akademische Praktiker ist ein
Abenteuer-Reisender; im Unterschied zum Wissenschaftler selbst mag er
in etwas gesicherteren Gefilden gehen. Aber die Lage, in die wir
unsere Zivilisation mit Hilfe der Wissenschaften und auf ihr
gründender Praxis gebracht haben, sollte uns schon auffordern,
bei der Übernahme von Anweisungen kritischer zu sein und an die
mit unserem Wirken verbundenen langfristigen Verantwortungen zu
denken.
Dennoch
ist Auseinandersetzung mit Wissenschaft einer Abenteuerreise
vergleichbar: es gibt Karten und Berichte von Vorausreisenden; aber
immer wieder brechen sie ab, und man muss in den kleinen und grossen
weissen Flecken selber Wege, Verzweigungen entwerfen und gehen,
Gebirge erklimmen und Sümpfe durchwaten, ohne den Kontakt mit
den Einheimischen und den andern Reisenden, die oft andere Sprachen
sprechen, ganz zu verlieren. Hilfsmittel sind unentbehrlich, vor
allem beim Sichern der Wege und Brücken, beim Errichten von
Wegmarken und Leuchttürmen. Allerdings weiss man nicht einmal,
wohin es eigentlich geht. Auch der akademische Praktiker ist ein
Abenteuer-Reisender; im Unterschied zum Wissenschaftler selbst mag er
in etwas gesicherteren Gefilden gehen. Aber die Lage, in die wir
unsere Zivilisation mit Hilfe der Wissenschaften und auf ihr
gründender Praxis gebracht haben, sollte uns schon auffordern,
bei der Übernahme von Anweisungen kritischer zu sein und an die
mit unserem Wirken verbundenen langfristigen Verantwortungen zu
denken.
3.1 Selbststudium
3.1.1. Lesen, Verstehen, Behalten
Studieren heisst in erster Linie Lesen und Lesen und noch einmal Lesen! Lesen heisst sammeln und verstehen; Verstehen heisst das Neue in einen Zusammenhang einbringen, einordnen, einpassen. Der Zusammenhang ist Ihr eigener.
In den wichtigen Studienjahren, so stelle ich mir vor, sollten Vollzeit-Studierende wöchentlich wenigstens ein Buch (Fachbuch, Sachbuch, Roman, etc.) und ein paar Fachartikel lesen. Nutzen Sie ihre Chance, Sie werden vielleicht bis zur Pensionierung nie wieder so viel Zeit haben!
Zu diesem Herstellen eines eigenen und jederzeit verfügbaren Zusammenhangs gibt es nun ein paar Einsichten und Praktiken, Techniken und Tricks. Davon möchten wir Ihnen einiges vermitteln, obwohl Sie sich bewusst sein sollten, dass auch diese Studienpraxis Ihre ganz persönliche sein oder werden soll, in ständiger Ausübung verfeinert und auf Ihre Lebenslage und -ziele hin optimalisiert.
Der wichtigste Grundsatz ist wohl: Neugierig lesen und das Lesen immer schreibend begleiten und über das Gelesene hinaus schreibend neue, eigene symbolische Strukturen schaffen. Von der Schule her ist man meistens auf viel zu spezielle Lernziele, nämlich das Auswendiglernen (von Vokabeln, Jahrzahlen, Fremdwörtern, etc.) fixiert; es spielt beim Lernen von Wissenschaft die kleinste Rolle. Nur die wenigsten wissenschaftlichen Inhalte haben einen so elementhaften, isolierbaren Charakter wie Vokabeln; sie bilden vielmehr immer Zusammenhänge, Strukturen, in denen jede Komponente ihre Bedeutung aus ihrem Verhältnis, ihrer Ähnlichkeit mit, ihrer Verschiedenheit von anderen Komponenten erhält.
Ähnlich wie die Fermente und Enzyme Ihrer Körpersäfte die Moleküle Ihrer Nahrung aufbrechen und zu neuen -- Ihren eigenen -- Eiweiss-Molekülen zusammensetzen, sollten Sie mit Information umgehen. Je fester und fertiger ein Lehrstoff fixiert ist (schwarz auf weiss nach Hause getragen), desto schwieriger wird das sein, und Sie müssen auf ineffizientes und inadäquates Auswendiglernen (Prüfungsstoff zum raschen Vergessen) zurückfallen. Die günstigste Form, in der Lehrstoff daherkommen kann, ist eine halbgekochte, noch nicht durch und durch geordnete: an so viel Bekanntes und Vertrautes erinnernd, dass das Interesse geweckt ist, und zugleich so neu und fremd und seltsam, dass die Neugierde herausgefordert wird, in das Geheimnisvolle einzudringen, die Unstimmigkeiten zu klären und den Überblick zu gewinnen. Hat man sich eine Informationsstruktur auf diese Weise assimiliert, so wäre es merkwürdig, müsste man dann noch besondere Anstrengungen zum Behalten unternehmen, die über simple Gedächtnisstützen (Namen, Listen, Schemata, Diagramme) hinausgehen.
3.1.2. Vom Umgang mit Fachliteratur
Lesen Sie also immer "mit Papier und Bleistift"! Die traditionelle wissenschaftliche Arbeitsweise ist der Zettelkasten. Auf Karteikarten oder ähnlich normierten Zetteln hält man stets die bibliographischen Angaben über das Gelesene fest und notiert sich in Paraphrasen und Zitaten, Listen und Diagrammen etc. die wesentlichen Inhalte, vielleicht zusammen mit eigenen kritischen und/oder weiterführenden Gedanken. Die Inhalte einzelner Kapitel oder besonders wichtige Erkenntnisse können auch separate Zettel erhalten; ebenso - als solche gekennzeichnet -- weiterführende Überlegungen oder Synthesen von Gelesenem sowie eigene Ideen und Einfälle. Heute ersetzt oft die persönliche Literaturdatenbank auf dem PC den Zettelkasten. Derzeit ist die Programmentwicklung allerdings für diesen Zweck noch nicht auf einem voll befriedigenden Stand. Informationen über die von den Mitarbeitern benützten Datenorganisationsverfahren werden gerne abgegeben doch nur bedingt unterstützt. In eigenen Büchern (nur in eigenen Büchern!) ist oft das Markieren und Kommentieren von wichtigen Textstellen sinnvoll.
 Es
lohnt sich nie, halbbatzige Notizen zu machen; man wird sie sehr
wahrscheinlich ungebraucht, weil unbrauchbar, wegwerfen und sich erst
noch über die nötige Wiederholung der Arbeit ärgern.
Besser ist es bei Zeitmangel, früh Wesentliches vom
Wünschbaren und Überflüssigenzu separieren und sich
auf ersteres zu konzentrieren.
Es
lohnt sich nie, halbbatzige Notizen zu machen; man wird sie sehr
wahrscheinlich ungebraucht, weil unbrauchbar, wegwerfen und sich erst
noch über die nötige Wiederholung der Arbeit ärgern.
Besser ist es bei Zeitmangel, früh Wesentliches vom
Wünschbaren und Überflüssigenzu separieren und sich
auf ersteres zu konzentrieren.
 Zum
Ausfindigmachen der für ein Thema einschlägigen
Literatur gibt es mehrere, einander ergänzende Methoden.
Ein Thema sollte man, wenn immer möglich, sowohl in der Zeit
vorwärts, mit seiner Entwicklung, und zugleich
rückwärts, vom aktuellen Stand her, angehen.
Zum
Ausfindigmachen der für ein Thema einschlägigen
Literatur gibt es mehrere, einander ergänzende Methoden.
Ein Thema sollte man, wenn immer möglich, sowohl in der Zeit
vorwärts, mit seiner Entwicklung, und zugleich
rückwärts, vom aktuellen Stand her, angehen.
 (a)
Das gründliche Studium der sogenannten "Klassiker" oder von
modernen Referenzwerken, zum Beispiel einer umfassenden
Monographie oder der Kontrahenten einer Kontroverse, ist ein zwar
zeitaufwendiger, aber lohnender Einsatz, weil nur in längeren
Texten innere und äussere Ordnungen, der Gegenstand selbst und
seine Einbettung in übergeordnete Zusammenhänge, wirklich
dargestellt werden können.Lehrbücher können
die Einordnung erleichtern. Bei der Bewertung von Büchern helfen
oft Rezensionen (zB in Contemporary Psychology,
Psychologische Rundschau, Schweizerische Zeitschrift für
Psychologie), man soll sie wenn möglich vergleichend
lesen.
(a)
Das gründliche Studium der sogenannten "Klassiker" oder von
modernen Referenzwerken, zum Beispiel einer umfassenden
Monographie oder der Kontrahenten einer Kontroverse, ist ein zwar
zeitaufwendiger, aber lohnender Einsatz, weil nur in längeren
Texten innere und äussere Ordnungen, der Gegenstand selbst und
seine Einbettung in übergeordnete Zusammenhänge, wirklich
dargestellt werden können.Lehrbücher können
die Einordnung erleichtern. Bei der Bewertung von Büchern helfen
oft Rezensionen (zB in Contemporary Psychology,
Psychologische Rundschau, Schweizerische Zeitschrift für
Psychologie), man soll sie wenn möglich vergleichend
lesen.
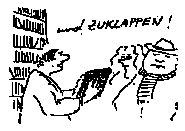 (b)
Die wichtigste Quelle für das Dokumentieren des aktuellen
Forschungsstandes sind sind die grossen bibliographischen
Dienstleistungswerke. Dazu gehören insbesondere die
Psychological Abstracts und seine Abkömmlinge wie
PsycINFO (Computerdatenbankform von PsAbstr), PsycLIT
(CD-ROM-Version derselben) und PsycBOOKS (eine seit 1989 die
englischsprachigen Bücher und ihre Kapitel erfassende
Dokumentation). Die Entwicklung eines aktuellen Themas verfolgt man
am besten mithilfe des Social Sciences Citation Index (SSCI).
PSINDEX oder Bibliographien zur Psychologie: Literatur aus
deutschsprachigen Ländern und manche weitere Werke sind
ebenfalls unentbehrlich. Detaillierte Angaben finden sich in Horst
WILHELMs Informationshandbuch Psychologie. Frankfurt,
Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1987. Derzeit ist infolge des
allmählichen Übergangs auf computer-unterstützte
Informationssysteme das Gewinnen von Überblick nicht immer
leicht.
(b)
Die wichtigste Quelle für das Dokumentieren des aktuellen
Forschungsstandes sind sind die grossen bibliographischen
Dienstleistungswerke. Dazu gehören insbesondere die
Psychological Abstracts und seine Abkömmlinge wie
PsycINFO (Computerdatenbankform von PsAbstr), PsycLIT
(CD-ROM-Version derselben) und PsycBOOKS (eine seit 1989 die
englischsprachigen Bücher und ihre Kapitel erfassende
Dokumentation). Die Entwicklung eines aktuellen Themas verfolgt man
am besten mithilfe des Social Sciences Citation Index (SSCI).
PSINDEX oder Bibliographien zur Psychologie: Literatur aus
deutschsprachigen Ländern und manche weitere Werke sind
ebenfalls unentbehrlich. Detaillierte Angaben finden sich in Horst
WILHELMs Informationshandbuch Psychologie. Frankfurt,
Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1987. Derzeit ist infolge des
allmählichen Übergangs auf computer-unterstützte
Informationssysteme das Gewinnen von Überblick nicht immer
leicht.
 Man
soll aber nicht erwarten, dass ein typisches psychologisches Thema in
ein paar Schlagworten eingefangen werden kann und die entsprechende
Computer-Recherche dann die einschlägige Literatur
vollständig einbringt. Eine unentbehrliche Quelle ist deshalb
auch die neuere Sekundärliteratur: Kapitel in
Handbüchern und Lehrbüchern, Übersichtsartikel
in Sammelbänden (fälschlicherweise oft "Reader" genannt,
das ist aber ein Lesebuch oder eine Anthologie mit schon früher
publizierten Texten) oder auf Übersichten spezialisierten
Periodika (Annual Review, Psychological Bulletin u.ä.)
erschliessen zwar nicht das Allerneuste, bringen aber dafür oft
sinnreiche Einordnungen. Eine ähnliche Funktion können
Kongressberichte und Symposiumsveröffentlichungen u.dgl.
erfüllen.
Man
soll aber nicht erwarten, dass ein typisches psychologisches Thema in
ein paar Schlagworten eingefangen werden kann und die entsprechende
Computer-Recherche dann die einschlägige Literatur
vollständig einbringt. Eine unentbehrliche Quelle ist deshalb
auch die neuere Sekundärliteratur: Kapitel in
Handbüchern und Lehrbüchern, Übersichtsartikel
in Sammelbänden (fälschlicherweise oft "Reader" genannt,
das ist aber ein Lesebuch oder eine Anthologie mit schon früher
publizierten Texten) oder auf Übersichten spezialisierten
Periodika (Annual Review, Psychological Bulletin u.ä.)
erschliessen zwar nicht das Allerneuste, bringen aber dafür oft
sinnreiche Einordnungen. Eine ähnliche Funktion können
Kongressberichte und Symposiumsveröffentlichungen u.dgl.
erfüllen.
Die meines Erachtens aber immer noch fruchtbarste Methode ist das "Blättern" in den neusten einschlägigen Zeitschriften, verbunden mit dem Rückwärts-durch-die-Referenzen-Lesen, bis man zusammen mit einem vielschichtigen Bild des Problems die immer wieder zitierten wichtigen ("Referenz-")Publikationen und eine Menge von zusätzlichem Material versammelt hat. Parallel zum Material baut sich dabei auch Ihre kognitive Repräsentation des Themas auf, und darum geht es ja zunächst.
 Wie
man mit all diesen Hilfmitteln umgeht, wo sie stehen, wie sie
aufgebaut sind, wie sie bedient werden,was sie hergeben, welches ihre
Grenzen sind, wie man am leichtesten zu der durch sie erschlossenen
Originalliteratur gelangt, usw., lernt man aber nur im wiederholten
Gebrauch. Eingeführt in diese Techniken wird in
Anfängerveranstaltungen im Sinne eines Trockenschwimmkurses;
dann müssen Sie aber auch noch nass werden, um schwimmen zu
lernen und über Wasser zu bleiben. Fragen Sie auch immer wieder
ältere Studienkolleginnen und -kollegen, das
Bibliothekspersonal, Assistentinnen und Assistenten um Rat und
Beistand.
Wie
man mit all diesen Hilfmitteln umgeht, wo sie stehen, wie sie
aufgebaut sind, wie sie bedient werden,was sie hergeben, welches ihre
Grenzen sind, wie man am leichtesten zu der durch sie erschlossenen
Originalliteratur gelangt, usw., lernt man aber nur im wiederholten
Gebrauch. Eingeführt in diese Techniken wird in
Anfängerveranstaltungen im Sinne eines Trockenschwimmkurses;
dann müssen Sie aber auch noch nass werden, um schwimmen zu
lernen und über Wasser zu bleiben. Fragen Sie auch immer wieder
ältere Studienkolleginnen und -kollegen, das
Bibliothekspersonal, Assistentinnen und Assistenten um Rat und
Beistand.
3.1.3. Ordnung und Erschliessung des gesammelten Materials
Entscheidend ist nun zweifellos, was man mit dem gesammelten Material macht. Referenzen auf Literatur und eigene Ideen bilden zusammen naturgemäss ein in diesem Prozess zunehmend dichter werdendes Netzwerk von Begriffen, Aussagen, Vermutungen, Tatsachen und Relationen aller Art; mit tragfähigen Stellen, mit Flickstellen, mit fadenscheinigen Stellen, mit gerissenen Stellen, mit imposanten Strukturen und filigranen Stickereien, mit noch nie geknüpften Lücken, mit selbstleuchtenden Stellen, mit Stellen im Dunkeln oder im Nebel...
Ich denke, man sollte damit bewusst zwei parallele, einander ergänzende Gedächtnis-Organisationen kultivieren, eine interne im Kopf und eine externe auf Papier und/oder im Computer. Jede von ihnen sollte angemessen auf Stärken und Schwächen ihres Trägers oder Mediums Rücksicht nehmen. Die wichtigere, die einem normalerweise nicht verloren gehen kann, ist die interne; sie ist enorm flexibel aber kapazitätsbegrenzt, in der Grobstruktur grandios, im feinen Detail oft unsicher. Die Vorteile der externen Organisation liegen in ihrer praktisch unbegrenzten Kapazität und hohen Verlässlichkeit der benutzten Kodes (Schrift, Bild, Computerdaten und -prozeduren). Die höhere Beweglichkeit der inneren, die stärkere Fixiertheit der äusseren Informationsstrukturen kann man je nach dem als Vorzug oder Nachteil sehen. Das Geheimnis ihrer Brauchbarkeit liegt jedenfalls in der gekonnten Kombination der beiden (vgl. Anhang 1, Ökopsychologie und Mensch-Computer-"Partnerschaft").
Hier können wir nur ein paar wenige Hinweise auf die Komplementarität der beiden parallelen und unterschiedlichen Organisationen geben. Offensichtlich ist, dass die interne Organisation gerade im Zuge des "Bastelns" an der externen ihrerseits am wirksamsten verändert, verbessert, verfeinert wird, weil in diesem Dialog der Wissenschaftler mit sich selber auf dem "Umweg" über die eindeutigeren Sprach- und anderen Zeichensysteme immer wieder Sicherungen entstehen, an welche das weitere Mutmassen und Fortspinnen anschliessen kann. Ebenso einsichtig dürfte sein, dass jede externe Informationsstruktur stets nur gerade so viel wert ist, wie eine ihr verwandte interne Erkenntnisstruktur mit ihr umzugehen weiss, sie auszuwerten versteht. Dass die externe Organisation sich im Prinzip gerade jener Medien bedient, die auch den kommunikativen Austausch zwischen den Wissenschaftlern selbst und mit ihren Klienten bestimmt, sorgt für deren doppelte Effizienz.
Natürlich ist jemand, der (intern) mehr weiss, im Prinzip der gesuchtere Akademiker; aber ich möchte bei weitem jenen anderen vorziehen, der sich vor allem eine klare und einfache Organisation seines (vielleicht schwächeren) Wissens erarbeitet hat und dafür mit externen Gedächtnisformen (sei es eine eigene Datei oder öffentliche Nachschlagewerke und Datenbanken) geschickt umzugehen weiss.
Die exakte Organisation des immensen Wissens, das sich im Laufe einiger Studienjahre intern und extern akkumuliert, ist ein Problem für sich. Meines Erachtens muss sie von jedem Studiernden persönlich geleistet werden. Über die optimale Form, in welche dieses Wissen für leichteste Verfügbarkeit gebracht wird, bestehen zwar allerlei Rezepte, aber keine umfassend gültigen und in der Praxis voll befriedigenden Verfahren. Das mag man bedauern; man könnte es aber auch in dem tiefen Sinn verstehen, dass eben keine einzelne Ordnung wirklich als solche weltgerecht ist. Für manche Teilbereiche des Wissens bieten sich logisch aufgebaute Hierarchien an ("Stamm-Bäume" mit Objekten und Relationen, meist nach dem Inklusions-/Exklusionsprinzip). Aber die ganze Psychologie ist nicht einfach logisch aufgebaut; Kreuz- und Quer-Relationen aller Art, mehrheitlich analogische, gehören unvermeidlich dazu.
Ich empfehle, zwei, drei Mal im Studium, bald nach Studienbeginn, in den mittleren Semestern vor der Spezialisierung und vielleicht noch einmal vor dem Abschluss, ein persönliches Projekt einer externen Strukturierung des Faches für die eigenen Ziele vorzunehmen. Ich selber habe im Rückblick nie in so kurzer Zeit so viel gelernt wie beim Erarbeiten und Verbessern einer Fach-Sach-Ordnung für meine damalige Zettelkasten-Randlochkarte, obwohl sie sich dann als nur teilweise brauchbar erwiesen hat.
3.1.4. Weitere nützliche Hilfsmittel und Tätigkeiten
3.1.4.1. Eigene Handbücherei und Bibliotheken
Einen Grundstock an Fachbüchern sollte jeder Akademiker persönlich besitzen. Wählen Sie klug, nicht bloss Lehrbücher und Lexika! Möchten Sie nicht einige "klassische" Autoren, über die Sie immer wieder lesen und hören, im Originaltext und einigermassen gründlich studiert haben, um sich ein eigenes Urteil zu bilden? Und warum nicht eine Fachzeitschrift abonnieren (ich meine nicht "Psychologie Heute"; viele Fachzeitschriften geben Studentenrabatt, vgl. auch 3.1.4.4).
3.1.4.2 Computer
Der persönliche Computer ersetzt die Schreibmaschine von gestern. Natürlich kann man mit ihm weit mehr; seine Nutzung als Bibliographier- und allgemeines Informationsorganisationsmittel braucht aber sehr viel Zeit und steckt vom kommerziellen Angebot her noch in den Kinderschuhen. Wenn sie die oben beschriebene Dialektik von Logik und "Psychologik" des Umgangs mit Wissen begriffen haben, so verstehen sie warum. Es handelt sie hier aber um eminent psychologische Erkenntnis- und Entwicklungsaufgaben, der sich grundlagen- und praxisorientierte Psychologen vermehrt annehmen sollten.
3.1.4.3. Besuch von Vorträgen, Tagungen und Kongressen
Wie mehrfach angedeutet, ist Wissenschaft ein gesellschaftliches Unternehmen. Das geschriebene Wort kann das gesprochene und gehörte dabei nur zum Teil ersetzen. Benützen Sie alle sich bietenden Gelegenheiten, bekannte und unbekannte Psychologen, Wissenschaftler und Praktiker, persönlich kennenzulernen. Wen man einmal gesehen und gehört hat, und sei es nur von weitem, versteht man meistens viel besser. Das "Institutskolloquium", Gastvorlesungen und Vortragsreihen der Universität und anderer Institutionen, in Bern und anderswo organisierte Tagungen und Kongresse bieten dazu gute Gelegenheiten. Und warum nicht als Fortgeschrittener selber seine Ergebnisse an einer Tagung vortragen und in einem weiteren Kreis der Diskussion aussetzen?
3.1.4.4. Mitgliedschaft in Fachvereinigungen
Studentenmitgliedschaften (zu vernünftigen Preisen) gibt es in den meisten Fachverbänden. Diese erleichtern den Kontakt mit Fachkolleginnen und -kollegen, der für den Aufbau auch einer berufspraktischen Laufbahn unentbehrlich ist. In der Schweiz gibt es rund 30 Psychologenvereinigungen, die mehrheitlich in der Föderation der Schweizer Psychologen (FSP) zusammengeschlossen sind; diese gibt das im Mitgliederbeitrag eingeschlossene Bulletin der Schweizer Psychologen (BSP), ein Informationsblatt und Diskussionsforum für fachliche und berufliche Fragen, heraus. Die Mitgliedschaft erwirbt man bei einem Kantonal- (zB Verband Bernischer Psychologen, VBP)oder bei einem Fachverband zB (bei vorwiegend wissenschaftlicher Orientierung) bei der Schweizerischen Gesellschaft für Psychologie (SGP), welche die Schweizerische Zeitschrift für Psychologie (SZP), eine Fachzeitschrift für alle Gebiete der Psychologie, herausgibt.
3.1.4.5. Beiträge in öffentlichen Medien
Eine der ständigen Klagen vieler Psychologen verweist auf die unseligen Missverständnisse, die über unser Fach in der breiten und in der gebildeten Öffentlichkeit herrschen und die unser Ansehen in Praxis und Wissenschaft beeinträchtigen. Nur beharrliche und hochstehende Aufklärung wird das allmählich ändern können. Schreiben und reden Sie, wenn Sie entsprechendes Geschick haben, über psychologische Fragen, mit denen Sie sich sowieso befassen, in geeigneten Medien aller Art, vom Lokalblättlein und -radio bis zur Kultur- oder Sonntagsbeilage der grossen Zeitungen. Einen guten Text über ein elementares Thema herzustellen, ist ebenso schwierig und bringt aber dem Autor oft ebenso viel persönlichen Gewinn wie eine Seminararbeit. Wir helfen Ihnen gerne bei der Klärung von Fragen.
3.1.5. Arbeitsmilieu und -gewohnheiten
Das Selbststudium wird bei der Auseinandersetzung mit einer Wissenschaft, anders als in einer Fachschule, etwa zwei Drittel bis drei Viertel der Zeit in Anspruch nehmen. Richten Sie sich früh darauf ein, physisch und psychisch, indem Sie sich einen geeigneten Arbeitsplatz organisieren (leider kann das Institut nur wenige zur Verfügung stellen) und sich früh geeignete Tages- und Wochenpläne zur Gewohnheit machen.
Die Ratschläge eines der vielen Bücher über das wissenschaftliche Arbeiten können hilfreich sein. Suchen Sie in einem Buchladen oder einer Bibliothek einen Sie ansprechenden Ratgeber. Besser noch sind die (Auto-) Biographien bekannter Wissenschaftler, die manchmal nicht nur spannend zu lesen sind, sondern auch viel konkrete Anregungen geben.
3.1.6. Teamarbeit
Es ist wohl klug, einen Teil der Studierzeit mit Andern in einer ähnlichen Lage zu koordinieren und gemeinsam zu verbringen. Teamarbeit bestimmt immer mehr das Geschehen in akademischen Berufen. Von etwas weiter Fortgeschrittenen kann man viel lernen (manchmal auch, wie man es nicht machen möchte), und nie lernt man so viel und so gründlich, als wenn man einigen Späterkommenden sein Verständnis lehrend vermitteln darf. Teamarbeit ist allerdings keine leichte Sache. Die Erfahrung zeigt überdies, dass viel Zeit für die Koordination der Arbeit benötigt wir, die nur indirekt und oft nur teilweise produktiv wird. Zusammenarbeit will wiederholt erfahren und geduldig erlernt sein. Man muss auch lernen, den zusätzlichen Gewinn der gemeinsamen Arbeit nicht allein am guten Gefühl des Zusammenseins zu bewerten (ich will das nicht abwerten, aber andere soziale Situationen scheinen dafür geeigneter), sondern am Ergebnis, am eigenen und der andern erweiterten Wissen und Können, am gemeinsam hergestellten Produkt.
Die Seminar- und Gruppenräume des Instituts sind, sofern nicht Veranstaltungen stattfinden, für Teamarbeit benutzbar.
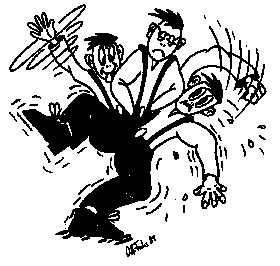
Unteamed Team