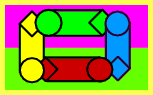Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 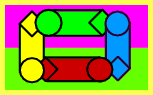 |
Journal Article 1988 |
Die kopernikanische Wende steht in der Psychologie noch aus! Hinweise auf eine ökologische Entwicklungspsychologie 1 | 1988.01 |
@Ecopersp @DevPsy @SciTheo @Method |
61 / 74KB Last revised 98.11.01 |
Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 1988 47(2/3) 93-108. | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Zusammenfassung: Es wird für eine Erneuerung des
Menschenbildes in der Psychologie im Sinne einer "kopernikanischen
Wende" plädiert. Dabei soll nicht nur Vielfalt und Nebenordnung
von und Reversibilität zwischen Betrachterstandpunkten betont,
sondern vor allem auch eine Dezentrierung bezüglich des
Gegenstandes vom Individuum auf Mensch-Umwelt-Einheiten angestrebt
werden. Diese ökologische Orientierung wird anhand der
Speicherung von Information oder des "Gedächtnisses" von solchen
ökologischen Gebilden erläutert. Für den Menschen als
Individuum und besonders als Sozialwesen ist die gestaltete und
gebaute Umwelt eine wesentliche Gedächtnisform und mithin ein
unentbehrlicher Entwicklungspartner. Auf diesem Hintergrund eines
"kopernikanischen Menschenbildes" wird anhand eines Bildes und von
Forschungsbeispielen ökologische Entwicklungspsychologie
illustriert.
Abstract: Psychology ´s need for the Copernican Turn
Ñ Towards an ecological psychology of development. The
contribution pleads for a renewal of the image of man in psychology
in the sense of a Copernican Turn. Plurality, juxtaposition of and
reversibility between perspectives are important, but foremost a
decentration of the psychological research object from the individual
towards the person-environment-unit is proposed. This ecological
attitude is specified in reference to storage of information or
"memory" of such ecological units. For men as individuals and social
beeings in particular the designed and the built environment is an
essential form of memory and thus an indispensable partner for
development. On this background of a "Copernican Image of Man" an
ecological developmental psychology is illustrated through a picture
and examples of research.
Wir alle haben wohl ein kopernikanisches Weltbild. Wir betrachten
die Erde nicht als das Zentrum der Welt. Anderseits möchte ich
behaupten, dass die meisten von uns ein vorkopernikanisches
Menschenbild haben. Das meiste was wir tun, messen wir an uns selber.
Mein Beitrag ist ein skizzenhafter Versuch, diese Formel und ihren
Wert plausibel zu machen. Nach der Eigenart des Themas geht es eher
um das Finden und Vertiefen als um das Rechtfertigen von Einsichten.
Vor allem kommt es mir darauf an, beispielhaft und programmatisch
aufzuzeigen, dass Impulse in Richtung auf ein "kopernikanisches
Menschenbild" forschungsstrategisch nützlich und
möglicherweise geeignet sind, der Psychologie neue Horizonte zu
eröffnen. Dies trotz aller Schwierigkeiten, die sich
ökologischem Denken und Forschen in diesem Fach tatsächlich
stellen.
Im ersten Teil will ich klären, was ich mit dem Ausdruck
"kopernikanisches Menschenbild" meine. Im zweiten Teil untersuche ich
dessen Bedeutung für die Entwicklungspsychologie. Die
Grundgedanken sind am Schluss in Thesenform zusammengestellt.
Inhalt
Zum Menschenbild
Das kopernikanische Weltbild
Mit dem durch Galileo Galileis Prozess von 1633 bekannt gewordenen
Ausdruck "kopernikanisch" verbinden wir gemeinhin mehr als die von
Kopernikus behaupteten und später vielfach belegten
heliozentrischen Planetenbahnen. Kant sprach von der
"kopernikanischen Wendung" und verwies damit nicht nur auf die
empirische Intention, die für die Wissenschaft der Neuzeit
charakteristisch ist, sondern auch auf den kritischen Grundgedanken,
dass nämlich die Eigenschaften der Welt und die Eigenschaften
eines Weltbetrachters voneinander nicht getrennt werden können
und untereinander neu ins Verhältnis gesetzt werden sollten.
"Es ist hiemit eben so, als mit den ersten Gedanken des Copernicus
bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen
nicht gut fort wollte, wenn er annahme, das ganze Sternheer drehe
sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen
möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne
in Ruhe liess." (Kant 1887, Akademie-Ausgabe, Bd. 3, S. 12)
Nach Einstein und der modernen Wissenschaftstheorie wird zudem
klar, dass es keinen zum vornherein ausgezeichneten
Betrachterstandpunkt geben kann; jeder denkbare ist nur einer eines
Satzes von möglichen Betrachterstandpunkten, die allenfalls als
Satz ein adäquateres Weltbild eröffnen. Dies gilt
zunächst für Erkenntnis, aber eigentlich auch für
Technik[Footnote #3], obgleich Techniken, die auf der Basis
eines bestimmten Betrachterstandpunktes entwickelt worden sind,
durchaus erfolgreich sein können Ñ nämlich genau so
lange, bis sie an die Grenzen ihrer Betrachtungssituation stossen. Es
ist seit einiger Zeit allenthalben sichtbar geworden und wird
zunehmend breiter anerkannt, dass Letzteres in mancher Hinsicht mehr
der Fall ist, als uns angenehm sein kann.
Mit Piaget kann man also von der Notwendigkeit des "Dezentrierens"
sprechen und damit sowohl auf die Pluralität der Perspektiven
wie auch auf das Erfordernis verweisen, diese Perspektiven
untereinander zu verbinden oder Reversibilität zu gewinnen.
Während die prinzipielle Gleichwertigkeit vieler Weltsichten
heute kaum bestritten wird, ist in den Wissenschaften bis heute die
aufspaltende Wirkung des Dezentrierens über der damit
aufgegebenen neuen Integration der Betrachterstandpunkte dominant
geblieben. Viele Wissenschaftler träumen zwar immer noch von der
vereinheitlichenden Weltformel; sie ist aber ganz und gar nicht in
Sicht; man bedenke etwa die fehlende Synthese von Mikrophysik und
Makrophysik, die Konfusion um die physiko-chemischen und die
biologischen Betrachtungsweisen und viele andere, meist wenig
explizierte Schwierigkeiten. Andere freilich empfinden dabei keine
Not, weil sie die Integration der Erkenntnis prinzipiell für
unmöglich halten, schon etwa aus sprachanalytischen
Gründen. Ich wollte hier die erkenntnis- und
wissenschaftstheoretischen Implikationen meiner Überlegungen
wenigsten andeuten, komme aber im folgenden nur indirekt darauf
zurück.
Denn es interessiert hier nicht das Weltbild, sondern das
Menschenbild, insofern es nämlich für die
Entwicklungspsychologie bedeutsam ist. Zudem faszinieren mich als
Psychologen auch die inhaltlichen Folgen (in Unterschied zu den
formalen Folgen für die Frage nach der Möglichkeit von
Erkenntnis) der Vermengung oder der Verwechslung von Betrachter- und
Welteigenschaften.
Das vorherrschende Menschenbild ist immer noch
vorkopernikanisch
Während die materie- und energiefokussierenden Wissenschaften
und wenigstens teilweise die lebensfokussierenden Wissenschaften
durch die kopernikanische Wende eine grosse Befreiung erfuhren und so
ihren Erfolgszug antreten konnten, behaupte ich also, dass in den
bedeutungsfokussierenden Wissenschaften, dh den Wissenschaften vom
Menschen und seinen Hervorbringungen, die kopernikanische Wende noch
nicht oder höchstens partiell und jedenfalls nicht in
inhaltlicher Hinsicht vollzogen worden ist. Ein entsprechendes
Menschenbild, nämlich ein Verständnis des Menschen als
nicht zentralen Teil eines Systemganzen steht noch aus, all unser
Denken und Tun ist anthropozentrisch.
"Nicht-anthropozentrisches Menschenbild" ist freilich eine so
paradoxe Ausdrucksweise, dass ich das Wort
"vorkopernikanisch"[Footnote #4] vorgezogen habe. Ist
Anthropozentrismus nicht selbstverständlich, da wir doch
selbst-reflektierende Menschen sind? Kommt denn überhaupt etwas
anderes in Frage? Wir haben doch dezentriert; wir akzeptieren doch -
wenigstens in wohlüberlegter Rede, wenn auch nicht immer in der
Tat - den Pluralismus, wir lassen verschiedene Menschenbilder gelten;
wir sind vielleicht sogar vorbereitet, einzugestehen, dass jeder
Mensch in seiner Einmaligkeit letztlich sein eigenes Menschenbild
haben muss, auch wenn wir im Interesse des Zusammenlebens gerne
hätten, dass sich alle koordinieren liessen.
Aber denken wir uns nicht ein "wahreres" Menschbild - ich meine
ein adäquateres als das des einzelnen Betrachters - hinter dem
Satz der vielen Betrachterstandpunkte? Erhoffen wir nicht die
psychosoziale Weltformel, beispielsweise den Frieden, ähnlich
wie die Physiker auf die Vereinigung von Quantentheorie und
Relativitätstheorie spekulieren? Und ist das eine Frage des
Erkennens oder eine Frage des Machens, vielleicht des Sozialisierens
eines neuen Menschen?
Oder müssen wir die vielen Menschenbilder, jedes einzelne,
gelten lassen? Mit allen Folgen der Widersprüche? Die ja wohl
unvermeidlich in Handeln umgesetzt werden, und das heisst auch in
Konflikte.
Die Antwort variiert natürlich je nach dem hochgehaltenen
Menschenbild. Das Problem erweist sich als rekursiv. Der
Anthropozentrismus ist in diesem erkenntnismässigen und
wertmässigen Pluralismus erhalten geblieben, ja er hat sich in
gewisser Hinsicht sogar verstärkt; denn vorkopernikanische
Menschenbilder sind traditionell an Transzendenzen orientiert.
Wenigstens auf geistiger Ebene ist Etwas dem Menschen
übergeordnet, was oder wer immer dann auf irdischer Ebene dies
repräsentiert oder nutzt.
Das führt zur Frage, ob wir in den bedeutungsfokussierenden
Wissenschaften adäquat dezentriert haben, und zur These, dass
dem nicht so sei. Denn zum Verständnis von menschabhängigen
Gegebenheiten, also speziell beim Menschenbild ist ein zweifacher
Perspektivenwechsel erforderlich: nach Kant muss man auf den
Betrachter fokussieren, um zu verstehen, was man von der Welt (nicht)
verstehen kann; um den Menschen zu verstehen, ohne seinem eigenen
Betrachterstandpunkt zu erliegen, wäre also umgekehrt auf die
Welt zu fokussieren bzw. diesbezüglich Reversibilität zu
gewinnen.
Bevor ich aber darauf komme, was denn nun "kopernikanisch" oder
das "Aufgeben des Anthropozentrismus" inhaltlich bedeuten
könnte, möchte ich kurz einigen aktuellen
Menschenbild-Aspekten in ausgewählten Traditionen nachgehen.
Das vorkopernikanische Menschenbild in Naturwissenschaft und
Technik
Das Menschenbild, das naturwissenschaftliches Denken begleitet,
ist m.E. überwiegend anthropozentrisch oder vorkopernikanisch.
Trotz der nicht verkennbaren Dezentrierung naturwissenschaftlichen
Erkennens gibt sich naturwissenschaftlich begründetes Handeln in
den Techniken so, als ob der Rest der Welt für den Menschen da
wäre.
Als Indiz für diese Behauptung sei global auf die jetzt das
Bewusstsein vieler Menschen erobernde Umweltkrise hingewiesen.
Anthropozentrismus liegt sowohl im Vorwurf an die Technik, uns die
Umwelt zu zerstören, wie im Glauben an die Machbarkeit von
Lösungen, seien sie ingenieurstechnischer oder
psychosozial-technischer Natur.
Es ist wohl so, dass immer dann, wenn wir vom Erkennen zum Machen
überzugehen haben, der Anthropozentrismus voll
durchschlägt. Das ist weiter nicht verwunderlich; das Machen
steht ja im Dienste der machenden Menschen; und die jeweiligen
Anfangserfolge beim Machen scheinen dem recht zu geben. Problematisch
ist bloss die aufschaukelnde Rückkoppelung, insofern oft durch
das Gemachte Problemlagen entstehen, die zu erneutem Eingreifen
nötigen.
Im faszinierenden Vorschlag, der Natur inskünftig Rechte
zuzugestehen, wird ein pragmatischer Dezentrierungsversuch erkennbar
(zB Meyer-Abich 1984, Sitter 1987). Praktisch müssten die Rechte
der Natur freilich durch einen sie vertretenden Advokaten vor einem
menschlichen Gericht geltend gemacht werden. Aber die Notwendigkeit
einer neuen Beziehung zwischen Mensch und Natur wird hier erkannt,
obwohl wir dem Menschen als Mass der Dinge auch dann nicht
entgehen.
Inhalt
Der Anthropozentrismus in
der Psychologie
Die Psychologie ist eine stark anthropozentrische Unternehmung.
Der verkürzende Schematismus der folgenden
Begründungshinweise sollte nicht als ein blinder Rundumschlag
missverstanden werden. Ich glaube bloss, dass dieser Gedanke, weil an
der Oberfläche paradox, zu wenig verfolgt wird; seine
heuristische Kraft scheint mir aber beträchtlich.
• Das zentrale Axiom der sogenannten kognitiven Wende der
zeitgenössischen Psychologie meint im Kern, dass Handeln nichts
als ein Ausfluss der individuellen Erkenntnisstruktur des Individuums
darstelle.
• Manche Handlungstheoretiker meinen sogar, Intentionen, also
Ziel-Setzungen von Menschen, seien der wesentliche
Handlungsgrund.
• S-R-Psychologie anderseits nimmt an, dass der Mensch an den
Marionettenfäden einer übergeordneten Welt von Kontingenzen
hange; aber sie vergisst, dass jede Beschreibung dieser Welt in
Termini gemacht wird, die durch und durch von den
Auffassungsmöglichkeiten eben dieses Menschen her bestimmt ist.
Der zirkulär definierte Bekräftigungsbegriff macht dies
besonders schön klar.
• Sogar die Wahrnehmungspsychologie setzt in der Regel
unbedenklich ihre physikalischen Reizbeschreibungen absolut, und
damit schliesst sie sich in um sich selbst kreisendes Denken ein,
vergessend, wie sehr die Physik von eben dieser Wahrnehmung
abhängt.
• In der Sozialpsychologie wird immerhin davon ausgegangen,
dass Menschliches nicht ohne Einbezug des Mitmenschen verstanden
werden kann. Die Ausweitung dieses Bezugs auf Umwelt schlechthin wird
aber kaum angezielt; die sog. Umweltpsychologie ist zu einer
höchst utilitaristischen Unternehmung geworden.
Solche Einseitigkeiten der verschiedenen Psychologien sind
vielleicht aus der Vorherrschaft von Konstruktionismus zu verstehen
(Suarez 1980). Konstruktionismus ist, in der eingangs
eingeführten Terminologie bewertet, eine partielle,
steckengebliebene kopernikanische Wende. Eine Dezentrierung auf
handelnd erkennende Subjekte ist vollzogen worden, die
Multiplizität möglicher Standpunkte ist erkannt. Wie Suarez
argumentiert, werden sogar Personen und Objekte im Erkennen
ununterscheidbar. Die Bedingungen des Erkennens werden aber
ausschliesslich beim handelnden Individuum vorausgesetzt. In dieser
Perspektive verabsolutieren die bedeutungsfokussierenden
Wissenschaften also gerade den Vorgang der Bedeutungsverleihung und
versäumen die Einnahme von Betrachterstandpunkten ausserhalb des
handelnden Menschen; Reversibilität ist ausgeschlossen.
In meiner Kritik des Konstruktionismus bin ich bestärkt durch
den Argwohn, dass der erkenntnistheoretische Konstruktionismus mehr
mit dem handelnden Machertum zu tun habe, als uns als
erkenntnisinteressierten Wissenschaftlern lieb ist. In welchem
Ausmass die Psychologie der letzten Jahrzehnte von Macherhoffnungen
(sprich "Anwendungsdruck") getrieben ist, wissen wir alle, auch wenn
wir in der Bewertung dieser Entwicklung divergieren mögen.
Vorgehensweisen in biologischen Disziplinen
Die für das Menschbild bedeutsamste Anthropo-Dezentrierung
ist natürlich mit Darwin und der Evolutionstheorie erfolgt.
Dennoch ist die heutige Biologie nur partiell kopernikanisch. Zum
besseren Verständnis des Folgenden möchte ich deshalb
zunächst ich an gewisse Gegensätze zwischen den
chemisch-physikalischen Biologen einerseits und den
organismisch-systemisch-ökologischen Biologen anderseits
erinneren.
Die ersten analysieren Vorgefundenes in und für sich selbst,
dh sie untersuchen das, was einem Betrachter unmittelbar
gegenüber gestellt sein kann: Materieklumpen, energetische
Wandlungsprozesse, Informationsballungen - Zellen zum Beispiel. Das
ist analog den ptolemäischen Planetenfigurinen, die einem
Betrachter gegeben sind. Und deutlich anthropozentrisch: was nicht
innerhalb seines Horizontes ist, braucht den Betrachter nicht zu
kümmern; ein Standpunktwechsel ist nicht nötig; die
Beifügung von (mensch-konzipierten) Wandlern und Mess-Systemen
(zB Mikroskopen, Reagentien, Geigerzähler) reicht aus, um nicht
direkt zugängliche Aspekte des Phänomens in den Griff zu
nehmen. Die Intention auf Anderes geht prinzipiell auf etwas dem
Analysierten Gleichartiges. Bereits der anfängliche Vorgang der
Ausgrenzung von Analysierbarem ist stark von dieser
Übertragungsabsicht bestimmt. Diese Forscher nehmen ihre
vorläufigen Gegenstandsdefinitionen ernst und bleiben dabei.
Die zweiten nehmen das Gegebene nur als Ausgangspunkt; es ist
weniger ein Gegenstand als ein Auslöser ihrer Wissenschaft; denn
sie fragen eher nach den Bedingungen dieses ihnen begegnenden
Phänomens. Ob es Gleichartiges gibt, müssen sie offen
lassen, weil sie erst im Laufe ihrer Forschung erfahren, worum es
eigentlich geht und was sie über das anfänglich Gegebene
hinaus auch noch berücksichtigen müssen. Zur Gewinnung
ihres Verständnisses ordnen sie also das anfänglich
Gegebene in einen grösseren Zusammenhang ein. So fragen die
organismischen Biologen etwa nach der Rolle der Zellen im Organismus.
Im kopernikanischen Prototyp dieses Vorgangs: die Planetenfigurinen
als Phänomen am Himmelszeltdach verblassen, sobald man sie als
konstituiert durch einfache Ellipsenbahnen im dreidimensionalen
Weltraum bzw. als Massenverdichtungen in der Raum-Zeit begreift. Der
Forscher instrumentiert nicht bloss seinen einmal eingenommenen
Standpunkt, sondern wechselt ihn immer wieder: wenn man
Planetenbahnen verstehen will, muss man ihren Bezug zur Sonne denken;
wenn man Zellen verstehen will, dann muss man ihre Rolle im
Organismus thematisieren; wenn Organismen, dann etwa ihre Stellung in
der Stammesgeschichte usf. Ein schönes Beispiel einer radikalen
Kopernikanisierung oder Dezentrierung in der Biologie ist der
fruchtbare Vorschlag von Richard Dawkins (1976), die Organismen als
Instrumente der Gene zu verstehen, anstatt wie üblich die
Funktion der Gene im Überleben der Organismen zu sehen. Eine
Folge der ersten Vorgehensweise ist übrigens, dass die
"Wissenschaften vom Leben" zum Leben eigentlich kaum etwas zu sagen
haben, während die zweiten wenigstens das Problem
wahrnehmen.
Anspielungen auf den Gegensatz zwischen
behavioristisch-positivistischem und
gestalttheoretisch-strukturalistischem Vorgehen in der Psychologie
sind beabsichtigt. Um zu Dezentrierungen in der Psychologie oder der
Entwicklungspsychologie zu kommen, brauchen wir also einen
Bezugsrahmen, in dem vorläufige Verständnisse des
Psychischen aufgehoben werden könnten.
Inhalt
Gegenstands-Konzeptionen
in den Wissenschaften vom Leben5
Eine überdisziplinäre Perspektive könnte dabei
nützlich sein und müsste auch die Relationen
einschlägiger Disziplinen untereinander klären helfen. Ich
gehe aus von der Frage nach den hauptsächlichen
Gegenstands-Einheiten der Wissenschaften vom Menschen. In welchem
Verhältnis stehen sie zueinander? Ich konzentriere mich auf
Biologie, Psychologie, Soziologie, die als Prototypen für
Betrachtungsebenen andere einschliessen mögen.
Biologisch, psychologisch, soziologisch verstandene
Einheiten
Vermuten wir einmal, dass die Betrachtung von Organismen als
Gegenstands-Einheiten im wesentlichen auf unserer
perzeptiv-kognitiven Organisation (etwa dem Figur-Grund-Prinzip
u.ä.) beruhe, also eine anthropozentrische Denkgewohnheit
darstelle. Angesichts der Tatsache, dass kein Organismus ohne
Stoffwechsel mit seiner Umgebung und keine Person ohne
Informationsaustausch mit ihrer Umgebung existieren kann, gibt es
nämlich keine zwingenden Gründe dafür, den Organismus
als biologische Einheit bzw. die Person als psychologische Einheit
gegenüber über- oder untergeordneten Einheitsebenen oder
anderen "Klumpenbildungen" so absolut auszuzeichnen, wie wir das
gewöhnlich tun (vgl. die Argumentation bei Lang 1985).
Der Organismus, wie er im Genom angelegt und in einer konkreten
Umwelt manifest wird, kann nämlich ebensogut als ein Zellverband
begriffen werden, wobei jede Zelle in einem vielfältigen
Austausch mit ihrer näheren und weiteren Umgebung steht. Oder
die Person könnte als eine komplexe Organisation von
Informationen verstanden werden, als "psychische Organisation", teils
getragen durch das Hirn als spezialisiertes Organ, teils durch die
vielfältigen externen Informationsträger wie Gebautes und
Schrift (vgl. Lang et al. 1987, Lang in prep.). Ähnlich kann die
Gesellschaft als etwas Eigenständiges oder als ein
Personenverband verstanden oder gar als eine Superkonstruktion
lebender Zellen begriffen werden. Ich will nicht bestreiten, dass es
"natürliche" Grenzen in der Welt gibt, dh Stellen mit
kanalisiertem und/oder verdünntem Austausch zwischen Bereichen;
ich weigere mich bloss, die vertrauten, vom menschlichen Erfahren her
bestimmten Einteilungen für endgültig zu setzen.
Als konstruktive Kritik am Anthropozentrismus möchte ich also
eine Dezentrierung vorschlagen, die mehrere Betrachterstandpunkte
akzeptiert und zugleich einen Bezug zwischen ihnen herstellt, ohne
eine neue, übergeordnete, einzelne Position einzunehmen.
Erkenntnistheoretisch denke ich an einen Emergentismus betreffend
Gebilden, die in der Welt partielle Autonomie gewinnen und denen ein
Betrachter begegnen, die er wiedererkennen kann, nämlich vor
allem Zellen (Lebensträger), Organismen (Personen) und Kulturen
(Gruppen, Gesellschaften).
Nicht zu vergessen ist, dass diese Einheiten in unserem
Verständnis Bestandteile von Zeichensystemen sind. Wie bei allen
Zeichen kann man einen Bedeutungsinhalt (also das, was ich meine) von
einem Bedeutungsträger (also das, worauf ich zeigen kann)
unterscheiden; und man weiss im Hintergrund einen Bedeutungszuweiser,
hier die jeweiligen Wissenschaften, die sich für eine bestimmte
Einheitenebene entschieden haben. Ich folge also der Peirce'schen
Dreifachrelation.
Tabelle 1 fasst meinen Versuch zusammen. Man kann die drei Ebenen
je für sich oder im Bezug zueinander sehen. Die relative
Beliebigkeit der Ebenenwahl sollte sichtbar werden, wenn wir
bedenken, dass zwar jede obere Ebene die jeweils unteren im Sinne von
notwendigen, aber nicht hinreichenden Bedingungen voraussetzt, so
dass die Erkenntnis jeder Ebene weder nach unten
analytisch-reduzierend noch nach oben synthetisch-einordnend
gesichert werden kann. Reduktionismus ist also nicht möglich.
Aber auch jede Verabsolutierung einer Ebene mit
Alleingültigkeitsanspruch führt zu Erkenntniseinengung;
dies gilt für eine biologistische Auffassung (Organismen und
Kulturen stünden im Dienste der Erhaltung des Genoms) genauso
wie für eine psychologistische (Zellen und Kulturen stünden
im Dienste der Selbstverwirklichung der Individuen) oder eine
soziologistische (Zellen und Organismen seien dazu da, die perfekte
Gesellschaft möglich zu machen). Ich erinnere jedoch daran, dass
alle diese Denkweisen mehr oder minder exklusiv propagiert worden
sind oder werden.
Es fällt nebenbei auf, dass mit einigen der verwendeten
Termini Probleme verknüpft sind. Zum Beispiel ist auf der
psychologischen Ebene mit "Organismus" ein ausserpsychologischer,
nämlich biologischer Begriff für den Bedeutungsträger,
der sich verhält, üblich geworden. Ich kann nur befremdet
feststellen, dass sich jedermann daran gewöhnt hat; besser
wäre wohl Individuum.
Tabelle 1: Wissenschafts-Ebenen zur Betrachtung von
Komponenten-Verbänden als Träger und als Inhalte der
betrachteten Gegenstands-Einheiten (übernommen aus Lang
1988).
Einheiten-Ebene: | Träger (stofflich): | Inhalt (ideell): |
soziologisch: | ? (Kultur, Staat, etc.) | Gesellschaft |
psychologisch: | Organismus (Individuum) | Person |
biologisch: | Zelle | ? (Einheit des Lebens) |
In unserem Zusammenhang besonders interessant scheint mir die
Feststellung, dass auf der biologischen Ebene geläufige Begriffe
für die Einheit des Lebens ebenso fehlen ("Seele" bzw. "anima"
hat diesen Sinn verloren), wie auf der soziologischen umfassende
Begriffe für den Träger der Gesellschaftseinheit
(vielleicht am ehesten "Kultur", gelegentlich auch "Staat", was aber
beides im üblichen Sprachgebrauch nur je partielle Inhalte
trifft). Ich werde den Ausdruck "Kultur" zur Bezeichnung eines
Trägers der Gesellschaft (und gelegentlich den Ausdruck
"Ökosystem" für das Insgesamt von Personen in Kultur und
Gesellschaft) verwenden.
Vor allem aber muss uns jetzt in einer dezentrierenden
Vorgehensweise interessieren, was die Bedingungen dieser
angetroffenen Gebilde sind; wie sie sind, warum sie gerade so
sind.
Inhalt
Speicherung als konstituierendes
Prinzip von Einheiten
Alle diese drei Einheiten oder Gebilde, die je den Biologen,
Psychologen, Soziologen primär interessieren, sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie in einer nicht-umkehrbaren Zeit Konstanz und
Wandel aufweisen, von einem Beginn weg bis zu einem Ende sich
entwickeln und doch stets mit sich identisch bleiben. Ich verweise
auf Kurt Lewin, insbesondere sein Konzept der Genidentität
(1922).
Wie schaffen es diese Gebilde, über die Zeit weg trotz Wandel
einheitlich und sich selbst zu bleiben? Meine These lautet: Im
wesentlichen, indem sie eine Spur ihrer Geschichte herstellen und
mitnehmen und daraus nach Bedarf dergestalt aktivieren, dass jeweils
Späteres auf jeweils Früheres bezogen bleibt. Das erlaubt
ihnen nicht nur, in der jeweiligen Gegenwart recht adäquat zu
handeln, sondern sogar in mancher Hinsicht zutreffend Zukunft zu
antizipieren, insofern Früheres funktionell auf Späteres
bezogen wird. Und strukturell entstehen durch diese dynamische
Speicherung Gebilde, die "etwas über dem Fluss der Zeit"
existieren, indem im Speicher, in einem separaten, eigenen
Repräsentationssystem also, Relationen realisiert werden
können, welche in der realen Zeit unmöglich wären.
Diese Gebilde behaupten sich in ihrem Umfeld, weil sie ihre
Geschichte speichern und diesen Speicher dynamisch nutzen.
Inhalt
Was sind die Speicher dieser
Gebilde?
Worin bestehen nun die Speicher dieser drei Gebildetypen? Sind sie
gleich oder unterschiedlich? Meiner Meinung nach sind sie trotz
mancherlei Unterschieden in ihren funktionalen und strukturalen
Bedeutungen, die sie für das jeweilige Gebilde haben,
erstaunlich gleichartig.
Zelle Ð Genom
Der Speicher oder das Gedächtnis der Zellen (dh der
emergierenden Gebilde, die uns als Zellen begegnen) ist das Genom.
Die Gene in jeder Zelle in ihrer Gesamtheit sind eine Geschichte
nicht der betreffenden Zelle, sondern ihrer Evolution bis zu diesem
Zeitpunkt. In die DNA-Doppelspiralen verdichtet ist alles Wesentliche
dessen, was den Vorfahren der Zelle (nicht als materielle, sondern
als strukturelle Einheit verstanden, als emergierendes
Informationsbündel, wenn man will) widerfahren ist. Das Genom
resümiert die Geschichte seines Aufbaus durch Mutationen und
Rekombinationen; und es "kennt" implizit die Geschichte seiner
Spezialisierung durch umwelts- (oder besser passungs-) bestimmte
Selektion (vgl. unten 1.3.4.2); denn es ist in der Lage, auf dem
Umweg über seine Organismen sich dieser Spezialisierung
gemäss zu verhalten und muss diese Spezialisierung nicht
jedesmal neu erwerben. Das Genom hat einen unglaublich funktionellen
Mechanismus der Erhaltung seiner Emergenz erfunden, nämlich die
Reduplikation einerseits und die Bildung von Organismen anderseits,
die jedem tauglichen Typus geeignete Reduplikationsbedingungen
bereithalten. Insofern das Genom die Morphologie und das Verhalten
der aus den Zellen aufgebauten Organismen (Zellverbänden) und
deren Gruppierungen (Organismenverbänden) derart bestimmt, dass
weitgehend das wiederholt wird, was sich unter ähnlichen
Bedingungen früher bewährt hat, ist nicht nur Vergangenheit
vergegenwärtigt, sondern auch eine ungemein effiziente
Antizipation der Zukunft geleistet, falls sich die
Umgebungsbedingungen, das Milieu der Zellgruppen, nicht radikal
ändern. Die Pufferung durch die Zellverbände fängt
dabei immerhin Etliches an Änderungen auf.
Organismus Ð Gedächtnis i.ü.S.
Die Speicherung des Organismus ist das über die Ontogenese
aufgebaute und ausdifferenzierte Gedächtnis, den Ausdruck hier
zwar im üblichen Sinn, aber doch sehr weit verstanden als die
individuelle, dynamisch-organisierte Gesamtheit der Erfahrungsspuren.
Sie ist eine aktive Ressource, welche ihren Träger von den
unmittelbar auftreffenden Informationen und wirksamen Impulsen
relativ unabhängig macht, derart, dass neue Information weder
unvermeidlich stören (Selektivität der Wahrnehmung), noch
jederzeit unbedingt erforderlich sind (Wahrnehmungsergängzung
u.ä.). Und natürlich in noch weitergehendem Ausmass als
beim Genom erschliesst es die Vergangenheit in der und für die
Gegenwart und macht den Träger des Gedächtnisses
erstaunlich zukunftstauglich. Infolge seiner im Vergleich zum Genom
grösseren Beweglichkeit gewinnt dieses Gebilde vermutlich jene
eigenartige Fähigkeit zur speziellen Binnenstrukturierung, die
wir in seiner bislang komplexesten Ausformung mit dem Begriff des
"Selbst" in Verbindung bringen. Das Gebilde als ganzes gewinnt so
durch seine Binnenstrukturierung und deren stark zentralisierende
Organisation eine bei nicht so ausgestatteten Gebilden undenkbare
Handlungsfreiheit.
Für Psychologen brauche ich dies alles nicht weiter
auszuführen. Merkwürdig mutet mich allerdings immer wieder
an, dass wir Psychologen es bisher nicht geschafft haben, für
dieses allerwichtigste unserer Konstrukte einen gängigen und
allgemein akzeptierten Terminus zu schaffen, als
theorie-unspezifischen Oberbegriff, meine ich. Aber Termini wie
Erkenntnisstruktur, kognitive Struktur, Lebensraum usf. sind
vielleicht halbwegs verständlich; "Gedächtnis", wie ich den
Begriff hier brauche, ist durch den üblichen Wortgebrauch
belastet und bringt die dynamischen Wirkungen der ontogenetischen
Speicherungen nichtso recht zum Ausdruck.
Gruppe Ð die Kultur: Gebautes, Gestaltetes,
Geschriebenes
Auch die Gesellschaften haben Speicher. Gebaute Strukturen und
gestaltete Objekte (also z.B. Wohnanlagen und die Dinge darin und
darum herum) sowie alle andern nichtflüchtigen Zeichensysteme
(insbesondere Schrift und Bild) sind die Speicher der (Sub-)Kulturen.
All diese Dinge enthalten die Geschichte (ebenfalls nur implizit, wie
auch bei Genom und Individualgedächtnis) der Kultur, machen die
Kultur in ihren wesentlichen Bestandteilen in der Gegenwart wirksam
und bestimmen wiederum durch ihre relative Dauerhaftigkeit die
Zukunft der Kultur und mithin der Gesellschaft.
Wenn wir so tun, als wäre die Kultur ein Subjekt,
vergleichbar dem psychologischen Individuum, so könnten wir in
psychologischer Sprache ohne weiteres sagen, die gebauten Strukturen
und gestalteten Objekte einschliesslich der nichtflüchtigen
Zeichensysteme seien die Erkenntnis- und Handlungsstrukturen der
Kultur; im Unterschied zu den traditionellen kognitiven Strukturen
der Psychologie sind sie externalisiert und kollektiv (vgl. Lang et
al. 1987).
Der Begriff der Kultur macht allerdings einige Schwierigkeiten. Er
ist dem Subjektscharakter solcher Gebilde nicht sehr angemessen, weil
Kultur ja auch den Individuen interne Zeichensysteme mit
einschliesst. Damit Gestaltetes zu Kultur und Kultur den Menschen
eigen wird, müssen Kultivationsprozesse eine wechselseitige
Ausformung der Kultur und derbeteiligten Personen bewirken (vgl.
Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 1981). Denn die
Binnenstrukturierung der Kultur geht ja weit über diejenige beim
ontogenetischen Gedächtnis hinaus. Und es kommt nicht wie von
selbst zur Herausbildung einer zentralen Instanz, wie sie das
personale Selbst darstellt; vielmehr stellt sich deren Schaffung in
Form von handlungsfähigen Institutionen erst als eine
Aufgabe.
Dennoch speichern und repräsentieren die Dinge einer Kultur
(ähnlich wie das Genom die Stammeserfahrung und das
persönlichen Gedächtnis die individuelle Erfahrung) den
Niederschlag der Tätigkeit einer Gruppe, derart dass die
weiteren Tätigkeiten dieser Gruppe bzw. ihrer Nachfolgegruppen
daraus mitbestimmt werden. Solche Repräsentationen enthalten
immer Information sowohl über die Umwelt (d.h. die das Subjekt
umgebende Welt) wie über die Möglichkeiten des Umgangs mit
ihr; sie sind also durchaus mehr als Abbilder, nämlich immer
auch Anleitungen; das heisst, sie sind generativ.
Inhalt
Speicherformen
Gemeinsames der drei Speicherformen
Gebautes und Gestaltetes ist demnach für eine Gruppe
funktional dasselbe wie das Gedächtnis für die Person und
das Genom für den Organismus: eine unabdingliche, obgleich nicht
vollständige Bedingung ihrer Existenz.
Eine bio-psycho-soziologische Evolutionsgeschichte und -theorie
der generativen Speicherung wäre allerdings erst zu formulieren.
Die Bedeutung gespeicherter Repräsentationen (Genom,
Individualgedächtnis, Gestaltetes und Geschriebenes) kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden, weil sie die Emergenz der sie
hervorbringenden "Subjekte" und ihrer Verbände begründen
und damit sowohl ihre Konsistenz sichern wie ihren Wandel
ermöglichen.
Um die Rolle des kulturellen Gedächtnisses, die uns im
Zusammenhang mit der Entwicklungspsychologie interessiert, besser zu
verstehen, muss hervorgehoben werden, dass in allen drei Fällen
mit dem "Gedächtnis" eine Art "Verdoppelung" des gegebenen
Gebildes entsteht, oder besser eine Binnenstrukturierung mit zwei
Teilgebilden, die zueinander in ein eigenartig dialektisches
Verhältnis treten. In allen drei Fällen haben nämlich
die beiden beteiligten Teilsysteme unterschiedliche zeitliche
Eigenschaften: das Genom (jedenfalls was seinen Informationsgehalt
berifft) überdauert seine Organismen. Ähnliches gilt auch
für das ontogenetische und das kulturelle Gedächtnis,
insofern die individuelle Erkenntnisstruktur frühere Erfahrungen
und sogar künftige Möglichkeiten aktualisieren und für
das aktuelle Handeln auswerten kann und insofern die für eine
Kultur typischen Werkzeuge, die Bauten, die Kult- und Alltagsobjekte
in der Regel (zumindest in ihrer Form) viele Generationen
überspannen und jederzeit wirksam werden können.
Während also die uns zunächst interessierenden Gebildetypen
Zelle, Organismus und Kultur zeitabhängig existieren, haben
diese Gebilde zugleich in oder durch ihre Gedächtnisse eine
beträchtliche Unabhängigkeit von der Zeit errungen dadurch,
dass sie Repräsentationen ihrer Eigenschaften und Akte zu
anderen Zeitpunkten verfügbar halten. Man sollte vielleicht
besser sagen, diese Gebilde realisierten in ihrer Existenz stets zwei
Zeitströme: einen direkten, den wir an ihnen wahrnehmen
können, und einen indirekten, in einem spezielleren Medium
realisierten, den ich hier ihr Gedächtnis nenne. Es wird zu
zeigen sein, dass in dieser zeitlichen Doppeltheit die entscheidende
Voraussetzuzng der Entwicklungsfähigkeit dieser Gebilde
liegt.
Unterschiede in Zellen, Organismen, Gruppen
Nun fallen freilich auch Unterschiede bezüglich der
zeitlichen und räumlichen "Verteilung" dieser überdauernden
Repräsentationen in den Trägern (Zellen, Organismen,
Kulturen) auf.
Zellen haben für das Genom eine starke örtliche
Konzentration sowie einen ausserordentlich zuverlässigen
Reproduktionsmechanismus erreicht, der bei langsamem Wandel eine hohe
zeitliche Stabilität (Permanenz) und eine enorme räumliche
Verbreitung sichert, allerdings auf Kosten von Flexibilität.
Organismen haben zur Erhöhung der Flexibilität
(Ablösung der Instinkte durch Intelligenz, d.h. der im Genom
mitgegebenen perzeptiven und exekutiven Koordinationen für den
Umgebungsbezug durch die Möglichkeit erfolgreichen Umgangs mit
neuen Situationen) flüchtige Gedächtnisse evoluiert, welche
nicht nur verhältnismässig unzuverlässig sind, sondern
auch als ganze nicht reproduktionsfähig. Sie sind zwar auch
örtlich konzentriert, aber zeitlich und räumlich einmalig,
d.h. sie können nur dann und dort wirken, wo das Subjekt aktuell
tätig ist.
In Kulturen ist die örtliche Konzentration der Speicherung
aufgegeben und dafür die Reproduktionsfähigkeit
wiedergewonnen worden, allerdings nur in Teilen (viele gleiche
Häuser oder Bücher oder andere Zeichen; aber keines, das
die Kultur als Ganze repräsentiert, während das Genom und
in gewisser Hinsicht auch das Individualgedächtnis den ganzen
Organismus bzw. die ganze Person enthalten). Das sichert auch eine
relativ grössere räumliche Verbreitung und zeitliche
Permanenz. Allerdings ist diese Repräsentation auch recht
unsicher, insofern sie zu ihrem Wirksamwerden einer Aktualisierung
(Bedeutungsverleihung) durch Personen bedarf und auf Komplemente in
deren Gedächtnis (Enkulturation) angewiesen ist. Ähnlich
wie bei den Personen kommt es daher bei den Personenverbänden zu
einer Individualisierung der und Konkurrenz zwischen den Subjekten
(Gesellschaften); aber die verschiedenen Kulturen bzw.
Ökosysteme haben gegeneinander unscharfe Grenzen und sind intern
vielfach geschichtet.
Unterschiedliche Grade der Zentralisierung der Binnenstruktur auf
den drei Gedächtnisebenen habe ich oben angedeutet, kann sie
hier nicht ausführen.
Einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen den drei
Einheitenebenen finden wir bezüglich der Speicherkapazität
und der Passungsforderung.
Die beiden ersten Formen von "Verdichtung" der Welt (Leben,
psychische Organisation) haben vermutlich raumzeitliche
Kapazitätsgrenzen in dem Sinne, dass eine weitere Steigerung
ihrer Grösse ihr Funktionieren gefährden würde: die
Reproduktionssicherheit nimmt vermutlich mit zunehmender Anzahl der
Gene ab; der energetische Haushalt des Hirns lässt nach Ansicht
vieler Stoffwechselphysiologen eine höhere räumliche
Verdichtung, als beim Menschen erreicht ist, nicht zu.
Die Vermehrbarkeit von Kulturobjekten scheint hingegen unbegrenzt,
ebenso die Intensivierung des Informationsaustausches zwischen den
vergesellschafteten Individuen. Die beliebige Vervielfältigung
standardisierter Objekte (Bauten, Mobiliar, Bilder, Texte) ist das
eigentliche Kennzeichen der anthropozentrischen Moderne.
Dementsprechend wurde und wird in der industrialisierten
Massenproduktion von Gütern ein unerhörtes Niveau erreicht;
eine derart hohe Dichte ihrer Verbreitung ist noch nie dagewesen.
Allerdings erfüllen diese Güter nur noch zu einem kleinen
Teil und oft nur nebenbei eine Subsistenzfunktion; in erster Linie
sind sie vielmehr Bedeutungsträger und Kommunikationsmittel im
zwischenmenschlichen Austausch geworden.
Passungforderung: Betrachtet man die Trägerstrukturen und
-prozesse (traditionell die Objektwelt der Naturwissenschaften) oder
die Inhalte (traditionell die Subjekte, mit deren Dasein und
Wirkungen sich die Geistes- und Sozialwissenschaften befassen) je
für sich, so besteht in der Tat kein Grund, die Grenzenlosigkeit
dieser Gebilde in Frage zu stellen: der beliebigen Vermehrung der
Menschen wie der Güter scheinen nur praktische, nicht
prinzipielle Restriktionen gesetzt. Das ändert sich jedoch
radikal, wenn man Ökosysteme, d.h. Menschengruppen in konkreten
Welten betrachtet, also Passungsforderungen zwischen Subjekten und
"Objektwelten" berücksichtigt. Es wird dann evident, dass die
Endlichkeit der existentiellen Ressourcen (Nahrung, Materialien) und
die mit ihrer Umsetzung verbundenen Folgen
(Energieverteilungsverflachung, Nebenwirkungen) ebenso limitierende
Faktoren darstellen wie die Enge der informationsverarbeitenden
Kanäle in den Personen und die Kleinheit der
interaktionsfähigen Oberflächen.
Bevor etwa die materielle Güterproduktion an die Grenzen der
Ressourcen stösst, werden durch Nebenwirkungen das Leben und
bereits auch die Funktionsfähigkeit der Psyche gefährdet.
Auch die in Zeichen eigener Art niedergelegten Bedeutungen, also
sprachliche und bildliche Information, haben nämlich mit
technischer Unterstützung eine Dichte erreicht, die ihren Sinn
selbst in Frage stellt. Für die kulturelle Verdichtung gibt es
also ebenfalls Grenzen, bei deren Überschreitung Dysfunktionen
zu erwarten sind. Oder konstruktiver formuliert, in der Evolution der
Ökosysteme wirken auch auf der Ebene der Personenverbände
Stabilisierungsfaktoren derart, dass die räumliche und zeitliche
Diffusion der Träger zugunsten von Qualitäten des
Getragenen Beschränkungen eingeht.
Inhalt
Kopernikanische
Dezentrierung zum ökologischen System
Damit komme ich zum Kern meiner Argumentation. Eine andere
Möglichkeit der Dezentrierung anstatt auf die Pluralität
der erkennenden und handelnden Subjekte und damit eine
Möglichkeit der Überwindung des Anthropozentrismus und
seiner Folgen besteht darin, die Gegenstands-Einheiten und deren
Binnenstrukturen neu zu sehen.
Wie schon angedeutet haben einige Biologen dies für das
Verhältnis zwischen Genom und Zelle (bzw. Organismus bzw. Leben)
bereits getan. Dawkins (1976) Standpunktwechsel vom Genom im Dienste
der Art zum "egoistischen Gen", das sich Zellen und Organismen als
"Überlebensmaschinen" konstruiert, ist eine solche
Dezentrierung. Zu wünschen ist, dass diese Perspektive nicht wie
die alte Sicht der Dinge verabsolutiert wird, sondern dass man sich
um die Reversibilität dieser Sichten und damit um einen
Aussenstandpunkpunkt bemüht.
Auf der soziologischen Ebene sind Dezentrierungen in Form von
Kulturrelativierungen seit dem Strukturalismus nicht unüblich:
der Gesellschaftsforscher als Ethnologe oder Kulturhistoriker
thematisiert auch und fokussiert den "Speicher". Allerdings wird
dieser dann nicht selten seinerseits verabsolutiert und die in ihm
repräsentierten Menschen tendenziell vernachlässigt, wenn
Kulturgeschichte zur Sammlung, zum Kuriositätenkabinett,
degradiert.
In unserem Zusammenhang interessiert vor allem die psychologische
Ebene, und hier scheint mir auch der Gewinn der neuen
Betrachtungsweise am unmittelbarsten. Ich skizziere in groben
Strichen:
Ein kopernikanisches, nicht mehr anthropozentrisches Menschenbild
akzeptiert, dass kein Mensch in sich selbst ein lebens- und
handlungsfähiges Gebilde ist. Traditionelle Psychologie
konzipiert einen Organismus (ein Individuum) als Gegenstands-Einheit
und untersucht ihn günstigenfalls in seinen Interaktionen mit
einer ad hoc ausgeschnittenen sogenannten Umwelt, je nach Bedarf und
Willkkür den einen oder andern Ausschnitt.
Wenn aber dieses Individuum auch zugleich ein Glied einer
Gesellschaft ist, deren Existenz in der Kultur repräsentiert
ist, so dürfen wir deren vergegenwärtigte Geschichte so
wenig aus der Betrachtung ausschliessen, wie die im Genom
repräsentierte Geschichte der Zellen, aus denen der Organismus
konstituiert ist. Ich kann natürlich nicht im Ernst behaupten,
dass wir in der Psychologie die Umwelt ausschliessen. Ich meine nur,
dass wir sie sehr ad hoc berücksichtigen. Unsere Reiz- und
Situationsbeschreibungen erfolgen nach jeweiligem Belieben und
Gutdünken; wir haben keine Systematik dafür und keine
selbstverständliche Haltung des Umgangs mit ihr. Wir forschen
und denken immer unter der einseitigen Subjekt-Objekt-Spaltung. Wir
vergessen, wie sehr unsere Umgebung in der Geschichte (hier also auch
der Ontogenese) einen Subjektcharakter hat und unser Individuum und
die Person als ihr Objekt hervorbringt (vgl. Boesch 1980, 1983 und
Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton 1981).
Hat man einmal festgestellt, wie sehr dieses Individuum in seiner
personalen Existenz nicht auf seinen Organismus beschränkt ist,
obwohl es mit ihm geboren wurde und sterben wird, so erkennt man
unser gängiges psychologisches Denken und Forschen als partiell,
und man sucht nach Wegen, wie Mensch-Umwelt-Gebilde
grundsätzlich zum Gegenstand der Psychologie gemacht werden
könnten. Dafür eignet sich meines Erachtens die Bezeichnung
ökologische Psychologie.
Was die soziale Umwelt betrifft, wurde dieser Schritt bereits in
der Sozialpsychologie ein Stück weit vollzogen. Er ist
naheliegend und unter dem Anthropozentrismus vollziehbar, weil die
soziale Umwelt in mancher Hinsicht leichter als "andere Subjekte"
begriffen werden kann. Erst rudimentär haben wir aber eine
Umweltpsychologie, was die physischen Gegebenheiten betrifft; und
kaum ernsthaft angefangen eine Kulturpsychologie (Boesch 1980). Wobei
gleich angefügt sei, dass sich Physisches (Gestaltetes
insbesondere), Soziales und Kulturelles natürlich nur als
Aspekte, nicht als eigene Bestandteile der erweiterten Person fassen
lassen.
Wie schon ausgeführt, kann man diese Gebilde nur dann
angemessen verstehen, wenn man die Repräsentation ihrer
Geschichte in die Gegenstands-Einheit aufnimmt. Das führt zum
Programm einer ökologischen Entwicklungspsychologie.
Inhalt
Zu einer ökologischen
Entwicklungspsychologie
Entwicklungstheorie im Bild: Escher
Natürlich habe ich hier nicht eine ökologische
Entwicklungstheorie anzubieten; ich muss auch aus Raumgründen
auf die Erwähnung der einschlägigen Literatur
verzichten.
Figur 1. "Befreiung", Lithographie (1955) von M.C. Escher.
Erläuterung im Text.
Anstelle einer verbalen Ausformulierung einer möglichen
ökologischen Entwicklungspsychologie regrediere ich deshalb auf
Bildhaftes. Maurits Eschers Bildrolle der sich ausdifferenzierenden
Vögel (Figur 1, vgl. Lang 1981, wo leider das Bild
verstümmelt wiedergegeben wurde) vermittelt vorteilhaft Einsicht
in die wichtigsten Aspekte dieser komplexen Zusammenhänge.
• Dass alles auf eine Bildrolle gezeichnet ist, markiert die
Unvermeidlichkeit eines Betrachterstandpunktes.
• Dass es um Emergenz von Gebilden geht, kommt in dem
aufsteigenden Formenwandel zum Ausdruck.
• Ursprünglich (bei den Anfängen am unteren
Bildrand) scheint Gleichartigkeit von sich wechselseitig
konstituierenden Gebilden bestanden zu haben; Entwicklungsträger
und Entwicklungspartner sind von einem Aussenstandpunkt her
verwechselbar. In der Tat kann man etwa für ko-evoluierende
Arten oder für Mutter und Kind nur jeweils von einem bestimmten
Standpunkt aus behaupten, die(das) eine sei für die(das) andere
durchgängig wichtiger als umgekehrt.
• Zu einem bestimmten Zeitpunkt allerdings sind diese
"Symbiosen" immer wieder mal asymmetrisch, teils in der Sache, teils
infolge unterschiedlicher Betrachterstandpunkte: Escher lässt
die Teilgebilde wachsen und schrumpfen; die Eigenart des Bildes als
Kippfigur in der Wahrnehmung eines Betrachters zeigt den
Perspektivenwechsel: Figur und Grund sind zwar jederzeit eindeutig,
aber sie bleiben nicht konstant.
• Zusammen mit seinem jeweiligen "Kippfigur-Partner" im
gemeinsamen Milieu wandelt sich jedes der beteiligten Gebilde im
Laufe der dargestelltzen Reihe und bleibt doch trotz der wechselnden
Form als in seiner ganzen Reihe das Gleiche bleibend erkennbar. Die
unterschiedliche Zeitlichkeit der beteiligten Gebilde konnte das Bild
allerdings nicht einfangen.
• Das Bild deutet schliesslich an, dass
Entwicklungsträger und -partner immer auch einen gemeinsamen
Grund haben oder finden und sich ihrerseits einmal in diesem
auflösen werden…
Aber ich möchte das hier beigezogene bildhafte Denken auch
nicht überstrapazieren.
Ein kopernikanisches Menschenbild als Voraussetzung von
Entwicklungstheorie
Entwicklungstheorie, also Erklärung von Entwicklung, muss
notwendig ökologisch sein, weil nur durch die
Binnendifferenzierung eines sich entwickelnden Gebildes in zwei
voneinander partiell unabhängige, aber aufeinander einwirkende
Teilgebilde mit ungleichen zeitlichen Eigenschaften ein Prozess mit
bleibenden Wirkungen aufrechterhalten werden kann.
Das ist auf den ersten Blick wieder trivial, weil Sozialisation,
Enkulturation, Erziehung schon immer so verstanden worden sind,
allerdings wurden die beteiligten Gebilde zumeist als
ungleichgewichtig gesehen. Zu prüfen bleibt deshalb, ob und was
die Dezentrierung vom Individuum auf seinen Entwicklungspartner, auf
die es umgebenden Bedeutungsträger der Kultur bringt.
Der grosse Erfolg der biologischen Entwicklungstheorie beruht m.E.
darauf, dass zur Erklärung von Entwicklung zwei voneinander
unabhängige Schrittphasen und damit zwei voneinander
unabhängige Instanzen konzipiert worden sind, nämlich
Strukturveränderung der organismischen Entwicklungsträger
(die zu anderen Einwirkugen auf die Umgebung führen) und
selektiver Eingriff ihres "Entwicklungspartners" in ihrem gemeinsamen
Milieu. Der Blick des Entwicklungsbiologen alterniert demnach
zwischen der Betrachtung der organismischen Systeme und derjenigen
der Umgebungsbedingungen und der jeweils von ihnen auf den
Entwicklungsträger ausgehenden Wirkungen hin und her. Darum ist
die Kippfigur von Escher als Metapher so gut.
Die psychologische Entwicklungstheorie hingegen hat
anthropozentrisch den Menschen und seine Umwelt entweder völlig
voneinander abgetrennt oder vermengt. Sie kam so zu unrealistischen
Behauptungen, nämlich dass Entwicklung notwendig in einer
bestimmten Weise verlaufe (wenn Innenbedingungen verabsolutiert
wurden) oder dass sie beliebig verlaufe (wenn Aussenbedingungen
für einzig wesentlich gehalten wurden). Praktisch wurden
natürlich Kompromisse zwischen diesen beiden Thesen eingegangen;
unbefriedigende Kompromisse, denn Prozess-Modelle der Onrtogenese
erwiesen sich bis jetzt als nicht durchführbar.
Dass und wie die Wirkungen des traditionellen Entwicklungssubjekts
auf seinen "Entwicklungspartner" einbezogen werden können und
müssen, in unserem Fall vor allem auf das physische, soziale und
kulturelle Milieu, oder noch besser das systemische Zusammenwirken
der beiden in einer stets gemeinsamen Entwicklung, versuche ich nun
anhand von Beispielen aufzuzeigen.
Inhalt
Beispiele
Ich skizziere ganz kurz vier Beispiele, teils aus fremder, teils
aus eigener Forschung.
Frühe Kindheit: Mutter und Kind
Ich beginne mit einem Beispiel, bei dem der Entwicklungspartner
des kleinen Kindes überwiegend als soziale Grösse
verstanden werden kann; also ein relativ vertrautes Feld des
Entwicklungspsychologen, für das die Bezeichnung ökologisch
eher ungewöhnlich ist: Mutter und Kind in der frühen
Interaktion. In den letzten gut 10 Jahren sind eine Reihe von Studien
publiziert worden, welche zeigen, in welchem Ausmass wir irren, wenn
wir die Mutter bloss als sozialisierende Instanz verstehen. Beispiele
aus der zeitlichen Koordination des gemeinsamen Verhaltens,
vorsprachlicher und sprachlicher Dialog, oder die wechselseitige
Stimmungs- und Aufmerksamkeitsregulation, Bindungsprozesse u.a.m.
sind einigermassen allgemein bekannt geworden.[Footnote #6]
Eine Dezentrierung vom Sozialisanden auf den Interaktionsprozess ist
hier exemplarisch erfolgreich geworden.
Was zudem vom Kind für Wirkungen auf Entwicklungsprozesse der
Mutter ausgehen, und was dann deren Resistenz dagegen und was dadurch
induzierte Veränderungen für das Kind bedeuten, ist aber
noch kaum empirisch angegangen worden.
Liebgewordene Dinge
Als zweites Beispiel erwähne ich ein von den Psychologen
extrem vernachlässigtes und auch sonst eher unterentwickeltes
Feld: die psycho-soziale Bedeutung der Dinge des Alltags. In dem Buch
von Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton (1981): Der Sinn der
Dinge: Das Selbst und die Symbole des Wohnbereichs, - wir bereiten
derzeit eine deutsche Übersetzung vor - wird theoretisch und
wenigstens befragungsempirisch deutlich gemacht, in welchem Ausmass
der Bezug zu seinen Dingen oder die "Kultivation" der bevorzugten,
verehrten, liebgewordenen Alltagsgegenstände ("cherished
objects") einen Menschen "definiert". Der über die Lebensalter
dokumentierte Wandel der bevorzugten Kultivationsobjekte, und ebenso
die unterschiedliche Rolle von gleichen Objektkategorien in
verschiedenen Lebensphasen verbirgt eine noch ungehobene Goldmine
für die Konkretisierung und das Verständnis von
Entwicklungsprozessen. Ich muss allerdings beifügen, dass die
Untersuchung selber nicht im angesprochenen Sinn anthropo-dezentriert
angelegt ist; aber sie fokussiert wenigstens auf die andere Seite der
Partnerschaft.
Wohnpsychologie
Im Zuge der Konkretisierung einer ökologischen
Entwicklungssychologie richtet sich mein Hauptinteresse auf jene
Mensch-Umwelt-Gebilde, bei denen sich Impulse, die vom Individuum
ausgehen, im Entwicklungspartner als Spuren niederschlagen, die sich
später wieder geltend machen, derart dass
Interaktionsverläufe über mehrere Hins und Hers verfolgt
werden können. Denkbar, dass der Umgang mit Mikrowelten im Sinne
von Seymour PAPERT (1980) solche Entwicklungsökologien
darstellen lässt und auch relativ leicht experimentelle
Anordnungen erlaubt. Ich habe mich darauf aber nicht empirisch
eingelassen, weil mir der heute noch unvermeidliche Zwang zur
Verwendung von überaus artifiziell symbolisierten Medien, also
der sterile Weltbezug am Computerinterface, zu grosse Sorgen
macht.
Das Feld, in dem mir die Notwendigkeit der Dezentrierung vom
Subjekt klar geworden ist, ist dieWohnpsychologie, die Idee des: Wir
machen Häuser, was machen die Häuser mit uns? (vgl. Lang et
al. 1987). Mancherlei Studien führen zur Überzeugung, dass
es nicht gleichgültig ist, in welcher Wohnsituation Kinder
heranwachsen: also die Häuser machen etwas mit uns. Sie
verändern sich ja aber auch, oder sie werden verändert, auf
mehreren Zeithorizonten überlappend: in der Kulturgeschichte, in
den Modeströmungen der industriellen Produktion, in den
Geschmackswellen der Medien, mit den Lebensphasen der Bewohner, mit
Ursachen, die wir noch kennenlernen sollten.
Ich erwähne als Beispiel eine Diplomarbeit (Bos 1983), in der
wir die Geschichte von Familien und die Geschichte ihrer
Einfamilien-Häuser in Parallele gesetzt haben, in Form von
Fallstudien, retrospektiv über 10 Jahre. Mit einem besonders
eindrücklichen Fallbeispiel kann ich die intendierte
Entwicklungsdialektik zwischen den Partnern Familie und Haus am
leichtesten illustrieren. Die Gründung eines eigenen
Geschäfts durch den Familienvater brachte Umstellungen, das
Büro wurde im Haus eingerichtet, um der Mutter teilzeitliche
Mithilfe neben der Kinderbetreuung zu erleichtern. Der
geschäftliche Erfolg brachte rasch den Druck auf
Vergrösserung und damit den Anbau eines Zimmers als Büro.
Ein zweites Zimmer im ersten Stock war aus baulichen Gründen
naheliegend, was dazu beitrug, dass die Grossmutter in die Familie
aufgenommen wurde. Damit konnte sich die Mutter, von der
Kinderbetreuung teilweise entlastet, noch vermehrt dem Geschäft
widmen. Dieses florierte und rief nach prestigeorientiertem Ausbau
der Wohnräume und einer Gartenterrasse, u.a. für
Kundenempfänge.
Schwieriger erwiesen sich Zeitbudget- und Befragungsstudien
über die Entwicklung des Bezugs von jungen Jugendlichen zu ihrer
Wohnumwelt (Vogt & Loder 1982). Faszinierend erschien uns hier
die phasenweise "Eroberung" vom eigenen Zimmer her zunächst der
Wohnung und der Wohnumgebung, später von Quartier und Stadt, und
die damit in die Person aufgenommenen Lebenshorizonte.
Bedrückend zugleich die bedenklich Festigkeit der baulichen
Situation des Hochhausquartiers, die weder in den Zimmern, noch den
Wohnungen noch gar in der Wohnumgebung den Jugendlichen
Gestaltungsfreiheiten eröffnete und damit das anvisierte
Entwicklungsspiel zwischen Mensch und Umwelt restringierte.
Betagte im Übergang zum Heim
Als letztes Beispiel erwähne ich eine Studie über den
Einzug von Betagten ins Altersheim (Lang et al. 1987). Durch
Verhaltenskartographie, in strukturierten Gesprächen und mittels
systematischer Aufnahme aller Veränderungsspuren in den
halböffentlichen Heimbereichen über längere Zeit
versuchten wir der Rolle des Heims als physisches Setting beim
Vollzug des Entwicklungsschrittes dieser Personen von der
selbständigen Wohnungsführung zum institutionell
behüteten Heiminsassen nachzugehen. Bestürzend war zu
sehen, in welchem Ausmass auch eine fortschrittliche Heimarchitektur
blind ist für den Menschen, dem sie dienen will.
Ästhetische und wirtschaftliche Kriterien, Pflegeleichtigkeit,
Einheitlichkeit und dergleichen Aspekte dominieren fast total. Man
muss schliessen, dass dem Betagten der Übergang in diese neue
Lebensphase durch die physischen Gegebenheiten beträchtlich
erschwert, dass ihm mehr als nur eine neue Wohnform aufgenötigt
wird.
Inhalt
Grundgedanken in
Thesenform
Die Überwindung des herrschenden Anthropozentrismus in der Psychologie ist notwendig und überfällig. Sie könnte zwei Dezentrierungen erbringen: Eine nicht-hierarchisch-reduktionistische Einordnung psychologischer Sichtweisen des Menschlichen zu anderen, gleichwertigen und reversiblen Betrachtungsweisen , und
eine Dezentrierung von der gängigen Gegenstands-Einheit "Individuum/Person" auf Mensch-Umwelt-Gebilde, dh eine ökologische Haltung.
"Speicherung" oder "Gedächtnis" erweist sich in ökologischer Sicht nicht nur als ein Einheiten konstituierendes Prinzip, sondern auch als Voraussetzung von Konsistenz und Wandel, also von Entwicklung.
Denn Entwicklung, ökologisch verstanden, setzt wenigstens ein Gebilde mit zwei Teilsystemen (eine Partnerschaft) voraus, von denen eines "verfestigter" ist als das andere, welche also unterschiedliches "Zeitverhalten" aufweisen.
Die Durchführung dieses Gedankens bezüglich der Entwicklung von Menschen in ihrer physischen, sozialen und kulturellen Umwelt legt nahe, diese beiden Entwicklungspartner Mensch und seine Umwelt in einem symmetrischeren Verhältnis zu verstehen als es in unserer Zivilisation üblich ist. Dieses neue Verhältnis habe ich als "kopernikanisches Menschenbild" bezeichnet, weil es reversiblen Perspektivenwechsel voraussetzt.
Die vorgetragenen Ideen haben neben wissenschaftstheoretischen und psychologiekritischen nicht zuletzt auch starke ethische Wurzeln; die Pflege eines dezentrierten Menschenbildes hat mithin wohl auch ethische Konsequenzen, die vor allem, doch nicht nur, unseren Umgang mit unserer Umwelt betreffen.
Inhalt
Schlussbemerkung
Zum Abschluss möchte ich versuchen, eine naheliegende
Reaktion auf diesen Beitrag zu neutralisieren. Die Aufforderung an
Menschen, sich mit einem Menschenbild anzufreunden, in welchem der
Mensch nicht mehr den zentralen Platz einnimmt, sei zu absurd, als
dass sie ernsthaft erwogen werden könne. Da der in Aussicht
gestellte Vorteil für die Psychologie, die Möglichkeit
überhaupt einer Entwicklungstheorie, zudem mit der Zumutung
verbunden sei, fast alle Denkgewohnheiten über psychologische
Gegenstände auf den Kopf zu stellen, sei sie auch nicht
praktikabel. Den Feststellungen der beiden Einwände kann ich
schwer ernstlich widersprechen; dass ich dennoch meinem Programm zu
folgen versuche, hat also vielleicht weniger rationale als
pragmatische Motive. Denn was, wenn die Welt uns unseren Platz in ihr
zuweist, bevor wir selber ihn gut genug erkannt haben?
Inhalt
Literatur
Boesch, Ernst E. (1980): Kultur und Handlung. Bern, Huber.
Boesch, Ernst E. (1983): Das Magische und das Schöne: zur
Symbolik von Objekten und Handlungen. Stuttgart, Frommann.
Bos, Gerrit (1983): Die Wechselwirkung zwischen Wohnung und
Familie imWohnbereich. Diplomarbeit Psychol.Inst.Univ. Bern.
Csikszentmihalyi, Mihalyi & Rochberg-Halton, Eugene (1981):
The meaning of things: domestic symbols and the self. New York,
Cambridge Univ. Press. (Dt. Übersetzung von W. Häberle,
hrsg. von A. Lang: München, Psychologie-Verlags-Union,
1988.)
Dawkins, Richard (1976): The selfish gene. Oxford Univ. Press.
(Deutsch: Das egoistische Gen. Berlin: Springer, 1978).
Kant, Immanuel (1887): Kritik der reinen Vernunft. 2. Auflage.
Lang, Alfred (1981): Vom Nachteil und Nutzen der
Gestaltpsychologie für eine Theorie der psychischen Entwicklung.
S. 154-173 in: Foppa, K. & Groner, R. (Eds.): Kognitive
Strukturen und Prozesse. Bern, Huber.
Lang, Alfred (1985): Remarks and questions concerning ecological
boundaries in mentality and Language. Pp. 107-114 in: SEILER H.J.
& BRETTSCHNEIDER G. (Eds.): Language invariants and mental
operations. Tübingen, Narr.
Lang, Alfred (1988): Das Ökosystem Wohnen - Familie und
Wohnung. In: Lüscher, K. et al. (Eds.): Die "postmoderne"
Familie: familiale Strategien und Familienpolitik im Übergang.
Konstanz, Universitätsverlag.
Lang, Alfred (in prep.): The built as a regulator of autonomy and
integration: towards a theory of the dwelling activity. Invited by
Hiroshima Forum of Psychology.
Lang, Alfred; Bühlmann, Kilian & Oberli, Eric (1987):
Gemeinschaft und Vereinsamung im strukturierten Raum: psychologische
Architekturkritik am Beispiel Altersheim. Schweizerische Zeitschrift
für Psychologie 46 277-289.
Lewin, Kurt (1922): Der Begriff der Genese in Physik, Biologie und
Entwicklungsgeschichte. Berlin, Springer. Nachdruck in Band 2 der
Kurt-Lewin-Werkausgabe. Bern, Huber und Stuttgart, Klett-Cotta,
1981f.
Meyer-Abich, K.-M. (1984): Wege zum Frieden mit der Natur:
praktische Naturphilosophie für die Umweltpolitik. München,
Hanser.
Osofsky, Joy D. (Ed., 1987): Handbook of infant development. 2nd
ed. New York, Wiley.
Papert, Seymour (1980): Mindstorms. New York, Basic Books (Dt.
Basel, Birkhäuser,1982.
Sitter, Beat (1984): Plädoyer für das Naturrechtsdenken:
zur Anerkennung von Eigenrechten der Natur. Basel, Helbing &
Lichtenhahn.
Suarez, Antonio (1980) Connaissance et action: l'enjeu d'une
position épistémologique contemporaine. Revue Suisse de
Psychologie 39 177-199.
VOGT, Beatrice & LODER, Beatrice (1982): Jugendliche in ihrer
Wohnumwelt. Diplomarbeit Psychol.Inst.Univ. Bern.
Fussnoten
1.
Überarbeiteter Beitrag zur 8. Tagung Entwicklungspsychologie,
13.-16.8.1987 in Bern. Der Verfasser dankt August Flammer für
konstruktive Kritik.
2. Laupenstrasse 4,
CH-3012 BERN
3. Da wir gewohnt
sind Techniken immer nur utilitaristisch im Hinblick auf limitierte
Nahziele zu bewerten, mag dieser Gedanke, besonders für materie-
und energiebezogene Techniken, ungewohnt erscheinen; die
Berücksichtigung von Nebenwirkungen jeder Technik, besonders
aber die Wettbewerbssituation im psycho- und sozialtechnischen
Bereich, könnte uns anders belehren.
4. Natürlich ist
der Ausdruck "kopernikanisch" seinerseits problematisch, insofern er
nicht nur eine Wende, sondern fälschlicherweise auch die
Errungenschaft eines neuen Zentrums signalisieren könnte.
5. Im folgenden
gestatte ich mir eine teilweise Übernahme von Argumenten und
Textpassagen aus Lang 1988.
6. Diese Einsichten
sind mit zu vielen Namen verbunden, als dass sie hier angeführt
werden könnten. Ich verweise deshalb pauschal auf Informationen
in Osofsky (1987).
Inhalt
| Top
of Page