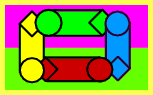Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 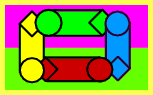 |
Edited Book Chapter 1981 |
Vom Nachteil und Nutzen der Gestaltpsychologie für eine Theorie der psychischen Entwicklung1 (Richard Meili zum 80. Geburtstag) | 1981.01 |
@DevPsy @EcoPersp @CuPsyBas @SciTheo |
47 KB + 1 pict Last revised 98.11.01 |
Pp. 154-173 in: Klaus Foppa & Rudolf Groner (Eds.) Kognitive Strukturen und ihre Entwicklung. Bern, Huber. | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Zusammenfassung / Abstract in English [Einleitung]
Gestalttheorie und Entwicklungspsychologie
Das Problem mit der guten Gestalt und dem Gleichgewicht Umstrukturierung entwicklungspsychologischen Denkens
Zwei Varianten ökologischer Psychologie
Kognitivistische Ökopsychologie Reale Ökopsychologie
Literatur
Zusammenfassung Anhand der früh einsetzenden entwicklungspsychologischen Orientierung der Gestaltheorie (Koffka, Lewin, Meili) und im Hinblick auf Entsprechungen in der Entwicklungstheorie Piagets wird gezeigt, dass ein 50 Homeostase oder auf Gleichgewichtszustände angelegtes System nicht als sich entwickelnd, sondern eher als stillstehend erklärt wird. Auch psychologische Entwicklung sollte deshalb nach dem Modell Darwins ökologisch, dh als aus der Interaktion von wenigstens zwei, voneinander partiell unabhängigen Systemen begriffen werden. Es werden dann zwei Varianten ökologischer Psychologie zur Diskussion gestellt. (a) Der nach der kognitiven Wende dominierende kognitivistische Ansatz im Geiste des Lewin'schen Lebensraumskonzepts kann gerade diesen Anspruch nicht erfüllen. (b) Eine "reale Ökopsychologie" im Anschluss an Lewins Öffung zur Ökologie darf sich nicht auf das Individuum und seine Umwelt eingrenzen, sondern muss auf die Welt bezugnehmen, aus der Individuen und Gruppen ihre je eigene und kulturelle Umwelt wahrnehmend und handelnd ausgliedern. Das psychologische Verständnis der nach vorne offenen Entwicklung von Menschen und ihren Umwelten muss daher so notwendig ökologisch angelegt sein wie eine reale ökologische Psychologie notwendig eine Entwicklungspsychologie sein muss. | Abstract A system regulated by homeostasis or balancing states cannot really develop but rather is bound to settle itself to rest. This is made evident by pointing to the early developmental orientiation of Gestalt theory (Koffka, Lewin, Meili) and comparable notions in the developmental theory of Piaget. Therefor, theories of psychological development should follow Darwin's model and be conceived in ecological perspective, i.e. on the basis of interaction between at least two systems that operate at least in part independently of but upon each other. Two variants of ecological developmental psychology are then discussed: (a) The cognitivistic approach which in following Lewin's post-perceptual and pre-behavioral concept of life space cannot in fact fulfill the above requirements though it presently dominates the scene. (b) A "real eco-psychology" following Lewin's opening towards psychological ecology should not restrict itself to the individual and its environment in the phenomenal sense but must refer to the larger world of which individuals and group gain their particular and cultural environment through perceiving and acting. A psychological underststanding of towards the future open development of humans together with their real environments is therefor necessarily to operate ecologically as well and as much as an ecological psychology must necessarily be a developmental psychology. |
|
Inhalt
«There are certain People who, as soon as some undeniable fact is written down, find it amusing to show why that 'fact' is false after all. I am such a person ...» (HOFSTADTER, 1978, S. 56)
Eine der bedenklichen Feststellungen, die man über den
heutigen Stand der psychologischen Erkenntnis machen muss, betrifft
das Fehlen einer erklärenden Theorie der psychischen
Entwicklung. Der Mensch und seine Kultur sind «Dinge in
Entwicklung»; eine Wissenschaft, die dieser Tatsache nur ad hoc
Rechnung trägt, kann auf die Dauer nicht ernst genommen
werden.
Wohl gibt es eine grosse Zahl von «Theorien» der
psychischen Ontogenese. Sie lassen sich so leicht auf zwei Grundtypen
-- mechanistisch-assoziationistische und organismisch-holistische --
zurückführen (REESE & OVERTON, 1970), dass der
kritische Betrachter vermutet, es handle sich eher um apriorische
Denkweisen als um sachbezogene Theorien. Auch eine nähere
Betrachtung der Methodik zeigt, dass wir eigentlich nicht in der Lage
sind, die systematischen Veränderungen des Wahrnehmens, Denkens,
Lernens, Fühlens, Handelns oder der Persönlichkeit im Laufe
ihres Lebens angemessen zu beschreiben, geschweige denn zu
erklären, d.h. zu verstehen, unter welchen Bedingungen es
(notwendig) dazu kommt.
Was die Beschreibung betrifft, haben wir uns durch die
Bevorzugung einer Messmethodik, welche entweder fast nur das
Konstante (Tests, vgl. LANG, 1977, S. 191) oder eigentlich nur die
Veränderung (Lernexperiment) sehen kann, weitgehend den Blick
auf Entwicklungsphänomene verstellt. Die Vorgehensweise von
PIAGET kombiniert in gewissem Sinne die beiden Verfahren, und man
muss anerkennen, dass hier Entwicklung erfasst wird; allerdings mit
ungeklärter Messgüte und mit dem Zwang zur Auffassung von
Entwicklung als Stufenfolge.
Was die Erklärung betrifft, verweisen wir auf nur
paradigmatisch aufgeklärte Prototypen wie Reifung oder
verschiedene Formen des Lernens, die wir per Analogieschluss zu
Ursachen der Entwicklung deklarieren. Im Fall der Reifung verzichten
wir mithin auf eine psychologische Erklärung, ohne freilich das
Verhältnis zwischen Psychologie und Biologie hinreichend
geklärt zu haben; im Fall des Lernens verwechseln wir
mögliche und wirkliche Erklärungen: denn ob die
postulierten Lernfaktoren wie unbedingter Reiz,
Bekräftigungsreiz oder Lernmodell usf. in der Wirklichkeit als
notwendige und ausreichende Lern- oder gar Entwicklungsbedingungen
vorkommen, lässt sich aus praktischen und ethischen Gründen
nicht untersuchen (vgl. dazu auch WOHLWILL, 1973). Es wird
häufig als Fortschritt betrachtet, dass wir heute nicht mehr
entweder Reifung oder Lernen, sondern deren kombinierte Wirkung als
Ursache der Entwicklung postulieren; man kann dies sicher nicht
für falsch ansehen; tatsächlich aber macht es derzeit die
meisten Erklärungsversuche nur obskurer.
Die Problematik der psychologischen Theorien der Ontogenese
scheint darin zu liegen, dass ihre Beschreibungsbegriffe und ihre
Erklärungsbegriffe ineinander verflochten sind: typische
Erklärungsbegriffe sind aus den Beschreibungen geforderte
Postulate. Sie haben also den Charakter von Interpretationen.
In der Biologie hingegen ist mit DARWIN der prinzipielle
Durchbruch zur Erklärung der Stammesgeschichte gelungen.
Die Prinzipien der Speicherung und Reduplikation der genetischen
Information, deren Mutationen und Rekombinationen sind in ihrer
Bedeutung für die Phylogenese verhältnismässig gut
bekannt. Und insbesondere lässt uns die Steuerung des
Artenwandels aus dem Verhältnis zwischen der genetischen, in
Organismen manifest gewordenen Information und den jeweiligen
Umweltbedingungen verstehen, wie es zu gerade dieser Evolution
gekommen ist -- zwar nicht voll und ganz, weil uns die entsprechenden
Daten ja nur unvollständig zugänglich sind, aber doch im
Prinzip und in vielen Einzelheiten. Und da es sich zur Hauptsache um
Kausalerklärung handelt, sind wir auch in der Lage, in
begrenztem Rahmen gezielt -- zum Guten und zum Schlechten -- in
solche Entwicklungen einzugreifen bzw. abzuschätzen, welche
technologischen Eingriffe zu welchen Effekten führen
dürften.
Nun ist zwar unvermeidlich, dass eine Theorie vorschreiben muss,
welche Sachbereiche als Explikate im Hinblick auf ein gegebenes
Explanandum angeschaut werden müssen; für diese Explikate
sind dann aber unabhängige Beschreibungsbegriffe
erforderlich.
So sagt die Evolutionstheorie im Hinblick auf die Selektion nicht
(mehr): schaue das Überleben der am besten Angepassten an;
sondem sie lenkt den Blick auf die Überlebensverteilung eines
Gensatzes und deren Ursachen. Bei näherer Betrachtung findet man
-- völlig unabhängig von jeder Evolutionstheorie --, dass
die Überlebensverteilung ungleichmässig ist: je enger die
Verwandtschaft, desto ähnlicher die Wahrscheinlichkeit des
Überlebens in bestimmten Biotopen. Die Ursachen der Phylogenese,
soweit durch Selektion vermittelt, liegen also im Gensatz und seinem
Verhältnis zu bestimmten Biotopen. Im Gegensatz dazu sagt z.B.
die operante Lerntheorie: suche nach Bekräftigungsreizen; sie
sind notwendige Bedingungen des Lernens. Und: Bekräftigungsreize
sind solche Reize, welche das Lernniveau verändern. Es ist
bisher nicht gelungen, eine von dieser Theorie unabhängige
Definition solcher Reize zu geben.
Die Lektüre evolutionstheoretischer Literatur legt den
Gedanken nahe, dass die Fortschritte in der Biologie ganz
entscheidend durch eine Verschiebung der Aufmerksamkeit weg von den
traditionellen auf neue Gegenstandskonzeptionen ausgelöst und
wohl auch erst ermöglicht worden sind. Beispielsweise zeigt MAYR
(1979, Kap. 3) die enorme Bedeutung des Übergangs vom
typologischen oder essentialistischen zum Populationsdenken; und
DAWKINS (1978) macht klar, wieviele Phänomene plötzlich
verständlich werden, wenn man den Blick vom individuellen
Organismus als Träger der Evolution weg auf das Genom wendet,
für welches der Organismus bloss eine
«Überlebensmaschine» darstellt.
Es war die Gestalttheorie, welche in der Geschichte der
Psychologie am nachdrücklichsten aufgezeigt hat, dass die
Güte der Erkenntnis vom Ansehen des richtigen Zusammenhanges
abhängt. Könnte sie auch bei der notwendigen
Umstrukturierung der Entwicklungspsychologie von Nutzen sein?
Inhalt
Gestalttheorie und
Entwicklungspsychologie
Eines der Gebiete, dem sich die Gestaltpsychologen nach dem ersten
Entwurf ihres Ansatzes anhand von Wahmehmungsproblemen zuwandten, war
die Entwicklungspsychologie. KOFFKA hat bereits 1921 eine
vielbeachtete, aber später ziemlich vergessene
Entwicklungspsychologie aus gestalttheoretischer Sicht geschrieben.
LEWIN ist über lange Jahre ein hervorragender
Entwicklungspsychologe gewesen, und seine Feldtheorie ist ihrem Wesen
nach eine Entwicklungstheorie (vgl. LEWIN, 1946; LANG, 1964, 1979)
obwohl dies in den Sekundärdarstellungen
verhältnismässig selten hervorgehoben und oft genug
völlig übersehen wird. In letzter Zeit beobachtet man eine
Art Renaissance der Gestalttheorie; doch kann man sich eines
zwiespältigen Eindrucks schwer erwehren. In angewandten
Bereichen von Schule und Klinik ist der Name «Gestalt» in
aller Mund, der Inhalt des Gedankens aber oft auf Trivialitäten
reduziert. In manchen Bereichen der Grundlagenforschung ist der
Gestaltgedanke unbekannt oder wird er ignoriert; in anderen Bereichen
begegnet man wieder häufiger einigen der klassischen Ideen,
nicht selten verkrüppelt oder in neuen terminologischen
Gewändern. Von einer gestalttheoretisch orientierten
Entwicklungspsychologie ist freilich heute kaum etwas zu sehen.
Das ist erstaunlich und bedenklich, weil eigentlich eine innere
Affinität des Entwicklungsgedankens zu den Grundideen der
Gestalttheorie kaum zu verkennen ist. METZGER nimmt in seiner
Psychologie (1954a) immer wieder und im Schlusskapitel
ausdrücklich auf die Entwicklung des Psychischen bezug; aber
sein unverkennbarer Einfluss in pädagogischen Kreisen ist doch
wohl überwiegend eher seiner Person als seiner Psychologie
zuzuschreiben. Bereits in den «Principles of Gestalt
Psychology» vermeidet der Pionier KOFFKA eine direkte
Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsproblem. Neben LEWIN und
seinen Schülern aus der Berliner und der Iowa-Zeit ist es vor
allem MEILI, der seit seiner Genfer Zeit beharrlich die Grundideen
der Gestalttheoretiker an Entwicklungsproblemen erprobt hat (vgl.
MEILI, 1972). Auf KOFFKA und LEWIN und natürlich ebenso auf
CLAPAREDE aufbauend und von PIAGET beeinflusst, hat er gezeigt, wie
fruchtbar eine Verbindung der Gestalttheorie mit genetischen
Überlegungen für eine allgemeine Psychologie der
Persönlichkeit sein könnte.
Zwar ist auch die Entwicklungspsychologie von PIAGET nicht ohne
gestalttheoretische Charakterzüge; dies wurde von PIAGET selber
verschiedentlich anerkannt, von andern Autoren gelegentlich etwas
nachdrücklicher hervorgehoben (z.B. MEILI, 1966). Aber die
Schlussfolgerung, dass heute eine gestaltpsychologische
Entwicklungstheorie nicht existiert, ist auch nach einer
detaillierten Analyse der Literatur, für welche hier der Platz
fehlt, nicht zu umgehen. Das hat meiner Meinung nach seine guten
Gründe. Ich will diese aufzuzeigen versuchen und zugleich
geltend machen, dass dennoch die Gestalttheorie ein Potential
enthält, einer wirklichen Entwicklungspsychologie näher zu
kommen.
Inhalt
Das Problem mit der
guten Gestalt und dem Gleichgewicht
Wie von verschiedenen Autoren gezeigt worden ist (z.B. METZGER,
1954b; PIAGET, 1954), macht die Gestalttheorie zwei Grundannahmen.
Deren Verknüpfung ist zwar nicht notwendig, sie sind aber doch
so stark aufeinander bezogen, dass sie nicht selten nur als Gemenge
gesehen werden. Die erste Annahme ist eine Strukturannahme:
sie postuliert die Ganzbestimmtheit oder Kontextbestimmtheit der
Teile jeder psychischen Gegebenheit - oder etwas allgemeiner: dass
wir nichts untersuchen sollen, ohne zuerst den relevanten
Zusammenhang geklärt und berücksichtigt zu haben, falls wir
dem Risiko entgehen wollen, wesentliche Eigenschaften zu verpassen.
Die zweite Annahme ist eine dynamische Annahme: sie postuliert
für alle solchen Strukturen die immanente Tendenz, gewisse
ausgezeichnete Zustände anzunehmen, nämlich unter den
herrschenden Umständen so weit möglich eine
«gute», «prägnante», «einfache»,
«ausgewogene», «sparsame» usf. Organisation
anzunähern. Diese beiden Grundannahmen sind kaum anders denkbar
als auf dem Hintergrund einer allgemeineren Annahme, welche
genetischer Natur ist: alles Psychische ist Resultat eines Aufbau-
und/oder Differenzierungsprozesses. Dieser letzte Punkt ist aber so
allgemein, dass ich im folgenden nicht weiter darauf eingehen
möchte (vgl. dazu auch LANG, 1964, S. 40ff., von dem ich hier
und im folgenden Einiges übernehme).
Die erste Annahme ist heute für weite Bereiche der
sogenannten Kognitiven Psychologie nahezu Allgemeingut geworden.
Zunächst geht es einfach um sachgerechte Beschreibung:
wenn man fordert, dass jeder psychische Sachverhalt unter Bezugnahme
auf einen übergeordneten Rahmen gesehen werden muss.
Gelegentlich wird gesagt, dies sei zu allgemein, um noch
nützlich zu sein. Wie man gleich sehen wird, stimme ich diesem
Einwand gar nicht zu. Ich halte den heuristischen Wert der
Strukturannahme für durchaus noch nicht ausgeschöpft.
Die zweite Annahme zielt zusätzlich auf ein universelles
Erklärungsprinzip ab. Die «Tendenz zur guten
Gestalt» ist eine umstrittene Forderung, beinahe ein
Glaubenssatz, an dem sich die Geister scheiden. Die Gestalttheorie
dürfte ihre Strittigkeit in erster Linie diesem Postulat zu
verdanken haben. In der Tat ist es ja bisher nicht gelungen, die
Zirkularität der Argumentation zu durchbrechen, die darin liegt,
dass die phänomenale Eigenschaft der «guten Gestalt»
durch andere Phänomenmerkmale wie «Nähe»,
«Gleichartigkeit» usf. erklärt werden soll; das eine
ist jeweils eine Tautologie des andern. Bei näherem Zusehen
enthält aber die dynamische Grundannahme zweiIdeen, die meiner Meinung nach nicht das gleiche Schicksal
verdienen.
Die erste Idee sagt einfach, dass die Strukturen nicht
beliebig sind, d.h. dass in jeder Familie von verwandten
Strukturen eine Teilmenge gegenüber dem Rest ausgezeichnet ist.
Ich behalte dafür den Namen «dynamische Grundannahme»
bei, weil Strukturen dann (dynamische) Systeme genannt werden, wenn
die Interdependenzen ihrer Teile nicht beliebig sind. Die zweite Idee
fordert darüberhinaus, welche Strukturen gegenüber
welchen andern eine grössere Realisierungschance haben,
nämlich «sparsame», «gleichgewichtige»,
«gute» usf. Während die erste Idee weiterhin
deskriptiven Charakter aufweist und als eine interessante Erweiterung
der Strukturannahme gelten kann, ist nur die zweite Idee ein Stein
des Anstosses. Sie ist es umso mehr, als sie mehrere verschiedene
Kriterien für die Auszeichnung bestimmter gegenüber allen
andern Strukturen postuliert: Ökonomieprinzip,
Gleichgewichtsprinzip (erster oder höherer Ordnung als
Fliessgleichgewicht), Prägnanzprinzip
2. Das Verhältnis dieser Prinzipien untereinander ist
meines Erachtens nie in befriedigender Weise geklärt worden;
vielleicht ist das gar nicht allgemein möglich, sondern nur an
konkreten Fällen.
All diesen allgemeinen Gestaltprinzipien ist aber eines gemeinsam:
nämlich dass sie Entwicklung zum Stillstand bringen.
Solche Prinzipien als Regulatoren der Systemtätigkeit zu fordern
heisst dasselbe wie ein Zielerreichungskriterium einzuführen.
Wann immer solche Kriterien erfüllt sind, bedeutet dies die
Unterbindung weiterer Systementwicklung.
So weit ich sehe, ergibt sich in Hinsicht ihrer regulativen
Wirkung kein fundamentaler Unterschied zwischen
Gleichgewichtsprinzipien und teleologischen Prinzipien. (In der Tat
ist nicht selten unklar, ob die Prägnanzidee eher den
Gleichgewichts- oder den zielspezifischen Prinzipien zuzurechnen ist,
etwa wenn gesagt wird, dass eine prägnante Organisation nicht
nur die einfachste, sondern auch die beste sei.) Ein System unter
Regulation von Gleichgewichts- oder Prägnanzprinzipien ist nach
Erfüllung der Kriterien genau wie ein teleologisches System nach
der Letztziel-Erreichung solange ein stillstehendes System, als es
nicht von aussen her aus dem Gleichgewicht geworfen, gestört,
oder mit weiteren Zielen versehen wird.
Ein gradueller Unterschied ist allenfalls darin zu sehen, dass
teleologische Regulatoren sich leichter hierarchisieren, d.h. als
eine Folge von Teilzielen verstehen lassen, was den
Entwicklungsphänomenen besser zu entsprechen scheint. Die
Notwendigkeit, dann aber eine Instanz annehmen zu müssen, welche
die jeweilige Zielhierarchie bestimmt, macht jedoch deutlich, dass
die Erklärungsbedürftigkeit dadurch nur verschoben, das
Entwicklungsproblem nicht gelöst wird.
In beiden Fällen hat die Entwicklung notwendig systemfremde
Ursachen: entweder Störungen des bestehenden Gleichgewichts oder
auferlegte Ziele, In beiden Fällen bleibt offen, warum sich das
System nicht einfach den Einflüssen entzieht, z.B. durch
Drosselung oder Verweigerung des Inputs. M.a.W. diese sogenannten
Entwicklungstheorien konstruieren ein heteronomes -- und das heisst
eben: nicht sich entwickelndes, sondern allenfalls von aussen her auf
Trab gehaltenes -- System. Was die Gestalttheorie auszog zu
erreichen: autonome Organisation zu beschreiben und zu erklären,
ist ausgeschlossen oder auf den Abschnitt bis zur
Kriteriums-Erreichung begrenzt. Es ist jetzt verständlich, dass
die Gestalttheorie für die Entwicklungspsychologie nicht
fruchtbar geworden sein kann.
Derselbe Einwand ist u.a. von PIAGET gegenüber einem freilich
allzu statisch aufgefassten Gestaltbegriff erhoben worden (z.B.
PIAGET, 1967). Ich denke allerdings, dass der Einwand auch für
das von PIAGET als Lösung vorgeschlagene
Äquilibrationsprinzip gilt (vgl. z.B. PIAGET, 1973, in dem
Gleichgewicht nicht als Zustand, sondern als Prozess aufgefasst
werden soll, durch den Äquilibration bloss immer nur
angenähert, aber nie erreicht wird. Das soll im folgenden
deutlich werden, ohne dass ich auf PIAGET im Einzelnen eingehen kann.
Dieser scheint sich bewusst zu sein, dass sein System Entwicklung
auch nicht vollständig erklären kann (vgl. PIAGET, 1975, S.
174ff.).
Inhalt
Umstrukturierung
entwicklungspsychologischen Denkens
Mir scheint, dass für die dringliche Förderung einer
psychologischen Entwicklungstheorie drei Wege offen stehen.
(1) Man kann auf teleologische Prinzipien zurückgreifen und
insbesondere eine Hierarchie von Zielen (Lebenszielen) derart
aufzustellen versuchen, dass immer dann ein übergeordnetes Ziel
seinen Einfluss auf das sich entwickelnde Individuum geltend macht,
wenn ein eben untergeordnetes Ziel gerade erreicht worden ist. Obwohl
dergleichen Ansätze, beispielsweise auf der Grundlage von
Handlungstheorien, derzeit Mode sind (z.B. OERTER, 1979), halte ich
sie für verfehlt.
Ich habe schon deutlich gemacht, dass Zielhierarchien als
Entwicklungsregulatoren das Erklärungsproblem nur verschieben,
nicht lösen. Gegen Entwicklungsbegriffe mit Zielimplikation sind
auch ethische Einwände vorzubringen, da sie sich vorzüglich
zur Gängelung des Menschen eignen: Entwicklung wird so zu einem
Transitivum und leicht zu einer Machtfrage. Auch muss sich so
verstandene Entwicklung, sei sie selbst- oder fremdbestimmt, an
vorläufigen, um nicht zu sagen: einseitigen, Zielen orientieren,
was mit erheblichen ontogenetischen und kulturgeschichtlichen
Konsequenzen verbunden ist, auf die ich hier nicht eingehen kann.
(2) Man kann nach Prinzipien suchen, die anstelle von Sparsamkeit
und Gleichgewicht die geforderten Regulationsfunktionen
übernehmen können, ohne aber mit ihrem Nachteil,
Entwicklung zu verhindern, behaftet zu sein. Dabei sei in Erinnerung
gerufen, dass es sich um Prinzipien handeln muss, welche nicht aus
dem zu erklärenden Phänomen selbst abgeleitet sein
dürfen.
Man hat sich früher sehr wohl vorstellen können, dass
das Prägnanzprinzip, als Heuristik verstanden, zur Entdeckung
von Regulatoren führt, die kausal begründen, warum etwa in
der Wahmehmung Kreise und Rechtecke, oft sogar gegen die Erfahrung,
bevorzugt werden. Ich habe lange Zeit gehofft, solche
unabhängigen Regulatoren finden zu können, bin aber heute
von der Unwahrscheinlichkeit eines Erfolgs überzeugt. Damit
meine ich, dass eine dritte Strategie unter den gegebenen
Umständen die sinnvollere sei.
(3) Man kann sich das Strukturprinzip der Gestalttheorie zu Herzen
nehmen und noch einmal überprüfen, in was für einen
Zusammenhang denn menschliche Entwicklung gestellt werden muss, damit
vermieden wird, irgendwelche ganzheitsbestimmten Merkmale zu
übersehen. Dann macht man die Entdeckung, dass die
Entwicklungspsychologie, allgemeinem Usus folgend, nur die
Figur und nicht auch den Grund ihres Objektbereichs in ihren
Blick genommen hat. Gegenstandsbereich einer Entwicklungstheorie
dürfte demnach nicht das Individuum allein, sondern nur das
sich entwickelnde Individuum in der sich entwickelnden Welt
sein.
Nun hat schon KOFFKA (1921) das Schlusskapitel seines
entwicklungspsychologischen Buches mit dem Titel «Das Kind in
seiner Welt» überschrieben und anhand vieler Beispiele aus
dem kindlichen Spiel und dem Leben von Naturvölkern zu zeigen
versucht, dass die Bedeutungen der Objekte der Weh von den
Auffassungsmöglichkeiten des Subjektes abhangen, und dass diese
sich ja in systematischer Weise im Lauf der Ontogenese wandeln. Das
mag man heute als triviale Einsicht bezeichnen; doch meine ich, dass
diese Erkenntnis noch immer nicht richtig ausgewertet ist, wie denn
ja auch die Umweltlehre von UEXKÜLLS (z.B. 1909 und später)
infolge mannigfacher Detailprobleme bisher nicht eigentlich rezipiert
worden ist.
KOFFKA hat später (1935) deutlich gemacht, dass die
Hauptaufgabe der Psychologie darin bestehe, die Organisation des
Umweltfeldes (behavioral environment) zu studieren und zu zeigen,
welche Einflüsse daraus auf das «Ich» als einen der
wichtigsten Feldteile wirken; er hätte beifügen sollen: und
welche Einflüsse vom «Ich» auf dieses Umweltfeld
wirken. Wie HILGARD, ATKINSON & ATKINSON (1979) schärfer als
er selbst formuliert haben, ist also KOFFKAS Definition der
Psychologie eine ganz andere als die übliche. Für ihn ist
die Psychologie die Wissenschaft von den Mensch-Umweh-Beziehungen,
soweit sie das Handeln oder molare Verhalten betreffen.
In ähnlicher Weise, freilich abstrakter und zugleich
rigoroser, hat LEWIN (vgl. z.B. 1936) sehr früh erkannt, dass
die Psychologie nur dann Fortschritte als Wissenschaft machen kann,
wenn es ihr gelingt, die Beschreibung des Individuums und die
Beschreibung seiner Welt in ein- und derselben Begriffssprache zu
vollziehen. Benützt man für die verschiedenen Bereiche oder
Aspekte seines Gegenstandes mehrere verschiedene, d.h. nach
unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien gebildete,
Begrifflichkeiten - z.B. physikalische Termini für die Welt,
physiologische Termini für den Organismus und seine Prozesse und
psychologische Termini für das Individuum und sein Handeln - so
wird man in einer solchen Wissenschaft nie über das Stadium von
korrelativen Zuordnungsregeln hinauskommen. M.a.W. man wird nie
eigentliche Gesetzesaussagen (LEWIN, 1927) machen und mithin auch
keine Erklärung der Entwicklung leisten können. LEWINS
Topologische und Vektorpsychologie ist ein Versuch gewesen, eine
solche übergreifende «Sprache» ausgehend vom
Psychologischen zu erarbeiten.
Unter der Kritik von BRUNSWIK (1943) hat LEWIN aber offenbar
erkannt, dass sein Weg genau wie der Vorschlag KOFFKAS nicht nur zu
leicht das Missverständnis nahelegt, dies sei eine
subjektivistische, ja introspektionistische Psychologie. Sondern er
hat auch eingesehen, dass er zu einer einseitigen und
eingeschränkten Psychologie führen muss.
Empirisch-operationale Zugänge zum Lebensraum sind nämlich
nicht nur fürchterlich schwierig, sondern vor allem kann man in
der Folge Wahrnehmung und Handeln, welche die Verbindung des
Lebensraumes mit der äusseren Welt des Individuums betreffen,
eigentlich nicht mehr studieren. Seine Reaktion war der fundamentale
Vorschlag zur Schaffung einer psychologischen Ökologie
(LEWIN, 1943; vgl. 1963 S. 98ff. und Kap. 8). Eine solche
Wissenschaft müsste die Welt so beschreiben, wie sie
entsprechend den Auffassungsmöglichkeiten des Menschen in einen
Lebensraum eingehen kann, also nicht nur in physikalischen Begriffen,
sondern auch insoweit sie uns als eine soziale und kulturelle Welt
erscheint. Dies im Unterschied zur ökologischen Psychologie, die
sich mit der Umwelt befasst, wie sie in den Lebensraum eines
Individuums eingegangen ist.
Leider hat LEWIN sein Programm nicht mehr durchfuhren können,
Und BARKER (vgl. 1968) hat in seiner «ökologischen
Psychologie» einen viel spezielleren Aspekt ausschliesslich
verfolgt. (Er hat Ausschnitte aus den sozio-kulturellen
Lebensräumen (postperzeptuell und praebehavioral) vieler
Individuen in einer Kleinstadt beschrieben, insoweit sie
Gemeinsamkeiten, nämlich behavior settings,
aufweisen.)
In den letzten Jahren hat sich der Gedanke, eine brauchbare
Psychologie, insbesondere eine Entwicklungspsychologie, müsse
«ökologisch» sein, sehr verbreitet (vgl. z.B.
GRAUMANN, 1978; BRONFENBRENNER, 1979; WALTER & OERTER, 1979).
Häufig wird dabei auf die Vorarbeiten LEWINS explizit
hingewiesen. Problematisch ist aber, dass die meisten dieser
Bemühungen LEWINS ökologische Wende nicht
berücksichtigen.
Denn der Einbezug der Umwelt in eine Beschreibung und
Erklärung psychischer Vorgänge kann auf zwei Weisen
durchgeführt werden. Man kann ein psychologisches
Konstrukt entsprechend dem Lewinschen Lebensraum erfinden, in welchem
die (psychologische) Person und die (psychologische!) Umwelt nach
ihrer perzeptiv-kognitiven Verarbeitung enthalten sind und das
Handeln und die Entwicklung des betreffenden Individuums bestimmen.
Man kann aber auch ein ökopsychologisches Konstrukt erfinden, in
welches die reale Person und die reale Umwelt dieser Person eingehen.
Ich behaupte, dass nur in dieser zweiten Variante einer
«ökologischen Psychologie» eine echte
Entwicklungstheorie möglich ist.
Inhalt
Zwei Varianten ökologischer
Psychologie
Kognitivistische Ökopsychologie
In ein Konstrukt von der Art des Lebensraumes gehen symbolische
Repräsentationen der Person und der Welt eine Verbindung ein,
die vorher durch die Filter der Perzeption und Kognition desselben
Individuums gegangen sind, dessen Handlungen und dessen Entwicklung
das Konstrukt erklären soll. Die moderne Psychologie, die mit
solchen Voraussetzungen arbeitet, heisst «Kognitive
Psychologie», weil sie sich ausschliesslich auf Kognitionen
ihres Explanandums bezieht bzw. auf Aussagen ihrer Subjekte abstellt,
beispielsweise mit Fragebogendaten arbeitet. Zur Unterscheidung von
einer allgemeinen Denkpsychologie nennt man sie besser
«kognitionistisch».
Nun führt aber ein solches Vorgehen notwendig zu
Zirkelschlüssen, weil ja das Handeln des Individuums auf der
Grundlage seiner eigenen Kognitionen, die nur auf dem Wege über
Handlungen desselben Individuums zugänglich sind, erklärt
werden soll. Es ist also nie auszuschliessen, dass das Handeln,
welches die Kognitionen aufschliesst, einfach eine weitere Komponente
des zu erklärenden Handelns darstellt. Zudem wird von der
Kognitiven Psychologie die fundamentale Annahme der Systemhaftigkeit
oder Ganzheitlichkeit desselben Individuums gemacht. Explanans und
Explanandum sind also untrennbar ineinander verwoben. Mit Recht nennt
JANICH (1979) in seiner Einteilung psychologischer Positionen diese
Vorgehensweise «relativistisch».
Auch wenn eine kognitivistische Psychologie ökologisch wird,
wie z.B. bei BRONFENBRENNER (1979), ist sie einerseits zwar
handlicher, aber anderseits nicht brauchbarer als die
ursprüngliche Konzeption von LEWIN. Für LEWIN war immerhin
nicht nur dasjenige Bestandteil des Lebensraums, was das Individuum
erlebt bzw. worüber es berichten kann, sondern ganz allgemein,
was sich auf sein Verhalten auswirkt. Dennoch sind beide Subvarianten
dieser ökologischen Perspektive nur
quasi-ökologisch, weil ihre Aussagen über die Umwelt
gar nicht echte Aussagen über die Umwelt sind, sondern
eigentlich eben über Bestandteile des Lebensraumes, also
über «Bestandteile» des Individuums selbst. In der
LEWINschen Variante ist der Zirkelschluss unvermeidlich, wenn aus
denselben Verhaltensbeschreibungen, die zu erklären sind, auch
die Konstruktion des Lebensraumes erfolgen muss. In der zugleich
älteren und moderneren kognitivistischen Variante treten
zusätzliche Filter dazwischen, insofern alle Aussagen des
Individuums erstens nur den bewusstseinsfähigen Teil des
Lebensraumes betreffen können und zweitens durch das Medium
einer dem Individuum und dem Beobachter nur teilweise gemeinsamen
Sprache gehen müssen.
Nun ist aber Entwicklung geregelter Wandel; und Wandel kann nur
auf dem Hintergrund von etwas Bleibendem festgestellt werden. In
einer postperzeptiven und präbehavioralen Psychologie fehlt ein
solcher Bezugsrahmen. Kognitivistische Entwicklungspsychologie,
gleichgültig ob ökologisch orientiert oder nicht, kann nur
noch vergleichende Psychologie sein: man kann den Wandel eines
Individuums beschreiben und mit demjenigen einer Bezugsgruppe in
denselben Variablen vergleichen; oder man kann die Entwicklung
bezüglich irgendwelcher Variablen mit einer Normalentwicklung
vergleichen und den Grad der Abweichung angeben; u.a.m. Man mag
solche Vergleiche für in mancher Hinsicht der Mühe wert
halten; aber zu einer Erklärung der Entwicklung können sie
nicht führen, solange nicht wenigstens zwei voneinander
unabhängige Gegebenheiten mit voneinander unabhängigen
Methoden, aber im Rahmen ein und desselben Begriffssystems erfasst
und miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Diese kritische Bewertung der kognitivistischen und der LEWINsehen
Lebensraum-Ökopsychologie sollte jedoch nicht davon ablenken,
dass ihr sowohl forschungsstrategisch wie pragmatisch die
grösste Bedeutung zukommt. Als Heuristik im Kontext des Findens
scheint mir eine solche Ökopsychologie unentbehrlich. Sie
scheint mir auch in kulturgeschichtlicher Perspektive
überfällig, wenn man von der Psychologie gültigere
Impulse für die Verbesserung des Zusammenlebens erwartet, als
sie bisher geben konnte (vgl. BRONFENBRENNER, 1979). Ich kann mir
auch nicht vorstellen, wie man anders praktische Aufgaben lösen
könnte; es sei denn, man hält die Gefahr für gering,
den andern Menschen wie ein beliebiges Objekt zu behandeln (vgl.
SUAREZ, 1980). Um stellvertretend für den Andern etwas zu tun,
ohne ihn in seiner Autonomie zu beschneiden, muss man gewissermassen
seine (d.h. des Andern) Stelle einzunehmen versuchen, also auf der
Grundlage seines (d.h. des Andern) Lebensraums agieren oder
anregen.
Ich stimme also sowohl JANICHS (1979) Ablehnung wie ECKENSBERGERS
(1979) Akzeptierung des relativistischen Ansatzes zu, freilich in je
verschiedenen Kontexten. Für unzureichend im Kontext der
Rechtfertigung halte ich ihn jedoch nicht nur, weil mir die kausale
Denkweise «lieb geworden ist» (ECKENSBERGER, 1979, S. 280);
sondern primär aus folgendem ethisch-politischem Grund: Man
vergisst gewöhnlich, wenn man propagiert, sein Forschungsobjekt
als ein handlungsfähiges «Subjekt» zu verstehen, dass
auch der Forscher seinerseits ein solches «Subjekt» ist;
und dass also seine gesamte «Rekonstruktion» des
Lebensraumes eines Andern nichts anderes als die eigenen (d.h. des
Forschers) Kognitionen sein kann. Man erschrickt sofort ob des
unendlichen Regresses an Forschem, die sich in diesem Ansatz
notwendig hinter jedem psychologischen Problem anreihen. Wenn JANICH
seine Bezeichnung «relativistisch» in dieser Perspektive
gewählt hat, dann ist sie in der Tat treffend; denn dieser
Relativismus ist eine «Bedrohung» (ECKENSBERGER, 1979)
nicht nur der Wissenschaft, sondern des Versuchs, mit Hilfe von
Wissenschaft das menschliche Zusammenleben zu bewältigen.
Wissenschaft wird so zu einer Farce, und das ist im psychosozialen
Bereich fatal, weil anders als in den klassischen Naturwissenschaften
kein gültiger ausserwissenschafilicher «Test» für
die Güte der Erkenntnis in Form einer daraus abgeleiteten und
funktionierenden Technologie zur Verfügung steht. Was das
Zusammenleben betrifft, so wirft uns eine kognitivistische
Ökopsychologie (wie vielleicht die kognitivistische Psychologie
überhaupt) zurück ins Zeitalter des Kampfes von Meinung
gegen Meinung.
Inhalt
Reale Ökopsychologie
Wenn Entwicklung erklärt und Eingreifen in Entwicklung
gerechtfertigt werden sollen, muss also eine ökologische
Psychologie anderer Art konstruiert werden. Es ist unumgänglich
anzuerkennen, dass entwicklungsbedingende Prozesse innerhalb der
übergeordneten Forschungseinheit
«Individuum-in-seiner-Umwelt» stattfinden. Die
Umwelt ist mehr als Rahmenbedingung der Entwicklung des Individuums.
Wirkungen gehen ebensosehr vom Individuum in die Welt wie von der
Welt auf das Individuum. Man muss also gleichberechtigt mit dem
Individuum die Entwicklung seiner Umwelt (auf dem Hintergrund der
restlichen Welt) thematisieren. Da die beiden Entwicklungen
ineinander verwoben sind, einander gegenseitig bedingen, müssen
sie gemeinsam in einem übergeordneten Bezugsrahmen gesehen
werden. Man darf, wie ECKENSBERGER sehr klar gesagt hat,
«möglichst nie das eine ohne das andere 'denken' und auch
nicht mehr versuchen, den Organismus einerseits und die Umwelt
andererseits als zwei getrennte Gegebenheiten aufzufassen, die man
erst in einem zweiten Schritt aufeinander bezieht»
(ECKENSBERGER, 1978, S. 54). (Der Satz erinnert lebhaft an die
Auseinandersetzung der Gestaltpsychologen mit den
Neo-Assoziationstheoretikern der Würzburger und der Grazer
Schule!)
Zwei Folgen dieser Auffassung sind zunächst
herauszustellen:
(1) Obwohl tatsächlich erstaunlich viele psychologische
Untersuchungen nachträglich wenigstens teilweise
real-ökologisch interpretiert werden können, handelt es
sich um eine fundamentale Umorientierung. Man versteht gut,
dass die grosse Mehrzahl der Psychologen den ökologischen Ansatz
nicht begreifen kann oder angesichts der Tragweite der Konsequenzen
zu tabuisieren versucht (vgl. KAMINSKI, 1976).
(2) Der real-ökologische Ansatz entgeht der
Perspektivität der Erkenntnis auch nicht. Das kann ich am
besten zunächst mit Hilfe der Analogie der Gestaltwahrnehmung
verdeutlichen:
Beschreibung und Erklärung der Entwicklung setzen voraus,
dass die reale Person zusammen mit ihrer realen Umwelt und allem
Übrigen, was für die Entwicklung relevant werden kann, in
ein gemeinsames Begriffssystem eingebracht werden. Gleichwertig wie
die beiden Teile einer Kippfigur müssten die Person und ihre
Umwelt auf dem gemeinsamen Grund der restlichen Welt im
perzeptiv-kognitiven System des Forschers ein wechselweises
Beeinflussungsverhältnis eingehen. Allerdings ist eine
dynamische Kippfigur zu evozieren (von der Art wie sie M.C. ESCHER
gezeichnet hat, vgl. Bild und HOFSTADTER 1979); denn im Verlauf der
Zeit müsste schrittweise eine allmähliche Veränderung
beider, der Person wie ihrer Umwelt, thematisiert werden können,
die der realen Veränderung sowohl der Person wie der Welt, in
der sie lebt, entspricht.
Bild Escher «Liberation», Lithographie (1955) von M.C. ESCHER. Das Bild veranschaulicht die Idee der dynamischen Kippfigur. wenn man sich eine Zeitachse von unten nach oben oder von oben nach unten gehend vorstellt. Neben den austauschbaren «Figur» und «Grund» sieht man auf dem Blatt auch die «restliche Welt» und, angedeutet durch die Bildrolle, den «Blickwinkel des Forschers». Reproduktion mit freundlicher Erlaubnis des Verlags . Escher-Hejrs 1980 c/o Beeldrecht Amsterdam. (In der gedruckten Fassung ist die das Bild leider durch Beschneidung oben und unten seines Sinnes beraubt worden. AL).
Erweitert man das perzeptiv-kognitive System des Forschers mit
einer überindividuell vereinbarten Methodologie, so kann die
Beschreibung aber durchaus die Unverbindlichkeit persönlicher
Perzeption übersteigen. Das Bild macht jedoch klar, dass der
Gegenstand vom Blickwinkel des Forschers zum Objekt abhängt; die
Methode konstitutiert die Forschungseinheit. Wie BRONFENBRENNER
(1979) gezeigt hat, sind bezüglich der Mensch-Umwelt-Beziehung
Einheiten verschiedener Grössenordnungen zu
berücksichtigen. Gewiss übersteigt die Beschäftigung
mit menschlicher Entwicklung in ihrer Gesamtheit unsere
Möglichkeiten. Man sollte sich aber endlich klar darüber
werden, dass eine Lösung der Gegenstandskrise der Psychologie
nicht vom Gegenstand, sondern nur von der Methode her zu erwarten
ist. Das wird im real-ökologischen Ansatz deutlicher als
anderswo.
Statt des Bildes ist es aber wohl besser, durch ein
Beispiel zu verdeutlichen, wie eine real-ökologische
Entwicklungspsychologie aussehen kann. Unser Wissen über die
Entwicklung der sozialen Beziehungen des Säuglings und
Kleinkindes ist in einer radikalen Änderung begriffen. Noch
herrschen in den Lehrbüchern Ansätze vor, die eine
reifungsbedingte Bedürfnisentwicklung des Kindes postulieren,
welcher die Erfahrungswirkungen einer Serie von für sich
begriffenen Sozialisationsakten mehr oder weniger tiefgreifende
Formungen oder Verformungen auferlegen sollen. Seit einigen Jahren
hat man jedoch begonnen, das gemeinsame Verhalten von Mutter und Kind
in zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher Hinsicht als ganzes
zu analysieren (vgl. z.B. den schönen Sammelband von SCHAFFER,
1977). Es zeigt sich ein hochdifferenziertes Koordinationsmuster von
«Interaktionen», d.h. Folgen von auf beide Partner (und oft
mit Einbezug weiterer Umweltgegebenheiten) verteilten Akten, deren
Wahrnehmung und daraufhin passenden Reaktionen. Beispielsweise setzt
die Mutter ohne dies zu wissen bevorzugt genau dann Sprech- oder
Vokalisationspausen, wenn der kleine Säugling Mundbewegungen mit
oder ohne Lautäusserungen macht. In unseren Videoaufnahmen von
4-monatigen Kindern, denen ein starres Gesicht gezeigt wird, gibt es
viele Szenen, in denen das Kind vokalisiert oder lächelt und
dann offensichtlich eine Antwort erwartet, die es allerdings nicht
erhält.
Alle diese Verhaltensweisen sind nur verstehbar als Bestandteile
der Zeitstruktur eines «Dialogs». Zudem ist es weder
sinnvoll zu sagen, die Mutter kontrolliere das Verhalten des Kindes,
noch, das Kind steuere die Mutter, ausser man greift isolierend einen
Teil des Geschehens heraus. Derzeit steht im Vordergrund
überhaupt die Erfassung solcher Interaktionen; über ihre
Bedeutung für die Entwicklung können vorerst nur Hypothesen
formuliert, noch keine sicheren Belege vorgelegt werden.
Die Umwelt in ihrer sozialen Form als Interaktionspartner ist
zweifellos das dankbarste Feld für ein ökologisches
Vorgehen; ferner ist beim vorsprachlichen Kind wie beim Tier die
Verlockung zum kognitivistischen Ansatz geringer. Dennoch sollte man
sich hüten, nur soziale Prozesse in dieser
entwicklungsfördernden Funktion zu sehen; die Rolle der
Objektwelt für den Aufbau kognitiver Strukturen ist ja von
PIAGET eindrücklich dargestellt worden. Gerade hier wird aber
deutlich, dass viel zu sehr nur die Anpassung des erkennenden
Subjekts an die Welt und nicht auch die Herstellung der Welt
durch das handelnde Subjekt thematisiert worden ist. Denn
«Entwicklung» ist ja nicht einfach nur gerichtete, sondern
überhaupt geordnete Veränderung, und das bedeutet nicht
notwendig Anpassung, sondern zunächst einfach Stabilisierung in
einem allgemeineren Sinn. Wiedererkennen von früher Begegnetem
oder wiederholtes Herstellen desselben Produkts, d.h. die Nutzung
von Gedächtnis, ist also ebenso Anzeichen von Entwicklung
wie der Erwerb von Neuem.
Für mich ist deshalb die im Gang befindliche Umstrukturierung
der Gedächtnispsychologie von grösster Bedeutung (vgl. etwa
LEWIS, 1979), wobei die Idee, Gedächtnis sei das Insgesamt des
extra Gelernten, durch die Idee ersetzt wird, alle Begegnung mit der
Umwelt werde gespeichert, sofern die Möglichkeit bestehe, das
Neue an das schon Gespeicherte anzubinden. Entscheidend für
jeden Entwicklungsschritt ist sicher eine Diskrepanz zwischen
den schon bestehenden kognitiven Strukturen und den Eigenschaften der
gerade begegneten Umwelt; soweit stimme ich mit PIAGET oder KAGAN
(vgl. R. KAUFMANN, in diesem Band) überein. Aber anders als in
der Assimilations-Akkommodationstheorie vermute ich, dass nicht ein
hypothetisch postulierter psychischer Prozess darauf abzielt, die
Diskrepanz durch Entstellung der Wahrnehmung oder durch Anpassung des
Schemas zu vermindern, wodurch ein Entwicklungsschritt vollzogen
wäre. Sondern was immer das Individuum an Neuem begegnet und in
seiner kognitiven Struktur «festhaIten» kann,
«ist» seine Entwicklung.
Für den Entwicklungstheoretiker ist daher entscheidend, dass
er die bisherige kognitive Struktur und die Grundlage der aktuellen
Wahrnehmung miteinander in Beziehung setzen kann. Dabei entsteht das
methodische Problem, dass die kognitive Struktur und der aktuelle
Prozess unabhängig voneinander, wohl aber in derselben
«Sprache» erfasst werden müssen. Ich kann mir eine
Entwicklungsphysiologie vorstellen, bei der diese Inbeziehungsetzung
in Form von Gedächtnisspuren und Wahrnehmungsprozessen vollzogen
wird; natürlich ist dies mehr als utopisch. Es bleibt also nur
der Rückgriff auf die reale Umwelt als Grundlage der je
aktuellen Wahrnehmung, die zusammen mit dem Verhalten des
Wahrmehmenden aber unabhängig davon ins Begriffsystem des
psychologischen Forschers abgebildet wird.
Entwicklung wäre dann als eine Folge von Transaktionen
im System Mensch-Umwelt- Welt zu verstehen, soweit es der
Forscher begreifen kann.
Eine psychologische Ökologie müsste zuerst
geschaffen werden, welche die Beschreibung der Welt und der Umwelt
eines gegebenen Individuums erlaubte. Für jeden
Entwicklungsschritt müsste angegeben werden, welche Aspekte der
Welt vom Individuum wahrgenommen werden können, also was aus der
Welt seine Umwelt werden kann. Wenn ich an die dynamische Kippfigur
zurückerinnere, wäre jetzt die Umwelt figurhaft. Die
psychologische Ökologie müsste nicht nur Beschreibungen,
sondern auch Vorhersagen darüber geben können, wie die
Umwelt der Person X zur Zeit t wahrscheinlich aussehen
wird.
Dann folgt eine Wahrnehmung und damit der psychologische Teil des
Entwicklungsschrittes: eine ökologische Psychologie müsste
darüber aussagen, wie sich die nun psychologische Umwelt im
gegebenen Bezugssystem der Person in welche Handlung auswirkt; jetzt
wäre die Person die «Figur".
Das Handeln wirkt sich auf die Umwelt und mithin auf die Welt aus,
was wiederum von der psychologischen Ökologie beschrieben
werden müsste; jetzt wäre wieder die Umwelt Figur.
Inzwischen hätte aber auch zwischen Welt und Umwelt ein kleiner
«Austausch» stattgefunden, abhängig nicht nur von den
Wirkungen des Handelns, sondern auch von den Ereignissen in der Welt
selbst. In der Welt wie im Individuum bliebe eine gewisse
Veränderung übrig, die wir als Entwicklung begreifen.
Daraufhin könnte der nächste Entwicklungsschritt und seine
Analyse beginnen.
Zusammenfassend sei folgendes festgehalten: So wenig wie man sagen
kann, die Evolution der Arten beruhe auf den Genen oder dem Milieu,
so aussichtslos sind Theorieansätze in der Psychologie, seien
sie nicht-ökologisch wie die alten Entfaltungstheorien und
Lerntheorien oder quasi-ökologisch wie die neueren
kognitivistischen Handlungstheorien, welche nur die eine Hälfte
der Mensch-Umwelt-Einheiten anschauen.
Die Gestaltpsychologie bringt nicht zureichende Voraussetzungen
zur Erklärung der psychischen Entwicklung; aber sie macht darauf
aufmerksam, dass wir dazu ein System benötigen, welches
wenigstens vier voneinander unabhängig bestimmte Teile
zueinander in Beziehung setzt: den Forscher, die Welt, die Person und
deren Umwelt.
Inhalt
Fussnoten
1 Die vorliegenden
Überlegungen entwickelten sich im Kontext des Projektes
«Die Regulation der Reizaufnahme beim Säugling», mit
Unterstützung des Schweiz. Nationalfonds, Projekt Nr. I .36
1-0.76. Der Verfasser dankt AUGUST FLAMMER, KLAUS FOPPA, LISBETH
HURNI und RUTH KAUFMANN für die hilfreiche Kritik einer
früheren Version des Textes. <<<
2 Im Unterschied zum
gestalttheoretischen Isomorphieprinzip, das jeder Erklärung als
Axiom vorausgeht, wäre auch das «Isomorphieprinzip»,
wie es OERTER (1979) als Erklärungsprinzip neu zu formulieren
versucht hat, hier einzureihen. Damit soll die Richtung des durch
Handeln bewirkten Strukturausgleichs zwischen der «objektiven
Struktur (der natürlichen, Wirtschafts- und Kulturwelt) und der
«subjektiven Struktur (der kognitiven und Handlungsstruktur
jedes Individuums) erklärt werden. <<<
Inhalt
Literatur
BARKER. R.: Ecological psycho/ogy. Stanford Ca: Stanford
University Press. 1968.
BRONFENBRENNER, U.: The experimental ecology of human
develophmnt. Boston:Harvard University Press, 1979.
BRUNSWIK. E.:Organismic achievement and environmental
probability. Psychological Review 1943. 50, 255-272.
DAWKINS. R.: Das egoistische Gen. Berlin: Springer,
1978.
ECKENSBERGER. L.H.: Die Grenzen des ökologischen Ansatzes in
der Psychologie. In: C.F. GRAUMANN (Hrsg.). Okologische
Perspektiven in der Psychologie. Bern, Huber. 1978. 49-76.
ECKENSBERGER. L.H.: Die ökologische Perspektive in der
Entwicklungspsychologie: Herausforderung oder Bedrohung? In: H.
WALTER & R. OERTER (Hrsg.), Ökologie und Entwicklung.
Donauwörth: Auer, 1979, 264-281.
GRAUMANN, C.F. (Hrsg.): Oekologische Perspektiven in der
Psychologie. Bern: Huber, 1978.
HILGARD, E.R.. ATKINSON, R.L. & ATKINSON, R.C.:
Introduction to psychology. New York: Harcourt. 7. Aufl.
1979.
HOFSTADTER. D.R.: Goedel, Escher, Bach -- an eternal golden
braid. New York: Basic Books, 1979.
JANICH, P.: Umweltdeterminiertheit oder Konstruktion der
Wirklichkeit. In: H.WALTER & R. OERTER (Hrsg.), Ökologie
und Entwicklung. Donauwörth: Auer 1979, 92-101.
KAMINSKI. G.: Umweltpsychologie. Stuttgart: Klett,
1976.
KAUFMANN, R.: Das Lächeln des Säuglings als Ausdruck
früher Kategorisierungsprozesse. (In diesem Band, S. 35-49).
KOFFKA. K.: Die Grundlagen der psychischen Entwicklung.
Osterwieck i.H.: Zickfeldt, 1921.
KOFFKA, K.: Principles of Gestalt psychology. London:
Routledge & Kegan Paul, 1935.
LANG, A.: Über zwei Teilsysteme der
Persönlichkeit. Beiträge zur genetischen
Charakterologie Nr. 5. Bern: Huber, 1964.
LANG, A.: Psychodiagnostik als ethisches Dilemma. In: TRIEBE &
ULICH (Hrsg.), Beiträge zur Eignungsdiagnostik. Bern:
Huber, 1977. 190-202.
LANG. A.: Die Feldtheorie von Kurt Lewin. In: HEIGL-EVERS (Hrsg.),
Die Psychologie des 20. Jahrhunderts, Band VIII. Zürich:
Kindler. 1979. 51-57
LEWIN, K.: Gesetz und Experiment, in der Psychologie.
Symposium 1927, 1, 375-421. Nachdruck: Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967.
LEWIN, K.: Principles of topological psychology. New York:
McGRAW-HILL, 1936. Deutsch: Grundzüge der topologischen
Psychologie. Bern: Huber, 1969.
LEWIN. K.: Behavior and development as a function of the total
Situation. In: CARMICHAEL (Ed.), Manual of child psychology.
New York: Wiley, 1946, 791-844. Deutsch in LEWIN (1963) 271-329.
LEWIN, K.: Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Bern:
Huber, 1963.
LEWIS, D.J.: Psychobiology of active and inactive memory.
Psychological Bulletin, 1979,86, 1054-1083.
MAYR, E.: Evolution und die Vielfalt des Lebens. Berlin:
Springer, 1979.
MEILI, R.: Gestaltprozess und psychische Organisation.
Schweizerische Zeitschrift für Psychologie, 1954, 13, 54-7
1.
MEILI, R.: Gestaltpsychologische Bemerkungen zu einigen Ideen von
JEAN PIAGET. Schweizerische Zeitschrift für Psychologie,
1966, 25, 197-2 14.
MEILI, R., RICHARD MEILI: In: PONGRATZ (Hrsg.), Psychologie in
Selbstdarstellungen. Bern: Huber, 1972, 159-191.
METZGER, W.: Psychologie. Darmstadt: Steinkopff, 2. Aufl.,
1954(a).
METZGER. W.: Grundbegriffe der Gestaltpsvchologie.
Schweizerische Zeitschrift für Psychologie, 1954, 12. 3-l
5(b). . - . .
OERTER, R.: Ein ökologisches Modell kognitiver Sozialisation.
In: H. WALTER & R. OERTER (Hrsg.), Ökologie und
Entwicklung. Donauwörth: Auer, 1979, 57-70.
PIAGET, J.: Ce qui subsiste de la théorie de la Gestalt
dans la psychologie contemporaine de l'intelligence et de la
perception. Revue Suisse de psychologie, 1954, 13, 72-83.
PIAGET, J.: Biologie et conaissance. Paris: Gallimard,
1967. Deutsch: Biologie und Erkenntnis. Frankfurt a.M.:
Fischer, 1974.
PIAGET, J.: L'equilibration des structures cognitives.
Paris: PUF, 1975. Deutsch: Die Äquilibration der kognitiven
Strukturen. Stuttgart: Klett. 1976.
REESE, H.W. & OVERTON, W.F.: Models of development and
theories of development. In: GOULET & BALTES (Eds.) Live-span
developmental psychology. New York: Academic Press. 1970,
115-145.
SCARR-SALAPATEK, S.: An evolutionary perspective on infant
intelligence: species
Patterns and individual variations. In: LEWIS (Ed.) The origins
of intelligence. New York: Plenum, 1976, 165-197.
SCHAFFER, H.R.: (Ed.). Studies in mother-infant
interaction. London: Academic Press, 1977.
SUAREZ, A.: Conaissance et action: l'enjeu d'une position
épistémologique contemporaine. Revue Suisse de
psychologie. 1980, 39, 177-199.
VON UEXKÜLL, J.: Umwelt und Innenwelt der Tiere.
Berlin: Springer, 1909.
WALTER, H. & OERTER, R. (Hrsg.): Okologie und Entwicklung:
Mensch-Umwelt-Modelle in entwicklungspsychologischer Sicht.
Donauwörth: Auer, 1979.
WOHLWILL, J.F.: The study of behavioral development. New
York: Academic Press, 1973. Deutsch: Strategien
entwicklungspsychologischer Forschung. Stuttgart. Klett-Cotta.
1977.
Inhalt | Top
of Page