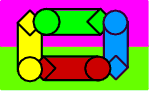Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 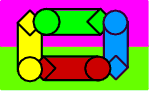 |
Journal Article 1993 |
Warum wohnen wir eigentlich? Zur Psychologie von Bauen und Wohnen | 1993.06 |
@DwellTheo @Method |
31 /40 KB Last revised 98.11.02 |
Alfred Lang & Hubert Studer Psychoscope Bd. 14 Nr. 9 vom November 1993, Pp.13-16. English abstract added. | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Einführende Gedanken zur
Wohnpsychologie von Alfred Lang, unter Mitarbeit von Hubert Studer,
vom Institut für Psychologie der Universität Bern. Obwohl
wir, den Schlaf abgerechnet, wohl ein Drittel unseres Lebens
"wohnen", kann nicht nur niemand genau sagen, was denn diese
Tätigkeit nun eigentlich ist. Man hat sich auch bis vor kurzem
mit ökonomischen, funktional-technischen oder ästhetischen
Erklärungen zufrieden gegeben. Aber eigentlich ist die
Psychologie wie keine andere Wissenschaft gefragt, dieses seltsame
Geschehen dem Verständnis zu erschliessen. Warum wohnen wir
eigentlich in Familien oder Gruppen? Und warum wohnen immer mehr
Leute allein?
Inhalt
1.
Was ist eine Wohnung?
Die Wohnung, das Wohnhaus behandeln wir gewöhnlich als einen
Gegenstand. Sie ist durch Wände, Boden und Decke und
allerlei Einrichtungen konstituiert und allerdings, wenigstens
indirekt, an ein Stück Boden gebunden. Aber Menschen stellen sie
her, handeln mit ihr und nutzen sie: wie andere Güter auch.
Demgegenüber behaupten allerdings einige, sie sei ein besonderes
Gut. Im heutigen Rechtswesen findet das gemischten Ausdruck: von ein
paar Ausnahmen abgesehen (z.B. Schutz der Privatsphäre,
Mietrecht) gilt sie aber schon wie irgend eine Ware.
Plausibel sagen wir auch, die Wohnung sei ein in bestimmter Weise
strukturierter Raum: ein Stück Raum, aus dem übrigen
Raum herausgetrennt, durch mehr oder weniger klar definierte
Abgrenzungen, und dann seinerseits innerhalb räumlich gegliedert
und inhaltlich angereichert, nicht nur durch Zimmerwände mit
Türen, sondern auch durch die Ausstattung und Möblierung.
Aber da kommen noch mehr Schwierigkeiten: wir alle wissen
selbstverständlich, was eine Wohnung ist. Aber lässt sie
sich klar und eindeutig definieren? Ich glaube nicht, wenn man nicht
auf die willkürlichen Setzungen positiven Rechts
zurückfallen will.
Zum Beispiel muss man die Wohnung als ein Gegenstück zum Raum
um sie herum verstehen: keine Wohnung ohne eine Wohnumgebung; eine
andere Wohnung je nach ihrer Nachbarschaft. Und was ihre Teile und
Einrichtungen ausmacht, so sind diese nicht allgemein
aufzählbar. Wir sagen: Zimmer zum Schlafen, zum Wohnen (!), zum
Essen, zum Aufbewahren und Vorbereiten von Nahrung sowie für die
Hygiene sind angeblich wesentlich, und es braucht offenbar Betten,
Tische, Stühle, Schränke, Bilder an der Wand und
Vorhänge an den Fenstern und viel anderes mehr.
Aber da ist noch einmal viel mehr, und das meiste davon nur
bedingt oder überhaupt nicht unbedingt nötig. Das merkt man
beim Zügeln. Und wirft doch nur wenig weg. Und wenn einem
eingebrochen wird und alles durcheinander gebracht, so sagt man, man
sei "im innersten getroffen". Und ist es. Selbst wenn gar nichts
gestohlen worden ist.
Und schauen wir in das Wohnen anderer Kulturen oder in das Wohnen
früheren Zeiten in unserer Kultur. Da kann alles ganz anders
sein und doch wieder so eigenartig ähnlich. Die Nomaden
schleppen ihre Wohnung mit Nötigem und Unnötigem gleich
immer mit. Kasernierte Menschen oder Hotelabsteiger suchen wenigstens
mit mitgebrachten Ersatzstücken etwas wie ihre eigene Wohnung zu
simulieren. Wahrscheinlich gilt die allgemeine Aussage: alle Menschen
bauen so etwas wie Wohnungen; und dann wohnen sie.
Behausungen bauen auch manche Tierarten, von den Ameisen über
Krebse und Vögel bis zu den Höhlen von Dachsen und
Füchsen. Unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen,
bauen sich wenigstens ein Bett für jede Nacht. Während das
Bauen der Tiere stark instinktgeprägt ist, also auf angeborenen
Verhaltensmustern beruht, halten wir das Bauen der Menschen für
kulturell bedingt. Das belegen die enormen Unterschiede der Bauweisen
zwischen den Kulturen und den Zeiten.
Können wir Menschen demnach also beliebig bauen, wie wir eben
Lust haben und wie es die Strömungen (um nicht zu sagen: die
Moden) der Architektur uns nahelegen? Sind die Behausungen der vielen
Menschen in den Städten, die seit dem 19. Jh. gebaut werden,
rein rational entworfene und funktionale Gebilde in unserem Belieben?
Instrumentelle Produkte, entwickelt und optimalisiert wie andere
Produkte unseres Fleisses, und dazu bestimmt, unsere Bedürfnisse
nach Schutz vor Witterung und anderen Menschen, unsere
Bedürfnisse nach Alleinsein und Zusammensein, unsere
Bedürfnisse nach Schönheit und nach Prestige, nach
Auftrumpfen und nach Selbstverwirklichung und einige andere Zwecke
mehr zu erfüllen? (vgl. Flade 1987).
Wäre also die Antwort auf die Frage, warum wir denn
eigentlich wohnen, dass wir Wohnungen brauchen, um damit
Grundbedürfnisse zu befriedigen? Da wir diese
Bedürfnisse eigentlich nicht kennen, sondern eben gerade aus
unseren Wohngebräuchen erschliessen -- also die Erklärung
aus dem zu Erklärenden -- , würde uns diese
Schein-Erklärung aufforderen: Konsumieren wir Wohnungen und
Möbel und Wohnungskunst, wie es uns die Werbung der
Häuserbauer, der Finanzinstitute und der Einrichtungshäuser
glauben machen! Ist Bauen wirklich das Herstellen und Wohnen das
Nutzen dieser Einrichtungen zum Zweck der Erfüllung beliebiger
Bedürfnisse?
Inhalt
2.
Was ist denn Wohnen?
Ich denke, wir sollten aufmerken, wenn so plausible und dann doch
nicht stimmige Auffassungen vertreten werden. Was mir weiter
auffällt: während uns zum Reden über die Wohnung,
dieses nutzbare Etwas, verhältnismässig viele und
brauchbare Wörter verfügbar sind, lässt uns die
Sprache weitgehend im Stich, wenn es um das geht, was in diesen
Wohnung geschieht: das "Wohnen". Es scheint, dass jede und
jeder eine eigene Vorstellung mit diesem Begriff verbindet. Raum wird
offenbar dadurch zur Wohnung, dass man darin wohnt.
Reden wir also über das Wohnen. Man muss es tun und sollte
doch wohl nicht allzu viel erwarten davon. Bittet man Leute zu
beschreiben, wie sie wohnen, so bringt man sie in der Regel in
Verlegenheit. Sie verlieren sich rasch in Allgemeinplätzen und
sagen dann: aber das ist doch völlig klar, und überhaupt
nicht interessant, und das kennt man ja. Oder sie stutzen und sagen
vielleicht nach einigem Überlegen, das gehe eigentlich niemanden
etwas an.
Nur ganz selten beschreiben Schriftsteller oder zeigen Filme das
Wohnen (man verwechsle das jetzt nicht mit der Wohnung und der
Einrichtung!). Sie implizieren es vielmehr. Das Wohngeschehen ist
eben oft "bloss" der Hintergrund zu dem, was sie uns aus dem sozialen
und psychischen Leben der Menschen darstellen wollen. Aber wehe, wenn
die Wohnung nicht zur Seele passt oder der Umgang mit ihr nicht
stimmt! Oder andersherum gesagt: im Theater und Film ist die
Ausstattung eine Hauptrolle. Aus der Wahrnehmungspsychologie wissen
wir freilich, dass wir der Figur ausgeliefert sind; dass der Grund
nicht bis ins Erleben dringt aber natürlich die Wahrnehmung der
Figur entscheidend mitbestimmt.
So denke ich dezidiert: es reicht nicht, über das Wohnen zu
reden. Natürlich muss man es tun, in intensiven und extensiven
Gesprächen; und mittels Fragebogen und anderen verbalen
Verfahren lassen sich wichtige Informationen gewinnen. Aber ohne
Beobachtung des Geschehens und ohne Aufnahme und Analyse von weiteren
Daten, die das transaktionale Geschehen zwischen den Wohnenden und
der Wohnung dokumentieren, lassen sich keine brauchbaren Einsichten
gewinnen.
Die Psychologen haben das Wohnen erst vor wenigen Jahren zum Thema
gewonnen. Und es scheint, dass sich die Mehrzahl von ihnen leider
damit begnügt, die verbalen Spiegelungen des Wohnens zu
untersuchen, wie ja überhaupt die Psychologie in weiten Teilen
zu einer Befragungs- und Deutungspsychologie verkommen ist. Dem muss
man aber nicht nur den Einwand der minimalen und mutmasslich
entstellenden Darstellung des Wohngeschehens im Erleben und damit
auch in der Verbalisierbarkeit entgegenhalten.
Man kann vielmehr mit guten Gründen argumentieren, wie
später einsichtig werden wird, dass der Umgang mit Dingen und
Raumteilen im sozialen Setting einer Wohnung und Wohnumgebung
eigentlich selber den kommunikativen Charakter des "Sprechens"
einer eigenen Form von Sprache oder Interaktion hat. Denn das meiste,
was wir in der Wohnung tun, hat wie Gesprochenes potentielle
Wirkungen auf die Mitbewohner und auf uns selbst, ist eine Art
Dialog mit den andern und mit uns selbst mittels Dingen und
Räumen anstatt Sätzen.
Nach allem was wir heute wissen, lässt sich die These
vertreten, die "Wohnsprache" weise mit der Sprechsprache zwar manche
Gemeinsamkeit, aber auch einige wesentliche Unterschiede auf, welche
gerade eine simple Übersetzung der einen in die andere
erschweren wenn nicht weitgehend ausschliessen. Es gibt Dinge, die
lassen sich in einer Sprache sagen oder mit ihr bewirken, andere
besser oder eigentlich fast nur in oder mit einer anderen.
Und warum sollten wir denn, wenn wir in einer Wohn-Gemeinschaft
die "Wohnsprache" erfolgreich benutzen, diese immer auch noch
parallel dazu oder gar vorgängig, in eine andere, die
Erlebens"sprache" oder die Sprechsprache übersetzen? Das
wäre ja wohl nicht nur unökonomisch, sondern
möglicherweise sogar hinderlich. Ausser in jenen Situationen, wo
man in der gewohnten Sprache nicht weiterkommt. Das Erleben wird ja
im allgemeinen erst dann bedeutsam, wenn Wahrnehmungs- oder
Verhaltensroutinen auf Hindernisse stossen. Das Wohnen ist aber zur
Hauptsache eine zwar kulturell bedingte, aber dennoch wohl
tiefsitzende Tätigkeit.
Die Wohnpsychologie hat zum Ziel, eine Art Grammatik und
Wörterbuch der "Wohnsprache" zu entwickeln und natürlich
damit auch zu zeigen, in welcher Weise das Wohnen eine eigene Art des
interaktiven Sozialgeschehens und persönlichen
Entwicklungsprozesses darstellt. Das ist eine langfristig anzulegende
Aufgabe; wir stehen erst an ihrem Anfang.
In unserer Berner Gruppe Umwelt- und Kulturpsychologie haben wir
in nunmehr bald 20 Jahren der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit dem Thema relativ früh gefunden, dass "Wohnen" genauso wenig
(oder noch weniger) definierbar ist wie "Wohnung". Für
Arbeitszwecke approximieren wir den Begriff "Wohnen" im Sinne einer
Tätigkeit.
Wir bezeichnen damit eine Gruppe von unterschiedlichen, aber
aufeinander bezogenen sozialen und solitären Akten in
raum-zeitlichen Mustern bezogen auf eine ebenso vielfältige und
doch zusammengehörige Gruppe von Artefakten. (Mit Akten
meinen wir Handlungen in einem allgemeinen Sinn, d.h. auf Teile oder
Aspekte der Umwelt bezogenes Verhalten)
Die Akte lassen sich überindividuell als Handlungsmuster
charakterisieren, werden aber konkret als Akte von Personen mit ihrer
Umwelt vollzogen. Es sind viele grössere und kleinere Artefakte
wie Bauten, Einrichtungen, Alltagsgegenstände, also
menschgestaltete und zum grössten Teil unter Menschen
ausgetauschte Werke, welche insgesamt die Wohnung ausmachen. Sie
unterliegen durch solche Akte einem vorübergehenden oder
andauernden Wandel in ihren Eigenschaften oder in ihrer Anordnung;
zugleich bilden sie in ihrer Gesamtheit über die Zeit weg einen
in hohem Masse gleichbleibenden Rahmen der Wohntätigkeit.
Sowohl die beteiligten Personen wie auch die Artefakte bilden
durch den Vollzug und die Wirkungen der Akte je ein Teilsystemystem
"wohnende Menschen" und "Wohnraum mit Wohndingen"; zusammen stellen
sie das relativ beständige und dennoch sich entwickelnde
Gesamtsystem "Wohnen" dar. Es ist die Aufgabe der wohnpsychologischen
Forschung, die Manifestationen dieses Wohnsystems auf allen seinen
Stufen als Prozess und Strukturen zu beschreiben und sein
"Funktionieren" als Gesamtsystem auf den Begriff zu bringen.
Es gibt vielfältige Sachbezüge zwischen den Akten und
den Artefakten. Ähnlich wie die lexikalischen und syntaktischen
Bezüge der Wörter und Wortarten in der Sprache bilden Akte
und Artefakte untereinander Familien und Kontraste; manche Akte
gelten nur bestimmten Arten von Artefakten, andere sind allgemeinerer
Natur. Darüberhinaus gibt es beim Wohnen und ähnlichen
Tätigkeiten Grade der Zugehörigkeit zwischen
Personen und Artefakten. Zugehörigkeiten lassen sich etwa als
Zutritt, Ausschluss, Kontrolle, Besitz oder anderen Formen von
Verfügbarkeit für Personen oder Gruppen
charakterisieren.
In den meisten Kulturen betreffen die Wohnsysteme eher kleine und
relativ konstate soziale Gruppen. In technisierten und insbesondere
in industrialisierten Kulturen ist Wohnen ein eher privates oder
intimes Geschehen in einem gewissen Gegensatz zu "öffentlichen"
Tätigkeiten, geniesst aber einen gewissen Grad an impliziter
oder institutionalisierter allgemeiner Anerkennung, z.B. als
konventionell und rechtlich geschützte Privatsphäre. Oft
sind korrespondierende hierarchisierende Stufungen oder
"Schachtelungen" der sozialen Gruppen einerseits und der Raum- und
Baustrukturen anderseits zu beobachten (Person, Familie, Sippe,
Nachbarschaft, Gemeinde; Wohnung, Haus, Baukomplex, Dorf, Quartier,
Stadt).
Wenn wir den so umschriebenen Begriff des Wohnens weit nehmen, so
"wohnen" Menschen ein rundes Drittel ihrer Lebenszeit. Man kann auch
sagen, dass in den meisten Kulturen der überwiegende Teil
besonders der frühen Enkulturation und Sozialisation sich im
Wohnbereich abspielt. Dieser essentielle reproduktive Prozess macht
also häufig einen Teil der Wohntätigkeit beider
Enkulturationspartner aus. Natürlich tummeln sich auf diesem
Feld allerlei Ansprüche auf die Formung der jungen Generation.
Es wird versucht, die Sozialisationsprozesse stärker in die
öffentliche Sphäre zu verlagern und gleichzeitig unter
partikulären Einfluss zu bringen.
Die Wohntätigkeit ist aber nach wie vor auch in der
Abendländischen Kultur eine Lernsituation erster Ordnung, auch
wenn ihr Gewicht zunehmend von den Bildungsinstitutionen und noch
stärker von den Medien relativiert wird, welche direkt in den
Wohnbereich eingedrungen und zu einem eigenartigen und mächten
Teil des Wohnsystems geworden sind.
Es liessen sich weitere Charakterisierungen anführen; doch
dürften damit die wichtigsten zusammengestellt sein. Noch einmal
sei der Ensemble-Charakter aller Komponenten der Wohntätigkeit
betont und wiederholt, dass wir nicht mehr als eine Umschreibung
eines Phänomenfeldes zu geben versuchen, da keine eindeutige
Definition von Wohnen möglich ist.
Inhalt
3.
Wie können wir "Wohnen" verstehen?
Auf diesem Hintergrund ist eigentlich schwer zu verstehen, dass
die Psychologen nicht früh den eminent psychologischen
(insbesondere sozialpsychologischen, entwicklungspsychologischen,
handlungspsychologischen, kulturpsychologischen) Problemgehalt des
Wohnens erkannt und das Thema als Forschungsfeld und Beispiel
für die Theoriekonstruktion aufgenommen haben. Einmal mehr,
scheint die Praxis das Gebiet vor der Wissenschaft entdeckt zu haben.
Es zeichnet sich aber auch hier ab, dass theoriefreie Praxis leicht
zum Opfer von allgemeinen Voreingenommenheiten wird und wie so oft
eher zur Vernebelung von Interessen als zur Erhellung eines
Phänomenfeldes führt.
Ein Beispiel dafür ist etwa die Rolle des obenerwähnten
und sehr geläufigen Erklärungsvorschlags, Wohnen als
Konsumption im Dienste der Erfüllung von sogenannten
Grundbedürfnissen (eben "Wohnen", mit einem langen Katalog von
beliebigen Sekundärbedürfnissen) zu verstehen oder die
Wohnung und ihre Ausstattung im Dienste der Selbstverwirklichung der
Individuen zu sehen.
Auf dem Hintergrund der letzten ein bis zwei Jahrhunderte
Geschichte der Wohnungsarchitektur und der Wohngüterindustrie,
insbesondere der explosiven quantiativen Vermehrung des Anspruchs auf
Wohnraum und -ausstattung seit 1950, ist leicht einzusehen, dass hier
längst ein positiver Rückkoppelungsprozess zwischen
Bauwirtschaft und Konsumgüterindustrie einerseits und einer
unstillbaren "Sucht" der Wohnenden nach immer grösseren und
immer aufwendiger ausgestatteten Wohnungen für immer weniger
Personen eingesetzt hat, für den es eigentlich kein
Stop-Kriterium gibt. Es sei denn, die Menschheit ertrage, physisch
und sozial, einen aus den gegenwärtigen Abläufen
extrapolierbaren Zustand, den man etwa so umschreiben könnte,
dass jeder Weltbürger in mindestens drei Erdteilen je eine
Einzelperson-Wohnung belegt.
Ich spreche deshalb bewusst von einer "Sucht'; denn die heute als
normal geltenden Wohnansprüche scheinen genau jenen Charakter
eines Suchtmittels angenommen zu haben, das man einfach nehmen und
haben muss, obwohl man nicht versteht warum; von dem man etwas
erwartet und erhofft, das es nicht erfüllen kann, weil man nicht
einmal weiss, was man davon erwartet; das man aber im aktuellen
Augenblick dennoch so herrlich gut und beglückend findet. Von
dem man auch nicht weiss oder nicht wissen will, was und wie es einem
auf Dauer wahrscheinlich Schaden zufügt.
Man bedenke in diesem Zusammenhang das oben über die
Verbalisierung des Wohnens durch die Beteiligten Gesagte. Menschen
über ihre Wohnbedürfnisse und ihre Wohnzufriedenheit und
allerlei Umstände davon zu befragen, ist letztlich nicht mehr
als eine sich um sich selbst drehende Betriebsamkeit einer sozialen
Fiktion. Denn die Befragten können kaum anderes als das und ein
bisschen mehr vom Gleichen für gut halten, was von der
Wohnindustrie angeboten wird und was demnach aufgrund sozialer
Vergleichsprozesse eine Norm umschreibt. Etwas blank gesagt: die
Ergebnisse naiver Wohnpsychologie spiegeln vermutlich zur Hauptsache
die Inhalte von Magazinen wie "Schöner Wohnen" und "Das ideale
Heim".
Demgegenüber ist es die Aufgabe der Wissenschaft, ein
gründlicheres Verständnis jener Prozesse und Produkte zu
liefern, welche das Leben von Menschen so sehr bestimmen wie die
Wohnungen und was darin und darum herum geschieht. Es bedarf
gemeinsamer Anstrengungen von mehreren Disziplinen, um diesen Komplex
auseinanderzulegen. Der Psychologie, so scheint mir, kommt dabei ein
zentrale Rolle zu, weil menschliches Handeln in dem Komplex die
zentrale Rolle spielt.
Man wird wohl für sinnvoll halten können, alles was in
und um die Wohnungen herum und worauf sich andere kulturelle
Bedingungen und Wirkungen beziehen lassen, in gründlicher und
geduldiger Anstrengung angemessen zu beschreiben. Während
beispielsweise der Botaniker bei der entsprechenden Aufgabe
verhältnismässig leicht Pflanzenarten unterscheiden,
sammeln, wiedererkennen und nach unterschiedlichen Gesichtspunkten in
eine Ordnung bringen und schliesslich in ihre evolutiven und
ökologischen Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge
einfügen konnte, ist der Psychologie in der schwierigen Lage,
dass er sein Phänomenfeld nicht säuberlich in
"vorgefertigte" Einheiten aufgeteilt vorfindet. Er muss vielmehr auf
der Basis kluger Theorie adäquate Beobachtungs- und
Beschreibungsverfahren erst entwickeln, um das zu bestimmen und zu
erfassen, was sich in den Wohn-Bedingungs-und-Wirkungsgefügen
als bedeutsam erweist. Wir haben angedeutet, wie leicht man sich
dabei durch Oberflächenerscheinungen verführen lassen
kann.
Es ist hier nicht der Platz unsere teils sehr grundlegenden
theoretischen und methodischen Leitlinien auszubreiten. Interessierte
Leser seien auf unsere Arbeiten verwiesen. Erschliessen lassen sie
sich unter dem Gesichtspunkt der semiotischen Ökologie aus Lang
(1993 a und b), unter dem Gesichtspunkt unserer Analysen der Wohnens
und seiner Bedingungen und Wirkungen aus Lang (1990, 1991 und 1992),
Slongo (1991), Studer (1993) und Markwalder (1993). An einem Beispiel
aus einer der neueren Diplomarbeiten von Hubert Studer sei aber
illustriert, wie wir versuchen, praktische und auch aktuelle Fragen
mit der längerfristigen Zielsetzung unseres Forschungsziels zu
verbinden.
Inhalt
4.
Kann man allein oder "verteilt" wohnen?
Eine der vielen drängenden Fragen ums Wohnen herum, die
freilich erst unter die Haut geht, wenn man ihre Tragweite zu
verstehen versucht, ist der Trend zum freiwilligen
Alleinwohnen, der in den 60er Jahren eingesetzt hat. Heute
(Volkszählung 1990) leben im schweizerischen Durchschnitt etwas
über zwei Personen in einem Haushalt;1970 waren es noch fast
drei. Die rund 6.87 Millionen Bewohner der Schweiz leben in 3.14
Millionen Haushalten, davon sind ein Drittel
Einpersonenhaushalte;1970 sind es bloss 18%, vor dem Krieg nur 10%
gewesen. In den "grossen" Städten beträgt der Anteil sogar
um die 50%. In der Schweiz wohnt nahezu eine auf fünf Personen
allein.
Genauere Analysen zeigen, dass der grössere Teil der
individuell Wohnenden und vor allem der Zuwachs der vergangenen
Jahrzehnte auf die Altersstufen zwischen 20 und 40 fällt, also
zur Hauptsache auf diejenigen, welche diese Lebensform aus freien
Stücken suchen. Man könnte nun sagen, das sei ein Trend der
Lebensformen, der wie andere gesellschaftliche Entwicklungen
hinzunehmen ist. Anderseits hält sich der Mensch für ein
denkendes Wesen, welches nicht nur seine Zukunft plant, sondern bei
seinem Planen und Handeln auch die möglichen Folgen seines Tuns
berücksichtigt.
Ein Hauptsatz unseres dargelegten Verständnisses des Wohnens
besagt, dass wir mit Vorteil die Wohnungen mit ihren Inhalten und
Ordnungen als ein dynamisches "soziales Gedächtnis" oder
als eine Art "externe Seele" verstehen. Hinter diesen
Stichworten verbirgt sich die Idee, dass diese organismus-externen
oder kulturellen Strukturen, die über die Geschichte vieler
Generationen und in der Entwicklung von individuellen
Lebensläufen jeweils gerade so geworden sind, wie sie hier und
dort vorzufinden sind, für ein soziales System in mancher
Hinsicht ähnliche Funktionen tragen wie das organismus-interne
Hirn für die einzelne Person.
Es handelt sich demgemäss in unserem Verständnis bei den
Räumen und Sachen nicht einfach um Objekte, unserer
individuellen und kollektiven Verfügungswillkür
anheimgestellt, sondern um Strukturen, an denen alle teilhaben,
welche in einem engen oder weiten Sinn zusammenleben. Jede
Manipulation dieser Strukturen betrifft nicht bloss diese selbst,
sondern trifft indirekt auch die Mitmenschen, welche mit diesen
Wohndingen zusammen aktuell und künftig sozio-kulturelle Systeme
bilden. Zeichentheoretisch ausgedrückt handelt es sich bei den
Wohnstrukturen um "Texte" eigener Art, in denen und durch welche
wesentliche Teile unserer individuellen und sozialen Existenz ihre
Verkörperung finden und zur Wirkung bringen. Wohnprozesse
sind ein bedeutendes "Medium" der Selbstorganisation der menschlichen
Kondition.
Auf diesem Hintergrund erwächst die Vermutung, dass
Alleinwohnen, so angemessen es in gewissen Lebensphasen sein mag, als
Dauerkondition dazu führen kann, dass die individuell Wohnenden
sich auf diese Weise gewissen regulativen Prozessen des
Zusammenlebens entziehen. Das mag im bewertenden Erleben der
Betreffenden, vielleicht verstärkt durch starke
Regulationszwänge im Berufsleben, sehr positiv erscheinen. Doch
müsste man eigentlich besser verstehen, welche Auswirkungen von
solchen Lebensformen langfristig auf die Betreffenden und auf das
gesamte Sozialsystem zu erwarten sind.
Natürlich kann eine solche Frage erst nach vielen Jahren
breiter Erfahrungssammlung und -auswertung eine Antwort erhalten.
Unmittelbar ist es aber möglich, die regulativen Prozesse von
Alleinwohnenden mit solchen von kollektiv Wohnenden zu
vergleichen. Die Untersuchung von Hubert Studer hat dazu
geeignete Begriffe und Methoden entwickelt und explorative Befunde
bei je vier Personen in entsprechenden Wohnlagen erhoben. Der Zugang
ist über die Erhebung der gesamten Zeitabläufe innerhalb
und ausserhalb der Wohnung während einer Woche ("Zeitbudget"):
was habe ich in welchen Zeitabschnitten, an welchen Orten, mit
welchen Personen und mit was für Dingen gemacht? Die Protokolle
der Tätigkeiten wurden in ausführlichen Gesprächen mit
den Personen mit soviel Kontext aus deren physischer und psychischer
Lebenslage angereichert, dass ihre ordnende und deutende Analyse
möglich wurde.
Wir können hier als ein Hauptresultat nur Belege dafür
anführen, dass im Vergleich mit den Zusammenwohnenden bei den
Alleinwohnenden weniger die Quantität (also die Zeit des
Zusammenseins, die freilich eine eigene räumliche Verteilung
erhält) als die Qualität der interaktiven Vollzüge
verändert ist. Dieser Qualitätswandel kann ohne
Darstellung der Methodik und von Detailergebnissen nicht kurz
zusammengefasst, noch gar ohne Bedenken zusammenfassend bewertet
werden, weder positiv noch negativ. Einigermassen überraschend
erwies sich die Feststellung, dass manche Alleinwohnende faktisch
"verteilt" wohnen. Sie haben ihre Einpersonenwohnung und ziehen sich
immer dorthin zurück, verbringen aber beträchtliche Teile
ihrer Nicht-Arbeitszeit in der Wohnung von Partnern oder
Freunden.
Das Verständnis der menschlichen Existenz sollte sich
orientieren am Bezugsfeld von Menschen in der Kultur. Denn das sind
die Bedingungen, welche nicht nur auf Menschen einwirken, sondern
welche Menschen überwiegend selber herstellen. Natürlich
kann dies niemand für sich allein; es geschieht vielmehr im
überpersönlichen und langfristigen Werden von
sozio-kulturellen Systemen. Menschsein ist nicht denkbar ohne solchen
evolutiven Dialog in der Kultur. Wohnen ist ein exemplarisches
Feld der Konkretisierung dieser kulturpsychologischen Sichtweise in
theoretischer, methodischer und faktischer Hinsicht.
Inhalt
Literaturangaben
Flade, Antje (1987) Wohnen psychologisch betrachtet. Bern,
Huber. 194 Pp.
Lang, Alfred (1990) Mehr und besser? Über Raumansprüche
und Gestaltungsangebote. Information Raumplanung 5 (2)
3-5.
Lang, Alfred (1991) Wohnraum als Aussenraum des Innenlebens - ein
Dialog zwischen Bürgerin und Wohnpsychologe. (Mit einer
Bildgeschichte gezeichnet von Camillle Halter und einem Kasten:
Verstehen wir Bauen und Wohnen?) Der Bund (Bern) Nr. 223
(Beilage: "Bauen -- Wohnen 1991") vom 24.9.91.
Lang, Alfred (1992) On the knowledge in things and places. Pp.
76-83 in: Cranach, Mario von; Doise, Willem & Mugny, Gabriel
(Eds.) Social representations and the social basis of
knowledge. Bern, Huber.
Lang, Alfred (1993 a) Non-Cartesian artefacts in dwelling
activities -- steps towards a semiotic ecology. Schweizerische
Zeitschrift für Psychologie 52 (2) 138-147.
Lang, Alfred (1993 b) Zeichen nach innen, Zeichen nach aussen --
eine semiotisch-ökologische Psychologie als Kulturwissenschaft.
Pp. 55-84 in: Rusterholz, Peter & Svilar, Maja (Eds.) Welt der
Zeichen -- Welt der Wirklichkeit. Bern, Paul Haupt.
Markwalder, Stefan (1993) Auf den Spuren des Wohnens -- eine
explorative Untersuchung zur Regulation der sozialen Bezüge im
Zweipersonenhaushalt. Diplomarbeit, Bern, Institut für
Psychologie der Universität. 116 Pp + Anhang.
Slongo, Daniel (1991) Zeige mir, wie du wohnst, ... -- eine
Begrifflichkeit über externe psychologische Strukturen anhand
von Gesprächen über Dinge im Wohnbereich. Diplomarbeit,
Bern, Psychologisches Institut der Universität. 135 Pp.
Studer, Hubert (1993) Individuelle und kollektive Wohnformen --
eine explorative Untersuchung ihrer sozialer Implikationen.
Diplomarbeit, Bern, Institut für Psychologie der
Universität. 188 Pp.
Zusammenfassung
(250)
Bis vor kurzem hat man sich mit ökonomischen,
funktional-technischen oder ästhetischen Erklärungen des
Wohnens zufrieden gegeben. Aber eigentlich wäre die Psychologie
wie keine andere Wissenschaft gefragt, dieses bedeutende kulturelle
Geschehen dem Verständnis zu erschliessen. Denn Menschen widmen
ihm, den Schlaf abgerechnet, wohl ein Drittel ihrer Lebenszeit und
ziehen darin nicht nur Kinder auf, sondern verstehen es häufig
als ein örtliches Zentrum ihrer persönlichen Identität
und ein Basisfeld ihrer sozialen Existenz. Die Autoren skizzieren und
kritisieren die allgemein vorherrschende Auffassung von der Wohnung
als einem Objekt des Konsums, welches im Interesse der Wohnenden
angeblich beliebig gestaltet werden könne, sofern es deren
Wohnbedürfnisse befriedige. Der in der Psychologie üblich
gewordene methodische Zugang zum Wohnen über seine
Versprachlichung übernimmt nun freilich diese Zirkularität
der Erklärung, insofern mit Fragebogen und
Gesprächsverfahren, die sich auf das Objekt Wohnung und die
damit verbundenen Wünsche und Versagungen der Menschen richten,
kaum anderes als die gängige soziale Konstruktion des Wohnens
dargestellt werden kann. Eine wissenschaftliche Ergründung des
Wohnens sollte darüberhinaus in aller Gründlichkeit
beobachten und beschreiben, was Menschen mit ihren Dingen in ihren
Räumen eigentlich tun; sie soll dessen Bedingungen und dessen
Wirkungen nachgehen und sie in einen theoretischen Zusammenhang
ordnen. Anhand einer Untersuchung über das Alleinwohnen zeigen
die Autoren, dass man den Wohnprozess wohl am besten als ein sehr
grundlegendes psycho-soziales Regulationsgeschehen sieht. Dieses
findet in jeweils bestimmten gebauten und gestalteten Strukturen
seine Verkörperung, welche ihrerseits kulturell und individuell
einmalige psychische und soziale Entwicklungs- und
Stabilisierungsprozesse bestimmen.
Inhalt
Abstract
Until recently there was wide agreement and
satisfaction about explaining the dwelling process in economical,
functional-technical, or esthetic terms. However, looking more
carefully, it is unavoidable to turn to psychology (or perhaps to
something that might be called empirical anthropology) more than to
any other science to understand this important cultural practice.
For, humans spend, in addition to sleeping time, roughly a third of
their life time in this activity and educate in the process not only
their children but also understand it often as the spaial center of
their personal identity and as the base of their social existence.
The authors sketch and criticize the prevailing wisdom seeing in the
dwelling an object of consumption which can be formed to fancy as
long as it fulfills the dweller's dwelling needs. The methodical
approach common in psychology by way of languistic representations,
in fact, accepts the implied circularity of explanation, in that
questionnaires and interviews directed at the object and the activity
of dwelling and the connected desires and frustrations cannot help
but tap the common social construction of dwelling present in speech
and media. A scientific inquiry of dwelling, however and in addition,
should carefully and thouroughly observe and describe what humans are
really doing in and with their things and rooms; in addition, the
conditions and the effects of these activities over time should be
gathered and organized in a comprehensive conceptual structure. By
the example of an investigation into "dwelling single" the authors
demonstrate that it is highly revealing to conceive of the dwelling
activity as a fundamental psycho-social regulation process. This
process is embodied in the particular built and furbished structures
which in turn carry and direct the cultural and individual psychical
and social developments and stabilizations observable.
Top of Page