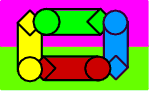Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 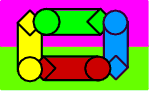 |
Book Chapter 1993 |
Das "absolute Gehör" oder Tonhöhengedächtnis | 1993.05 |
@Audit |
39 / 49KB Last revised 98.11.02 |
Ungekürzter Text / Gekürzte Fassung: Pp. 558-565 in Bruhn, Oerter & Rösing (Eds., 1993) Musikpsychologie - ein Handbuch. Rowohlts Enzyklopädie, Reinbek. | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Ein Lied ohne äussere Hilfen tonartrichtig anstimmen
können; seine Geige ohne Stimmgabel oder andere Referenz richtig
stimmen können; im a-capella Gesang die Stimmung halten; auch
eine schwierige Tonfolge ohne weiteres vom Blatt singen oder spielen;
die Tonart eines unbekannten Stückes unmittelbar hören und
die damit verbundene besondere Charakteristik geniessen können;
bei Modulationen jederzeit wissen, "wo" man ist; anderseits tonale
Relationen vielleicht weniger hören können als denken
müssen; beim Spiel alter Kirchenorgeln an der falschen Stimmung
oder bei transponierter Musik an der falschen Tonart leiden
müssen. Dies und anderes sind typische Leistungen oder
Funktionen des musikorientierten Hörsystems, wenn es eine
besondere Charakteristik aufweist, die traditionell als "absolutes
Gehör" bezeichnet wird.
Von der Mehrzahl der Menschen, auch der musikalisch Gebildeten
oder Berufstätigen, werden solche Leistungen nicht erwartet. Sie
sind für adäquates Musizieren oder Musikhören auch gar
nicht nötig, da Musik sowohl melodisch wie harmonisch auf
Tonhöhen-, oder genauer auf Tonstufen-Relationen beruht.
"Besitzer" des abs. Gehörs geniessen daher eine gelegentlich
eher zwiespältige Bewunderung. Von einigen, aber durchaus nicht
von allen, grossen Musikern der Geschichte, zB Mozart (notabene in
einer Epoche ohne Normstimmung!), wird mit guten Gründen
angenommen, dass sie Absoluthörer gewesen sind. Die grosse
Mehrzahl der Musiker sind aber zweifellos Relativhörer.
Inhalt
1.
Das absolute Gehör als Fähigkeit und
Leistung
Seit Stumpf (1883) wird das abs. Gehör als psychologisches
Problem auch mit empirischer Methodik untersucht. Bis heute
liegen gegen 400 wissenschaftliche Publikationen dazu vor (vgl. die
m.W. umfangreichste Liste bei Heyde, 1987) und jährlich kommen
um ein halbes Dutzend Arbeiten dazu. In der Regel gehen die Forscher
von einer Definition im Sinne einer Fähigkeit aus: das abs.
Gehör sei die Fähigkeit, isolierte Töne ohne
äussere Referenz bezüglich ihrer Tonhöhe benennen oder
produzieren zu können. Sie versuchen deshalb, das
Phänomen empirisch in Form von Leistungsbeschreibungen
einzufangen.
Bevorzugt wird der perzeptive Aspekt ("Gehör") im Sinne der
allgemeinen Reiz-Reaktions-Methodik untersucht. Typischerweise
werden dabei den Versuchspersonen (Vpn) einzelne Töne
nacheinander auf dem Klavier, mit anderen Instrumenten oder
Tonerzeugungsgeräten unter mehr oder weniger streng definierten
Bedingungen vorgespielt. Die Vpn haben auf jeden Reiz mit einer
Identifikations-Antwort aus einem Satz von vorgegebenen
Möglichkeiten zu reagieren, meist mit den üblichen
Tonnamen. Oder sie bekommen einen Tonnamen und antworten mit der
Herstellung einer passenden Tonhöhe auf einem Instrument oder
Gerät. Um den Bezug auf andere Töne als äussere
Referenz zu verhindern, werden manchmal zwischen den Aufgaben
Distraktoren eingefügt, welche idealerweise die Vp aktiv
beanspruchen (Tautenhahn, 1978). Ausgewertet wird die Quote der nach
einer bestimmten Definition für "richtig" erklärten
Identifikationsleistungen, die Art und Grösse der Fehler oder
die Genauigkeit der Einstellungen. Die Aufgabe besteht also im
Zuordnen eines Tonbegriffs bzw. Tonnamens zu einer
Tonfrequenz. Die Zuordnungsleistung setzt demnach voraus:
(a) eine Wahrnehmung in Form einer perzeptiven oder kognitiven Kategorisierung (im Tonnamen impliziert), (b) eine Identifikation im Sinne eines (Wieder-)Erkennens eines aus einer begrenzten Zahl bzw. einem System von von "Ton-Begriffen", welche
(c) dem Wahrnehmenden zusammen mit einem jeweils zugeordneten Tonnamen oder Produktionsverfahren im Gedächtnis verfügbar sind, und
(d) eine geeigneteKundgabe der Identifikation.
Das Besondere des abs. Gehörs besteht darin, dass diese
Zuordnung langzeitlich und unbeirrt durch Ablenkungen als interne
Referenz verfügbar ist, während beim Relativhören
solche Identifikationen nur im Verhältnis zu kurz vorher
gehörten externen Referenzen geleistet werden, dh eigentlich als
Intervall-Erkennen gelten müssen.
Von abs. Gehör spricht man freilich nur dann, wenn diese
Identifikationsleistung ohne externe Referenz konsistent und
sehr hoch ist bzw. nahe an das absolut Mögliche herankommt. Eine
Grenze dafür lässt sich nur willkürlich setzen und es
hat sich keine allgemein anerkannte Norm herausgebildet. Leider gibt
es kaum Untersuchungen mit grossen und für die allgemeine
Bevölkerung repräsentativen Personengruppen. Die
einzige bisher bekannte Untersuchung stammt aus unserer Berner
Forschergruppe und umfasst eine für die Alterspopulation
repräsentative Stichprobe von 451 Schülern zwischen 11 und
17 Jahren (Hurni-Schlegel & Lang, 1978; vgl. auch Hurni-Schlegel,
1983 und Andres, 1985). Unausgelesene Populationen zeigen demnach in
Identifikationsleistungen ohne äussere Referenz wahrscheinlich
eine angenähert normale Verteilung. Die genaue Form der
Verteilung hängt natürlich von der Schwierigkeit der Items
ab. Übereinstimmend mit anderen Befunden liegen die Leistungen
im wesentlichen auf oder nahe dem Niveau des Zufalls.
Auch unausgelesene Musikergruppen zeigen vermutlich eine
annähernd normale Leistungsverteilung, doch ist ihre
Durchschnittsleistung höher (Hurni-Schlegel & Lang, 1978;
Barkowsky, 1987; Miyazaki, 1988). Die neueren Resultate aus relativ
grösseren Gruppen von ausgelesenen Personen stützen aber
die früheren Vermutungen, wonach zwischen den
Identifikationsleistungen der meisten musikalisch mehr oder weniger
versierten Personen und einigen wenigen Absoluthörern ein klarer
Unterschied besteht. Je nach Schwierigkeit des Tests identifizieren
letztere typischwerweise 70 bis 100% der Töne, erstere zwischen
10 und 40%; verhältnismässig wenige weitere Personen finden
sich dazwischen (Hurni-Schlegel, 1983; Andres, 1985; Barkowsky, 1987;
Heyde, 1987; Miyazaki, 1988 und 1990). Man kann also mit guten
Gründen aus den verfügbaren Daten auf eine
quasi-bimodale Verteilung der Identifikationsleistungen in der
Gesamtpopulation schliessen, was unserer früheren
Formulierung von "in allen Ausprägungsgraden vorkommende
Leistungen" nicht widerspricht, aber eine vorschnelle Interpretation
ausschliesst. Dabei wäre die Verteilung der Leistung der grossen
Mehrzahl angenähert normal, während die Absoluthörer
im geschätzten Umfang von einem Bruchteil eines Prozents der
Bevölkerung am Rande der Verteilung nahe bei der Maximalleistung
einen zweiten, allerdings sehr kleinen Verteilungsgipfel beitragen
würden. Die Gegenvermutung nimmt eine eingipflige Verteilung
in der Gesamtpopulation an. Die Frage ist in unserer Gesellschaft
ideologisch brisant -- gibt es Menschen die anders sind als die
anderen? --; sie kann derzeit empirisch nicht entschieden werden.
Die Frage nach der Wahrscheinlichkeit des abs. Gehörs ist
wissenschaftlich nicht interessant und vermutlich den hohen Aufwand
einer riesigen Repräsentativuntersuchung nicht wert. Da in
Städten von einigen hunderttausend Einwohnern typischerweise
durch Umfrage unter Musikern höchsten einige Dutzend
Absoluthörer ausfindig gemacht werden können, lässt
sich die für statistisch absicherbare Verteilungsaussagen
nötige Stichprobengrösse abschätzen. Anderseits ist
die Frage nach der Verteilung konzeptuell mit der Alternative
verknüpft, ob die Tonhöhenidentifikation wie die meisten
kognitiven Leistungen allgemein auf einer grösseren Zahl von
Faktoren beruht oder ob für die Identifikation ohne äussere
Referenz eine weitere und besondere, wahrscheinlich einzelne
Bedingung dazukommen muss. Eine so formulierte Grundfrage wäre
vielleicht geeignet, die alte und unfruchtbare typologische Frage
abzulösen, ob es sich beim Absoluthören um eine angeborene
oder um eine erworbene Fähigkeit handle. Denn diese letzte
Frage, welche die Forschung während rund 100 Jahren fast
durchgehend beherrscht hat, ist ja so nicht beantwortbar, da
grundsätzlich jedes psychologische Phänomen aus dem
Zusammenwirken von Anlage und Erfahrung bestimmt ist.
Die Operationalisierung des Phänomens als Leistung
führte zur Vorstellung einer eindimensionalen Variation.
Das kann einerseits implizieren, dass die sehr hohe Leistung (das
sog. Absoluthören) ihrer Natur nach das Gleiche sei wie die
mittlere oder geringe Leistung, nur mehr davon. So ist eine
naheliegende Form der Überprüfung dieser These der Versuch,
durch geeignete Trainingsverfahren von mittleren zu höheren
Leistungen zu kommen. Solche Anstrengungen wurden in den 70er Jahren
intensiv unternommen, wie früher mit eher zweifelhaftem Erfolg
(Cuddy, 1968; Cuddy, 1970; Heller & Auerbach, 1972;
Hurni-Schlegel & Lang, 1978 u.a.m.). Anderseits kann eine
bimodal-eindimensionale Verteilung einen Erbfaktor implizieren
(Révész, 1913). Die verhaltensgenetischen
Untersuchungen von Familien oder Zwillingen, die sich auf die
Bedeutung von Anlagefaktoren richten könnten, sind bisher nur in
rudimentärster Weise unternommen worden (zB Bachem, 1940;
Profita & Bidder, 1985). Die Anlage-Umwelt-Frage ist nach
mancherlei empirischen Anstrengungen so offen, wie sie vordem in der
spekulativen Ära gewesen ist. Eine Rolle für einen
Erbfaktor ist nicht auszuschliessen; und obwohl sich
Identifikationsleistungen durch geeignete, recht aufwendige
Übungsverfahren verbessern lassen, ist das Ergebnis weder
dauerhaft noch mit der Fähigkeit von typischen
Absoluthörern quantitativ und qualitativ vergleichbar. Ein
einziger Fall ist bekannt, dessen Leistung quantitativ der von
genuinen Absoluthörern ähnlich ist (Brady, 1970); diese Vp
selbst, in Personalunion auch Trainer und Forscher, sieht freilich
qualitative Unterschiede (vgl. auch Carroll, 1975; Costall,
1985).
Wahrscheinlich verkürzt dieser mit seiner Orientierung auf
Fähigkeit und Leistung und die Unterscheidbarkeit von Personen
vorherrschende differentialpsychologische Ansatz das gegebene
Problem recht ungebührlich. Tatsächlich muss diese
Leistung, ob sie mehr oder minder eindrücklich ist, auf einer
ganze Reihe von intra- und extrapersonalen Bedingungen beruhen,
welche als solche und in ihrem Zusammenwirken der Aufklärung
bedürfen. Sinnvoller ist zu fragen, welche Bedingungen in
welchem Zuammenwirken gegeben sein müssen, damit es zu
entsprechenden Identifikationsleistungen überhaupt kommen kann,
und inwieweit die gleichen, inwieweit unterschiedliche Bedingungen
oder unterschiedliche Bedingungskonstellationen für das Relativ-
und das Absoluthören aufgezeigt werden können. Es soll im
folgenden versucht werden, anhand der neueren Untersuchungen ein
knappes Bild dieses nach wie vor rätselhaften Phänomens zu
zeichnen. Obwohl hier weder eine historische Darstellung (vgl. u.a.
Barkowsky, 1987; Heyde, 1987) noch eine umfassende Übersicht
über die neuste Literatur seit früheren
Überblicksartikeln (u.a. (Ward & Burns, 1982; Costall, 1985)
geboten werden kann, sei doch festgehalten, dass die meisten der
besprochenen Themen in früheren Arbeiten bereits mehr oder
weniger deutlich angesprochen worden sind.
Seit den 70er Jahren ist jedoch deutlicher als früher in der
Literatur eine Neuorientierung festzustellen. Zwei Arten von
Ansätzen sind erkennbar: die allgemeinpsychologische
Orientierung auf den aktuellen Prozess und die
entwicklungsbezogene Untersuchung der Genese des
Tonhöhenidentifizierens.
Inhalt
2.
Das Tonhöhen- und Tonstufenidentifizieren als
Prozess
Zwei Strategien der Bedingungsanalyse sind möglich: (a) die
Beschreibung dessen was beim Tonsstufenidentifizieren geschieht und
(b) die experimentelle Variation der Identifikationsaufgaben mit
Untersuchung der erzielten Wirkungen. Die Analyse kann
phänomenologisch und introspektiv erfolgen -- das hat in den
vergangenen 100 Jahren mehr Vermutungen als Sicherheit gebracht --
oder sie kann sich an anderen Konstrukten psychologischer Prozesse
orientieren.
Beginnen wir mit der Frage, was denn am Absoluthören,
abgesehen von seinem seltenen Vorkommen, so ungewöhnlich ist.
Eindeutige Identifikationsleistungen sind an sich etwas
Selbstverständliches; man denke an das Erkennen von Gesichtern,
von Kleidern, von Landschaften, von Texten oder Bildern. Unser
Gedächtnis speichert tausende und abertausende von
Gegenständen und Ereignissen in der Welt und wir erkennen deren
Auftreten bis auf einige Ausnahmesituationen mit ungemein hoher
Sicherheit und ordnen ihnen eindeutige Namen zu. So wäre
eigentlich die Frage naheliegender, warum nicht alle Menschen
"absolut" hören. Die Psychologie der Informationsverarbeitung
hat aber gezeigt, dass Wiedererkennungsleistungen immer dann massiv
abfallen, wenn die Variation der zu erkennenden Gegenstände auf
wenige oder eine einzige Eigenschaftsdimension reduziert ist. So ist
das Erkennen von Körpergrössen von Menschen (lineare
Erstreckung) oder von Lautheit von Musik (von pp bis ff) auf wenige
unterscheidbare Kategorien beschränkt, deren Übergänge
zudem wenig scharf sind. Typisch für eindimensional variierende
Gegebenheiten ist die Unterscheidbarkeit von 5 bis 10 Stufen.
Informationstheoretisch ausgedrückt bedeutet dies eine Reduktion
der kontinuierlichen Merkmalsvariation am Objekt (zB gemessene
Grösse oder Intensität) in eine vom Wahrnehmenden
verwertbare Information von 2 bis 3 bit (Miller, 1956). Diese
beschränkte Kanalkapazität gilt ebenso für die
gesehene Farbe von monochromatischem Licht (die 7 Farben des
Regenbogens) wie für die gehörte Tonhöhe von
Frequenzen (die 5 bis 7 Stufen der Tonleitern). Die
Identifikationsleistungen von Absoluthörern, mit derselben
Methode bewertet, verarbeiten jedoch mehr als die doppelte
Informationsmenge; sie sind nämlich im Unterschied zu den
Normalhörern imstande, alle Halbtonstufen über 5 bis 6
Oktaven nahezu eindeutig zu erkennen, dh sie scheiden das
Frequenzkontinuum der musikalischen Töne in rund 60 bis 70
Stufen (Ward et al., 1982; Miyazaki, 1988) und sie binden es
überdies fest an die musikalische Stimmung. Das überrascht,
wenn man davon ausgeht, dass die vom Hörer verarbeiteten
Frequenzen ein eindimensionales Kontinuum darstellen.
Der Vergleich mit der Farbe hilft vielleicht etwas weiter.
Auch Licht variiert in jener Dimension, welche die Grundlage der
Farbwahrnehmung ist, nämlich der Wellenlänge oder Frequenz
der Photonenstrahlung eindimensional. Von Ausnahmen (Regenbogen,
Prismen, Laser) abgesehen tritt es aber in der Natur und Kultur als
Mischlicht mit Anteilen vieler Frequenzen auf. Das Sehsystem nimmt
daraus mit drei in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen
empfindlichen Sensoren drei Werte auf, aus denen es in einer
neuronalen Verschaltung eine Vielzahl von Farbtönen (!)
errechnen kann, von denen wir unter einigermassen normalen
Beleuchtungsverhältnissen je nach Erfahrung 20 bis 100 und mehr
eindeutig wiedererkennen und benennen können (vgl. zB Boynton,
1988). Was Farbe betrifft, sind alle Menschen Absolutseher. Warum
sind wir also nicht alle auch Absoluthörer? Das
Frequenzkontinuum der mechanischen Schwingungen periodischer
Schälle ist zwar ebenfalls eindimensional; aber ebenso treten
Töne in der Musikkultur von Ausnahmen abgesehen (reine
Sinusschwingungen) in Mischungen auf, allerdings spezielleren als
Licht, nämlich mit Anteilen von Harmonischen einer
Grundfrequenz. Nun wissen wir im Unterschied zur Farbwahrnehmung noch
sehr wenig über die Verarbeitung von Schall im neuronalen
Hörsystem. Insbesondere ist die Rolle der Frequenzgruppen
(critical bands) noch unklar; sie könnten analog zu den
Farbrezeptorgruppen durch ihre kombinierte Verarbeitung bedingen,
dass das Ohr aus dem scheinbar eindimensionalen Angebot des Schalls
ein mehrdimensionales Phänomen auszieht. Die Analogie hat aber
ihre Grenzen.
In der Tat variieren gehörte Töne in Abhängigkeit
der sie konstituierenden Frequenzgemische in mehreren Eigenschaften:
sie haben eine allgemeine Helligkeit über alle Oktaven hinweg
(Tonhöhenkontinuum); sie gruppieren sich zu kategorialen,
aufeinander beziehbaren Einheiten oder Stufen (Tonmaterial als
Menge von Halbtonschritten); sie realisieren bestimmte
Tonstufen innerhalb jeder Oktave (Tonleiter); sie intonieren
diese Tonstufen ideal, zu tief oder zu hoch (Tonhöhe in
einem zweiten Sinn); sie zeigen eine charakteristische
Klangfarbe (Timbre); sie haben einen bestimmten Charakter in
simultanen und sukzessiven Tonensembles (Interval, Melodik, Harmonik,
Tonalität). Eine solche Auffassung eines "subjektiv"
elaborierten Tonsystems im musikalischen Zusammenhang (vgl. auch
Hurni-Schlegel & Lang 1978) hat sich in den letzten beiden
Jahrzehnten gegenüber früher in der Psychologie
vorherrschenden psychophysikalischen Denkweisen mehr und mehr
durchgesetzt (vgl. etwa (Deutsch, 1982; Howell, Cross & West,
1985; Dowling, & Harwood, 1986 sowie verschiedene Kapitel in
diesem Handbuch). Das Unterscheiden und das Identifizieren von
Tönen in bezug auf zwar frequenzbezogene, aber erst im
Hörsystem als solche gebildete Eigenschaften und Relationen kann
nur sinnvoll im Rahmen eines solchen Tonsystems verstanden werden. Es
setzt voraus, dass der Hörer über ein entsprechend
konstituiertes Ohr verfügt und aufgrund von Erfahrungen in einer
bestimmten Musikkultur in einer ihm eigenen Weise konditioniert
hat.
Auf diesem allzu kurz beschriebenen Hintergrund lässt sich
nun untersuchen, was das Spezifische das sog. Absoluthörens
ausmachen könnte. Werden Töne, Tonkomplexe oder Tongruppen,
deren physische Charakteristik oder Darbietungsweise im
Zusammenhang mit den genannten gehörten Eigenschaften
variieren, zur Identifikation geboten, so sollte sich insbesondere
aus den Antwortweisen von Personen mit generell
überdurchschnittlichen Leistungen erschliessen lassen, ob die
Identifikation stets in gleicher Weise erfolgt oder nicht und worauf
es dabei ankommt. Die Definition des "Absoluthörens" würde
auf diese Weise von einem in Untersuchungspläne unklar
hineingesteckten Apriori zu einem möglichen Ergebnis von
unvoreingenommen Untersuchungen und Analysen.
Ohne hier ins Detail gehen zu können, darf angenommen werden,
dass eine ganze Reihe von Prozesskomponenten von der Wahrnehmung
über die interne Verarbeitung bis zur Äusserung für
hohe bis sehr hohe Identifikationsleistungen bei musikalisch
versierten Personen prinzipiell in gleicher Weise mitspielen. Dazu
gehören die Kategorisierung oder Stufung des Tonmaterials und
wohl auch die gesamte Struktur des Tonsystem einschliesslich der
zugehörigen Nomenklatur für Tonstufen, Intervalle und
Akkorde. Es dürfte auch allgemein der Fall sein, dass bei jeder
frequenzbezognen Tonidentifikation gleichzeitig mehrere
Eigenschaftengebildet und nur je nach Aufgabenkontext
unterschiedlich ausgewertet werden. Jeder Ton hat notwendig eine
Klangfarbe; er gehört obligatorisch einer Tonstufe an,
sofern er nicht völlig isoliert auftritt; und überdies hat
er im doppelten Sinn eine Tonhöhe, insofern er (auf einer
Stufe) irgendwo zwischen dunkel (tief) und hell (hoch) im Bereich der
hörbaren Tonhöhen liegt und insofern er seine Tonstufe
korrekt bzw. mehr oder weniger zu tief oder zu hoch erfüllt. Was
das Absoluthören auszeichnet, ist mithin die Verankerung der
Tonstufen im Tonhöhenkontinuum und die ungewöhnliche feste
Zuordnung des (subjektiven) Tonhöhenkontinuums zu den
(objektiven) Tonfrequenzen (Hurni-Schlegel & Lang, 1978;
Costall, Platt, & Macrae 1981; Andres, 1985; Costall, 1985).
Eine beträchtliche Anzahl von Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Identifikationsleistungen bei klangfarbenreichenTönen etwas besser ausfallen als bei Sinusschällen
(Blatter, 1974; Tautenhahn, 1978; Lockhead & Byrd, 1981; Balzano,
1984; Barkowsky, 1987; Miyazaki, 1989). Leider fehlen Untersuchungen
darüber, welche Art der Obertonanreicherung höhere
Leistungen begünstigen kann.
Ein interessanter Befund hat mit dem Frequenzbereich zu
tun, in welchem Identifikationen möglich sind. Über ca.
4kHz sind Tonstufen kaum mehr unterscheidbar und damit auch nicht
identifizierbar (Bachem, 1954). Höhe Tone haben wenig
hörwirksame Harmonische. Im Bereich der tiefsten zwei
musikalischen Oktaven (C1 bis C3) fallen mehr Identifikationsfehler
an; insbesondere bei Sinustönen fällt die Leistung deutlich
ab (Miyazaki, 1989). Dass für die Stufenbildung die
Obertonhaltigkeit grundsätzlich bedeutsam ist, gilt als
sicher. Ist sie auch für die Verankerung der Stufen im
Tonhöhenkontinuum relevant? Da die stärksten Harmonischen
zur Grundfrequenz im Oktavverhältnis stehen, dürfte hier
auch die Ursache der Oktavverwechslungen liegen, welche umso
häufiger aufzutreten scheinen, je hervorragender die
Identifikationsleistungen sonst sind (Miyazaki 1988 und 1989; man
beachte seine vorbildlichen graphischen Resultatdarstellungen!). Dass
der musikalisch gebildete Normalhörer Intervalle gleich sicher
identifiziert wie der Absoluthörer Einzeltöne (Siegel &
Siegel, 1977) könnte ebenfalls darauf hinweisen, dass
Absoluthörer Relationen zwischen Teiltönen auswerten,
welche Normalhörer als einheitlichen Komplex erfahren. Damit
bekäme schon die einzelne Tonstufe für den
Absoluthörer eine besondere zusätzliche Qualität.
Merkwürdig mutet an, dass erst seit kurzem Untersuchungen
über das Identifizieren der Tonika von Akkorden und Melodien
anstatt von Einzeltönen durchgeführt werden, obwohl ja die
Tonalitätsidentifikation eine musikalisch sinnvollere Aufgabe
darstellt (Terhardt & Seewann, 1982; Andres, 1985; Barkowsky,
1987; Heyde, 1987). Die bisher vorliegendenen Ergebnisse lassen
vermuten, dass dem traditionell definiertem Absoluthören und dem
Akkordidentifizieren nicht ein und dieselben Bedingungen
zugrundeliegen. Obwohl Absoluthörer auch bei dieser Leistung
(möglicherweise aus bloss methodischen Gründen) besser
sind, scheinen bei Relativhörern verhältnismässig
erhöhte, bei Absoluthörern relativ verminderte Leistungen
vorzuliegen (Andres 1985). Ist denkbar, dass das bei Akkorden
"flächiger" angereicherte Obertonspektrum das Erkennen der
besonderen Tonstufenqualität erschwert?
Von einer Reihe von weiteren meist noch wenig untersuchten
Bedingungen (Unterschiede zwischen einzelnen Tonstufen wie
Auszeichnung von C oder "schwarze" vs. "weisse" Tasten; tonaler
Kontext bei Intervallen und Akkorden, etc.) ist vielleicht die
bedeutsamste die Zeitvariable. Bei sehr hohen Leistungen bringen
kurze Tondauern oder knappe zur Identifikation verfügbare Zeiten
keine Beeinträchtigung; entsprechend sind sehr hohe Leistungen
sowohl spontan wie unter Zeitdruck mit besonders kurzen
Reaktionszeiten verbunden (Barkowsky, 1987; Miyazaki, 1990). Die zur
Identifikation erforderliche Referenz ist demnach bei den besten
Hörern unmittelbar verfügbar, und dies offenbar für
die Mehrheit der Tonstufen wenn nicht für alle. Anderseits kann
man vermuten, dass bei den weniger guten Hörer durch einen
"Umsetzungsprozess" zwischen Referenz und Aufgabenton Zeit
beansprucht wird. Dieser Befund sollte nicht mit den introspektiven
Aussagen über interne Transformation gleichgesetzt werden,
obwohl eine teilweise Entsprechung bestehen mag; denn es kann hier um
Reaktionszeiten unter einer Sekunde gehen. Dass bei Hörern mit
sehr hohen Leistungen eine andere Art der Referenznutzung vorzuliegen
scheint, wird auch durch den neurophysiologischen Befund
bestätigt, wonach bei Absoluthörern, und nur beim
Absolutidentifizieren von Tönen, das elektroenzephalographische
Indiz für die Aktivierung rezenter Gedächtnismomente fehlt
(Klein, Coles, & Donchin 1984). In den verschiedenen empirischen
Befunden lassen sich die früher von den Forschern intuitiv
beschriebenen Typen des Identifizierens unschwer wiedererkennen: der
genuine Absoluthörer (Bachem, 1955 u.a.) ist der rasche und
unbeirrbare Identifizierer mit einem differenzierten und direkten
Referenzsystem, während Bachems Quasi- und
Pseudo-Absoluthörer auf indirekte Zuordnungen angewiesen sind.
Im Unterschied zur Klassenscheidung mit ihrem idealtypischen Aspekt
wäre allerdings durch die dimensionale Merkmalsbeschreibung nur
eine approximative Separierung der Individuen möglich (Barkowsky
1987; Heyde 1987; Miyazaki 1990).
Mit der Zeit und der Art des Referenzbezugs sind wir bei jenem
Aspekt des Hörens, welcher für die oben beschriebene
quasi-bimodale Leistungsverteilung wohl entscheidend sein
dürfte, nämlich dem Gedächtnisaspekt. Schon
Stumpf (1883) hat in der Langzeitgedächtnisleistung das
entscheidende Merkmal des Absoluthörens gesehen. Bachem (1954)
hat "Vergessenskurven" bezüglich des Wiedererinnerns einer
externen Referenz im Zeitraum von Sekunden bis zu einer Woche erhoben
und festgestellt, dass es beim genuinen Absoluthörer dafür
praktisch kein Vergessen gibt. Absoluthörer haben demnach ihre
innere Tonstufen-Referenz auf eine äussere Tonfrequenz im
musikalischen Bereich überdauernd verfügbar, während
sie bei Relativhörern nach Sekunden bis Bruchteilen von Minuten
verblasst und insbesondere durch Interferenz mit anderem Tonmaterial
verwischt wird (Rakowski, 1972; Andres, 1985). Die Absoluthörer
verfügen einerseits über schärfere Kategoriengrenzen
für die Tonstufen (Szende, 1977) und sind damit, sofern sie
nicht speziell darauf achten, weniger intonationsempfindlich.
Anderseits sind sie durch Verstimmung um einen Viertelton im
Verhältnis zu ihrer internen Referenz irritierbar (Miyazaki, im
Druck 1991), während sie im Unterschied zu Relativhörern
durch einen ungewöhnlichen Tonalitätskontext nicht
behindert werden (Hurni-Schlegel 1983; Barkowsky 1987). Diesen
Besonderheiten muss eine Gedächtnisrepräsentation
zugrundeliegen, welche Tonstufen im Tonhöhenkontinuum fixiert
oder verankert. Die verbale Speicherung ist wahrscheinlich im
Gegensatz zu den Annahmen von Siegel (1974) nur sekundärer Natur
(Zatorre, 1989)
Auch phänomenologische Evidenz lässt es möglich
erscheinen, dass die Identität einer Tonstufe für den
Absoluthörer eine besondere Qualität darstellt
(Corliss, 1973; Vernon, 1977). (Die von Bachem dafür verwendete
Bezeichnung Ton-Chroma finde ich angesichts der Bezeichnung der
Klangfarbe für eine weitgehend tonhöhenunabhängige
Qualität eher irreführend; weil sie zudem uneindeutig
verwendet wird, sollte man sie vermeiden.) Zwar hat der Inhalt dieser
Aussage privaten Charakter. Sie ist aber heuristisch interessant in
Hinblick auf die Frage, ob Tonstufen -- für Absoluthörer --
auf einem elementare oder primären Prozess beruhen oder ob sie
eine sekundäre Resultante anderer Prozesse darstellen,
beispielsweise im Sinne des Konstanzprinzips der Wahrnehmung. In der
neuronalen Grundlage dieser Prozesse müsste der spezifische
Gedächtnisträger gesucht werden; als primäre Prozesse
hätten sie unterschiedliche Eigenschaften denn als
sekundäre.
In Analogie zu anderen kategorialen Primärqualitäten wie
zB Phoneme oder Primärfarben müsste es möglich sein,
die innere Referenz beispielsweise durch übermässigen
Gebrauch zu "verstimmen", sofern sie primären Charakter hat; die
Folgen davon müssten in systematischen Veränderungen von
Tonstufeneinstellung erkennbar sein. In einem Adaptationsversuch mit
in rascher Folge sukzessiv mehrmals um 20 cent erhöhter Stimmung
liessen sich Absoluthörer nicht beirren, sondern wechselten von
Fehlertoleranz zur nächsten Tonstufe (Hurni-Schlegel 1983). Auch
Heydes (1987) verstimmt dargebotenen Musikstücke hatten keine
nennenswerte Wirkung, weder bezüglich der Tonartenidentifikation
noch auf der emotionalen Ebene. Die von Miyazaki (im Druck 1991)
eingesetzen Verstimmungen dauerten wohl zu kurz, um mehr als
Irritation zu erzeugen. Es muss abgewartet werden, ob die Adaptation
der Absolutstimmung in dafür besser geeigneten Untersuchungen
gelingen wird. Dass sich der interne Standard mit dem
körperlichen Zustand mit zunehmendem Alter (Wynn, 1972; Vernon,
1977) "verstimmen" kann, deutet eher auf die Bedeutung eines
elementaren Gedächtnisträgers hin. Angesichts der
allgemeinen Ignoranz über die Grundlage des Gedächtnisses
und auch der zu rudimentären Erkenntnisse über die
höheren tonverarbeitenden Hirnzentren sind strukturelle
Einsichten über die rechtshemisphärische Lokalisation
hinaus (Zatorre, 1989) derzeit nicht zu erwarten.
Inhalt
3.
Zur Genese des Tonstufen-(Langzeit-)Gedächtnisses
Für keine der vier globalen Erklärungsthesen, welche die
Forschung seit Beginn des Jahrhunderts bestimmt haben --
Vererbung (Révész, 1913); Lernen (Meyer,
1899); Verlernen (Abraham, 1901/1902) und Prägung
(Copp, 1916) -- sind ausreichende Belege vorgelegt worden. Keine von
ihnen vermag konzeptuell zu überzeugen, obwohl
möglicherweise jede auf ihre begrenzte Art einen Aspekt des
Problems aufnimmt. Über die beiden ersten wurde oben in
Abschnitt 1 schon das Nötige gesagt.
Die Verlernthese relativiert die Vererbungsthese, wenn sie
annimmt, dass von der Anlage her alle Menschen die Fähigkeit des
Absoluthörens besässen, welche sich aber im Zuge des
Umgangs mit den Relativstrukturen der Musik verlöre. Die
Prägungsthese ihrerseits kombiniert eine Anlagekomponente
für eine gehörspezifische sensitive Phase mit der
Notwendigkeit spezifischer Erfahrungen in dieser Zeit. Sensitive
Phasen oder Prägung im strengen Sinn konnten jedoch beim
Menschen bisher allgemein nicht nachgewiesen werden.
So fehlt denn auch direkte Evidenz aus Untersuchungen von
Kleinkindern für das Verlernen wie für die Prägung.
Die Prägungsthese erfreut sich dennoch neuerdings steigender
Beliebtheit (Shuter-Dyson & Gabriel, 1981; Miyazaki, 1989). Der
Behauptung, viele Absoluthörer hätten in einer sensitiven
Phase von 3 bis 5 Jahren ihren ersten, gehörsprägenden
Musikunterricht erhalten (Miyazaki, 1990), stehen aber Hinweise auf
später beginnenden Unterricht entgegen (Crozier, Robinson &
Ewing, 1977). Es ist auch möglich, dass gerade jene Kinder
bevorzugt frühen Musikuntericht erhalten, welche durch
gehörsbezogene Aufmerksamkeit und musikalische Imitationen
auffallen.
Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die Erneuerung der
alten Befunde (Abraham 1901), wonach bei verschiedenen Tierarten,
insbesondere Vögeln, die absolute Tonhöhe der Gesänge
informationshaltig sein kann. Die neuere ethologische
Forschung über Vogelgesang zeigt allerdings deutlich, dass
für jede Art gesondert untersucht werden muss, in welcher Weise
Anlage und früher Erwerb oder spätere Modifikation den
Gesang und seine Funktionen bestimmen. Nachweise, dass absolute und
relative Tonhöhe von Gesängen das Sozialgeschehen
spezifisch beeinflussen können, gibt es für verschiedene
Arten, darunter Meise und Star, aber auch Ratten und Affenarten
(Hulse & Page, 1988). Solches setzt nicht nur die uns
interessierende Fähigkeit sowohl auf der produktiven wie auf der
perzeptive Seite voraus, es impliziert auch eine im Vergleich mit der
üblichen tiefergehende Definition der
Tonhöhenidentifikation, nämlich unter Betonung ihrer
Funktionalität.
Ethnographische Befunde beim Menschen scheinen in dieser
Hinsicht noch nicht systematisch erhoben und ausgewertet, obwohl sich
bereits Hornbostel (1911) der potentiellen Bedeutung der absoluten
Tonhöhe bewusst war. Immerhin finden sich Einzelhinweise auf
Naturvölker, in denen Gesänge stets auf gleicher
Tonhöhe angestimmt werden (Nachweis bei Hulse & Page 1988).
Sollten solche Befunde vermehrt zusammenkommen, so würde einmal
mehr deutlich, wie sehr die vorschnelle Operationalisierung des
Absoluthörens als Identifizieren von Einzeltönen dem
Verständnis des Phänomens abträglich gewesen ist.
Halpern (1989) hat Daten von 110 Studierenden, nur ein Viertel davon
Musiker, vorgelegt, welche ihnen vertrauten Lieder mit
überraschend hoher Konsistenz anstimmen und auch die richtige
Stimmung von vorgespielten Liedern überzufällig richtig
erkennen konnten. Diese Leistungen sind ebensoweit entfernt von
denjenigen typischer Absoluthörer wie von den zufälligen
Einzeltonidentifikationen durchschnittlicher Relativhörer.
Die Forschung zum Tonhöhen-Gedächtnis hat in gut 100
Jahren einen weiten Bogen von der qualitativen Spekulation über
quantitative Studien zu qualitativen Konzepten geschlagen. Die
Rätsel des abs. Gehörs sind freilich noch nicht
aufgeschlossen. Obwohl ein Faszinosum ist das Phänomen für
die Musiktheorie und -praxis von verhältnismässig geringer
Bedeutung. Denkbar ist, dass es zur Aufklärung der
Gedächtnisprobleme Bedeutung erlangt.
Inhalt
Literatur
Abraham, O. (1901/1902). Das absolute Tonbewusstsein.
Sammelband der internationalen Musikgesellschaft, 3, 1-86.
Andres, K. (1985). Stand in der Erforschung des Absoluten
Gehörs: Die Funktion eines Langzeitgedächtnisses für
Tonhöhen in der Musikwahrnehmung. Doktordissertation, Bern:
Psychologisches Institut der Universität, 229 Pp.
Bachem, A. (1940). The genesis of absolute pitch. Journal of
the Acoustical Society of America, 11, 434-439.
Bachem, A. (1954). Time factors in relative and absolute pitch
determination. Journal of the Acoustical Society of America,
26, 751-753.
Bachem, A. (1955). Absolute pitch. Journal of the Acoustical
Society of America, 27(6), 1180-1185.
Balzano, G. J. (1984). Absolute pitch and pure tone
identification. Journal of the Acoustical Society of America, 75,
623-625.
Barkowsky, J. J. (1987). An investigation into pitch
identification behavior of absolute pitch and relative pitch
subjects. Ph.D. Thesis, Urbana, Ill.: Univ. of Illinois at
Urbana-Champaign, 121 Pp.
Blatter, A. W. (1974). The effect of timbre on pitch-matching
judgments. Ph.D. Thesis, Urbana Ill.: Univ. of Illinois at
Urbana-Champaign (zitiert nach Barkowsky 1987).
Boynton, R. M. (1988). Color Vision. Annual Review of
Psychology, 39, 69-100.
Brady, P. T. (1970). Fixed-scale mechanism of absolute pitch.
Journal of the Acoustical Society of America, 48, 883-887.
Carroll, J. B. (1975). Speed and accuracy of absolute pitch
judgments: some latter day results. Educational Testing Service
Bulletin RB-75-35 (zitiert nach Barkowsky 1987).
Copp, E. F. (1916). Musical ability. Journal of Heredity,
7, 297-305.
Corliss, E. L. (1973). Remark on "fixed-scale mechanism of
absolute pitch". Journal of the Acoustical Society of America,
53(6), 1737-1739.
Costall, A. (1985). The relativity of absolute pitch. In P.
Howell, I. Cross & R. West (Eds.), Musical structure and
cognition (Pp. 189-208). London: Academic Press.
Costall, A., Platt, S. & Macrae, A. (1981). Memory strategies
in absolute Iidentification of circular pitch. Perception &
Psychophysics, 29(6), 589-593.
Crozier, J. B., Robinson, E. A. & Ewing, V. (1977).
L'étiologie de l'oreille absolue. Bulletin de Psychologie,
30(14-16), 792-803.
Cuddy, L. L. (1968). Practive effects in absolute judgments of
pitch. Journal of the Acoustical Society of America, 43,
1069-1076.
Cuddy, L. L. (1970). Training the absolute identification of
pitch. Perception & Psychophysics, 8, 265-269.
Deutsch, D. (1982, Ed.). The psychology of music. London:
Academic Press, 542 Pp.
Dowling, W. J. & Harwood, D. L. (1986). Music
cognition. New York: Academic, 258 Pp.
Halpern, A. R. (1989). Memory for the absolute pitch of familiar
songs. Memory & Cognition, 17(5), 572-581.
Heller, M. A. & Auerbach, C. (1972). Practice effects in the
absolute judgment of frequency. Psychonomic Science, 26(4),
222-223.
Heyde, E. M. (1987). Was ist absolutes Hören? Eine
musikpsychologische Untersuchung. München: Profil.
Hornbostel, E. M. v. (1911). Über ein akustisches Kriterium
für Kulturzusammenhänge. Zeitschrift für Ethnologie,
43, 601-615 (Nachdruck S. 207-227 in Erich Moritz von Hornbostel
(1986), Tonart und Ethos, Aufsätze. Leipzig: Reclam
jun.).
Howell, P., Cross, I. & West, R. (1985). Muscal structure
and cognition. London: Academic Press, 338 Pp.
Hulse, S. H. & Page, S. C. (1988). Toward a comparative
psychology of music perception. Music Perception, 5(4),
427-452.
Hurni-Schlegel, L. (1983). Das Absolute Musikgehör: Analyse
von Gehörtestdaten, Bestandesaufnahme bei Absoluthörern,
Lernversuch zum Singen, Stimmen und Hören. Doktordissertation,
Bern: Psychologisches Institut der Universität, 227 Pp.
Hurni-Schlegel, L. & Lang, A. (1978). Verteilung, Korrelate
und Veränderbarkeit der Tonhöhen-Identifikation (sog.
absolutes Musikgehör). Schweizerische Zeitschrift für
Psychologie, 37(4), 265-292.
Klein, M., Coles, M. G. & Donchin, E. (1984). People with
absolute pitch process tones without producing a P300. Science,
223, 1306-1308.
Lockhead, G. R. & Byrd, R. (1981). Practically perfect pitch.
Journal of the Acoustical Society of America, 70(2),
287-389.
Meyer, M. (1899). Is the memory of absolute pitch capable of
development by training. Psychological Review, 6, 514-516.
Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two:
some limits on our capacity for processing information.
Psychological Review, 63(2), 81-97.
Miyazaki, K. (1988). Musical pitch identification by absolute
pitch possessors. Perception & Psychophysics, 44(6),
501-512.
Miyazaki, K. (1989). Absolute pitch identification - effects of
timbre and pitch Region. Music Perception, 7(1), 1-14.
Miyazaki, K. (1990). The Speed of Musical Pitch Identification by
Absolute-Pitch Possessors. Music Perception, 8(2),
177-188.
Miyazaki, K. (in press 1991). Perception of musical intervals by
absolute pitch possessors. Music Perception, 9.
Profita, J., & Bidder, T. G. (1985). Absolutes Gehör --
erblich? Der Spiegel (Hamburg) 39(5) Pp.185 (zitiert nach
Heyde 1987:45).
Rakowski, A. (1972). Direct comparison of absolute and relative
pitch. In Symposium on hearing theory Eindhoven (Holland): Instituut
voor perceptie onderzoek (zitiert nach Barkowsky 1987).
Révész, G. (1913). Zur Grundlegung der
Tonpsychologie. Leipzig: Veit. (Neuausgabe 1946 u.d.T.
Einführung in die Musikpsychologie. Bern, Francke).
Shuter-Dyson, R. & Gabriel, C. (1981). The psychology of
musical ability (2nd edition). London: Methuen.
Siegel, J. A. (1974). Sensory and verbal coding strategies in
subjects with absolute pitch. Journal of Experimental Psychology,
103(1), 37-44.
Siegel, J. A. & Siegel, W. (1977). Absolute identification of
notes and intervals by musicians. Perception and Psychophysics,
21(2), 143-152.
Stumpf, C. (1883/90). Tonpsychologie. Leipzig: Hirzel.
(Nachdruck (1965) Hilversum, Knuf & Bonset ed.).
Szende, O. (1977). Intervallic hearing: its nature and
pedagogy. Budapest: Akadémiai Kiado.
Tautenhahn, B. (1978). Untersuchung zur
Klangfarbenabhängigkeit der Tonhöhenbestimmung bei Personen
mit absolutem Gehör. Schweizerische Zeitschrift für
Psychologie, 35(2), 85-98.
Terhardt, E. & Seewann, M. (1982). Tonartenidentifikation
kurzer Musikdarbietungen. Fortschritte der Akustik, 9,
879-828.
Vernon, P. E. (1977). Absolute pitch: A case study. British
Journal of Psychology, 68(4), 485-489.
Ward, W. D. & Burns, E. M. (1982). Absolute pitch. In D.
Deutsch (Ed.), The psychology of music (Pp. 421-451). New
York: Academic Press.
Wynn, V. T. (1972). Measurements of small variations in "absolute"
pitch. J. of Physiology, 220, 627-637.
Zatorre, R. J. (1989). Intact absolute pitch ability after left
temporal lobectomy. Cortex, 25(4), 567-580.
Inhalt
| Top of Page