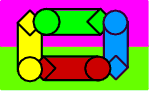Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 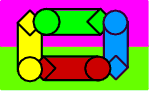 |
Unpublished Lecture Script 1991 |
Die Sekundärsysteme und das Freiheitsproblem | 1991.08 |
@Pers @GenPsy |
76 / 93 KB Last revised 98.12.18 |
Ausschnitt aus einem Vorlesungsskript "Grundfragen Psychologie von aussen her: Entwürfe für ein komplementäres Lernbuch. Allgemeine Psychologie / Spezielle Psychologie " (1990/91) | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt Kommentar 1996
Kommentar
1996:
Die nachstehenden Texte entstammen einem in der Vorlesung 1991
abgegebenen und diskutierten Skript zu einer Vorlesung Grundfragen
der Allgemeinen / Speziellen Psychologie von 1988 bis 1991, welche
eine integrative Sicht dieser Wissenschaft unter Betonung ihres
ökologischen Charakters und in noch rudimentärer Weise
ihres Kulturbezugs anbot. Semiotische Gesichtspunkte sind ebenfalls
erst in ihren Anfängen berücksichtigt. Die hier vorgelegten
Ideen haben überdies noch nicht von den durch Herders Einsichten
gewonnenen Konzeption vom Menschen in der Kultur gewinnen
können, besonders was das linguistische System (vgl.
Besonnenheit) und das Selbstsystem betrifft (vgl.
Humanitätsidee). Der Ausschnitt führt anhand des
Freiheitsproblems in die Begründung sogenannter
Sekundärsysteme ein, deren vier anschliessend in Grundzügen
skizziert werden.
Der Grundgedanke von Sekundärsystemen innerhalb der
psychologischen Organisation im engeren Sinn (also intrapsychisch, in
der Terminologie der semiotischen Ökologie im IntrA-Bereich) ist
einfach. So wie die primäre intrapsychische Organisation, von
den Instinkten bis zu dem, was etwa als Kognitions-, Emotions- und
Motivationssysteme bezeichnet wird, als sekundär zu den direkten
Gegebenheiten der umgebenden Welt verstanden werden kann (im
folgenden aber, unter psychologischer Perspektive, als
Primärsystem bezeichnet), so kann innerhalb dieser
intrapsychischen Organisation, wenn sie in der Phylogenese einen
hohen Differenzierungsgrad erreicht hat, eine sekundäre von
einer primären Funktionsebene unterschieden werden (hier als das
Sekundärsystem bezeichnet).
Das Primärsystem schaft gegenüber dem Weltsystem ein
Minimum an Distanz und relative Unabhängigkeit. Es macht aus
einem passiven und der Umwelt voll ausgelieferten Teil der Welt
etwas, was dieser umgebenden Welt gegenüber auch relativ
widerständig ist, eben lebt und ihren Fährnissen relativ
widersteht. Das Primärsystem schafft zunächst einmal aus
der relevanten umgebenden Welt eine Umwelt dieses Organismus, bzw
dieser Spezies, der er angehört, insofern nur noch eine Rolle
spielt, was sich im Lauf der betreffenden Stammesgeschichte als
förderlich erwiesen hat. Zum Primärsystem gehören u.a.
auch Gestimmtheiten, so dass etwa die Reflexe und Instinktausstattung
das Lebewesen nicht zum reinen Automaten machen, sondern
ermöglichen, dass dieses System gewissen Umständen, inneren
und äusseren gemäss, selektiv funktioniert. Seinen
unermesslichen Wert für das Bestehen einer organismischen
Struktur gewinnt das Primärsystem also, indem es gegenüber
dem Weltsystem selektiv sein kann und mit Erfolg so ist. Es bildet
sich also nicht die Welt eins zu eins ab, sondern macht sich ihr
eigenes, partikuläres Modell davon, sei es zunächst einfach
artspezifisch, in differenzierten Spezies auch zusätzlich
individual-erfahrungsspezifisch. Durch die Verlagerung vieler vitalen
Funktionen auf die Ebene des Primärsystems gewinnt das Tier eine
gewisse Freiheit von seiner Umwelt. Bei Pflanzen und bei Tieren ohne
Nervensystem kann man wohl entsprechende Funktionen nicht oder kaum
finden (ein Minimum davon mag durch humorale Darstellungs- und
Operationssteuerungssystem freilich schon geleistet werden).
Sekundärsysteme verdoppeln genau dieser Verlagerung, indem
vom Primärsystem noch ein zweites Mal eine selektive und klar
unvollständige, dh auch vereinfachende Modellbildung (wie beim
Primärsystem Darstellung der Umgebung zusammen mit den Arten und
Weisen sinnvollen Umgangs mit ihr) vorgenommen wird. Wir haben sie
zunächst im Jargon der Mitarbeitergruppe als
"Partialverdoppelung" bezeichnet. Damit gewinnt das Lebewesen einen
weitergehenden Grad an Freiheit von den unmittelbaren Bedingungen und
überdies so etwas wie Freiheit zu Entwicklungen, die also nicht
als bestehende Einflüsse oder Bedingungen einschränken,
sondern nur als Entwürfe in symbolischen Formen bestehen, aber
als Richtlinien die wirkliche Entwicklung mitbedingen.
In beiden Fällen handelt es sich semiotisch verstanden um
Symbolisierungen, dh eigentlich arbiträre Strukturen, die mit
ihren externen und internen Referenzen aber durch ein Minimum an
ikonischer und indexischer Bezugnahme verbunden sind. Dies legt nahe,
dass im Sekundärsystem mehr als im Primärsystem so etwas
wie Probehandlungen möglich sind und mithin ein Umgang mit
möglichen Zukünften.
Wiederum semiotisch verstanden nehmen die vier vorgeschlagenen
Sekundärsystem bezug auf die Peirce'sche Differenzierung von
Zeichen in ihrem Bezug zur Referenz:
(1) Im bewussten Erleben ist ein primär indexischer Vorgang
zu sehen: das Erleben selektioniert und akzentuiert; es stiftet
primitive Beziehungen zum vorausgehenden und zu bestenfalls einer
Auswahl von nachfolgenden Zuständen. Es gibt keinen
vernünftigen Grund, aus dieser sekundären Funktion, die
wohl in ihrem Ursprung verhältnismässig primitiv ist und
mit Momenten der Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht werden kann.
Ich vermute, dass eine solche Funktion bei den meisten
differenzierteren Tierarten nachzuweisen ist. Inwieweit dies
notwendig mit einer phänomenalen Manifestation von Erleben
verbunden ist, entzieht sich unseren Erkenntnismöglichkeiten.
Der Vorteil dieser Konstruktion ist eben gerade, dass sie eine
strukural-funktionale Konzeption von Erleben anbietet und damit die
Vermischung von phänomenologischer und konstruktiver
Wissenschaft vermeiden kann.
(2) Das phylogenetisch differenziertere Sekundärsystem ist
ikonischen Charakters und kann mit allen räumlich-zeitlichen
Relationen und eben bildhaften Momenten (Anschauungen, Anmutungen
etc.) und mit der Welt der unmittelbaren und gedächtnisbasierten
Vorstellung in Verbindung gebracht werden. Natürlich kann das
Imaginationssystem mit dem Erlebenssystem gekoppelt operieren. Eine
wichtige Frage empirischen Charakters betrifft die synthetisierende
Rolle des Imginationssystem: seine Hauptkategorie dürfte im
Konzept der Ähnlichkeit zu finden sein. Auch mit imaginativen
Sekundärsystemen sind wohl eine ganze Reihe von Tierarten
ausgerüstet.
(3) Nur in wenigen Tierarten finden wir Andeutungen und nur beim
Menschen ein ausentwickeltes linguistisches Sekundärsystem.
Seine Funktionsweise beruht auf der Festigung von symbolischen
Elementen und Weisen ihrer Kombinatorik, wie sie Sprechsprache und
Denksprache vollziehen. Das Sprachsystem ist das symbolische
Sekundärsystem par excellence. Es erweitert die
Möglichkeiten des Spiels mit Modellen, das Als-Ob überhaupt
in ganz beträchtlicher Weise.
(4) Schliesslich scheint die Annahme fruchtbar, das Zusammenspiel
dieser Sekundärsystem, die so vielfältige
Möglichkeiten (Freiheiten) eröffnen mit einem Subsystem zu
ergänzen, dessen besondere Rolle die Lösung von Konflikten
unter den anderen einschliesslich des Primärsystems betrifft.
Nicht dass ich meine, es wäre sinnvoll, die alte Philosophen-
und Theologenvorstellung von der Einheit des Bewusstseins in einem
Selbst-Sekundärsystem wiederaufleben zu lassen. Allzusehr ist
eine solche Vorstellung mehr Wunsch als Wirklichkeit. Und doch kann
das gesamte Sekundärsystem seine Aufgabe nur erfüllen, wenn
es allzu weitgehende Differenzierungen und Eigenständigkeiten
seiner Teile zu mildern nach erfülltem Exzess wieder in
einheitlichere Bahnen zu leiten versteht. Das Selbstsystem ist
demnach eher als eine syntaktisch-pragmatischer Regulationsweise
über alles zu verstehen, denn als eine direkter semantische
Bezugnahme auf etwas.
(Herbst 1996)
Inhalt
1. Freiheit -- Wie
gewinnt der Mensch jene gelebte und erlebte Freiheit des
Entscheidenkönnens, des eigenen, willentlichen
Handelns?
1.1. Freiheit bei Tier und
Mensch
Der Funktionskreis und Binnenstruktur der psychischen
Organisation, wie sie bisher beschrieben wurden, können so oder
ähnlich für alle höher organisierten Lebewesen,
insbesondere Wirbeltiere konstruiert werden. Neben dem Menschen denke
man an die meisten Säugetiere, insbesondere an die sog.
Menschaffen, aber auch an Fische und Vögel, ja in gewisser
Hinsicht auch an Reptilien, Amphibien und sogar an
Gliederfüssler, insbesondere Insekten, kurz an alle
Tierstämme, die über ein differenzierteres Nervensystem
verfügen. Zumindest die gestellten Fragen, aber auch ein Teil
der Antworteversuche - vielleicht mit Ausnahme der Erwägungen
zur Ganzheitlichkeit (Person) - sind gültig. Bei der
zwischenartlich vergleichenden Psychologie wird darauf zu verweisen
sein. (Für Überblick: Eibl-Eibesfeldt 1980, Hinde
1966).
Beobachtet man Tiere, so kann man sich dem Eindruck der recht
strikten Regelhaftigkeit ihres Verhaltens, gemischt mit einem Schuss
Zufälligkeit, umso weniger entziehen, je ursprünglicher in
der Phylogenese die betreffende Art anzusiedeln ist. Umgekehrt
attribuieren wir bei höheren Tieren, zumindest in gewissen
Lebenssituationen, eine gewisse Lösung von solchen Automatismen
des Verhaltens, die uns umso stärker beeindrucken können,
je mehr wir mit einem bestimmten Tierindividuum vertraut geworden
sind (man vergegenwärtige sich gewisse Verhaltensweisen seines
Hundes, seiner Katze, seines Pferdes, gewisser Vögel usw.).
Möglichkeiten des Treffens "freier" Entscheidungen schreiben wir
traditionell ausschliesslich unserer eigenen Art zu, ohne freilich
deren Bedingungen ausreichend zu verstehen.
Während früheres Nachdenken über Freiheit von der
Setzung eines scharfen Schnittes zwischen Mensch und Tier bestimmt
war - für Descartes war das Tier eine Maschine, für die
meisten religiös bestimmten Welt- und Menschenbilder war nur der
Mensch ein beseeltes Wesen - sind wir heute bereit, einen viel
fliessenderen Übergang anzunehmen. Hier steht aber nicht die
Frage der Schärfe des Schnittes oder des Unterschiedes zwischen
Mensch und Tier zur Diskussion; es gibt sowohl Unterschiede wie
Gemeinsamkeiten. Vielmehr wollen wir unsere Konstruktion der
psychischen Organisation mit Bestandteilen zu ergänzen
versuchen, die den angedeuteten Tatsachen einer gewissen Freiheit des
Entscheidens Rechnung tragen können. Freiheit heisse
zunächst nicht mehr, als dass Entscheidungen oder Handeln uns
weder rein zufällig noch voll determiniert erscheinen,
wofür wir gerne eine Erklärung hätten.
Inhalt
1.2.
Freiheit nur eine Täuschung?
Bevor wir die Frage als Sachverhaltsfrage behandeln, sollten wir
uns mit der Möglichkeit kurz beschäftigen, dass das
Erscheinungsbild der Freiheit bloss ein Ergebnis einer bestimmten
Wahrnehmungsbeschränkung darstellen könnte. Wenn wir
von einer Erscheinung die Ursache(n) nicht ausfindig machen
können oder nicht zur Verursachungsattribution an eine fiktive
Instanz bereit sind, sprechen wir heute idR von "Zufall".
Spätere Kenntnis der notwendigen und hinreichenden Ursache(n)
ersetzt diesen vorläufigen Erklärungsversuch augenblicklich
durch einen Determinismus (oder eine engere
Wahrscheinlichkeitsbeschreibung, soweit Messfehler,
Störfaktoren, etc. einbezogen werden müssen). So gesehen
wäre nicht auszuschliessen, dass die Wahrnehmung von Freiheit
ihren Ursprung eher in uns selbst und nicht so sehr in unserem
wirklichen Verhältnis zur Welt hätte.
Von Freiheit des Handelns und Entscheidens zu reden, meint aber
wohl auch etwas ausserhalb dieser simplen Dichotomie des Erkennens
zwischen determiniert und zufällig. Es ist eine
Charakterisierung, die nur Lebewesen, insbesondere eben Menschen,
zukommen kann, und die wir in letzter Konsequenz nur dann beiziehen
(sollten), wenn wir eigentlich alle in Frage kommenden Bedingungen
für zwei oder mehr Alternativen des Handelns zu kennen glauben
und alles dafür spricht, dass keine der Alternativen
gegenüber irgendeiner andern zum vornherein irgendwelche
Bevorzugung aufweist. Wenn wir einen Menschen unter solchen
Umständen eine Option wählen sehen, ohne bei voller
Kennntnis aller relevanten Bedingungen seine Wahl vorhersagen
zu können, nur dann sollten wir von Freiheit sprechen.
Es ist offensichtlich, dass diese Bedingung der Kenntnis aller
relevanten Bedingungen in Realität des Lebenden oder des
Psychischen nie zutrifft, und damit ist die Fage, ob es
überhaupt Freiheit gibt, faktisch nicht beantwortbar.
Praktisch bedeutsam ist dann vielmehr die Tatsache, dass es nicht
möglich ist, alle relevanten Bedingungen zu kennen. Dadurch
wäre Freiheit, praktisch gesehen, durchaus eine Tatsache,
obwohl theoretisch Determiniertheit bestehen könnte.
Inhalt
1.3.
Freiheit und Verantwortung
Anderseits können wir den Begriff und die Möglichkeit
von Freiheit nicht aufgeben, wenn wir nicht eine entscheidende
Bedingung des menschlichen Zusammenlebens zugleich aufgeben wollen,
nämlich die Idee der Verantwortlichkeit. Nur dann wenn
wir dem Andern (und uns selber) zugestehen, dass sein Handeln nicht
aus einem Automatismus bestimmt war, können wir uns erlauben,
ihn (uns) für sein Handeln zur Rechenschaft zu ziehen, sei es,
indem wir unerwünschtes (?) Handeln mit Schuldhaftigkeit in
Verbindung bringen und/oder dafür Strafen androhen und
Sühne fordern, sei es, dass wir erwünschtes Handeln loben,
belohnen, als Vorbild bewerten. Im Rechtswesen der meisten
Gesellschaften gibt es dafür implizite oder explizite Setzungen
und Ausführungsregeln. Es ist leicht zu sehen, dass aus dem
Verantwortlichkeitsprinzip die Forderung der Tatsache von
Freiheit abzuleiten ist. Im Anschluss an die Frage nach der
Täuschung über Freiheit müssen wir also die Frage
offenlassen, ob Freiheit eher als eine Tatsache oder eher als
postulierte Voraussetzung einer Lebensform in einer Gesellschaft zu
betrachten sei. Für die gelebte und erlebte Wirklichkeit ergibt
sich daraus freilich kein Unterschied. Wer sich umbringen kann, ist
wirklich frei, ob er es tut oder nicht (vgl. etwa Carl Amérys
Essay "Hand an sich legen")
Vielleicht ist es gut, Freiheit begrifflich in drei konzentrischen
Kreisen zu sehen: (a) Anthropologisch beschreibt Freiheit eine
(von mehreren möglichen) Grundverfassung von Lebewesen;
(b) empirisch-wissenschaftlich (biologisch-psychologisch) meint sie
ein bestimmtes (angeborenes oder erworbenes) Verhältnis des
Lebewesens zu sich selbst, nämlich ob es wollen muss oder
wollen kann; (c) praktisch oder aus der Sicht seiner Umwelt ist sie
die Möglichkeit eines Lebewesens, das zu tun oder zu lassen,
was es will. (In Anlehnung an Hist. Wb. Philo.) In unserem
Zusammenhang ist primär der zweite Kreis des
Wählenkönnens angesprochen.
Es gibt viele Lebensbereiche, wo solche Wahlfreiheit und die
zugehörige Verantwortlichkeit alltäglich und trivial sind.
Es kann sein, dass anhand trivialer Beispiele, wie sie manche
Philosophen anylsieren und zu Ende denken, das Entscheidende im
Hinblick auf eine gültige Ethik herausgeschält werden kann.
Anderseits ist nicht zu übersehen, dass verschiedene menschliche
Gesellschaften gerade im Umgang mit wesentlichen Freiheiten und
Verantwortlichkeiten starke Unterschiede zeigen. So ist etwa die
Bewertung des Lebens und des Tötens von Menschen,
Angehörigen der eigenen Gesellschaft und Fremden, oder von
Tieren, unter diesen oder jenen Umständen, sogar innerhalb einer
Kultur, oft einem erstaunlich starken Wandel unterworfen. Man denke
etwa in unserer Kultur an den Wandel in der Bewertung der
Selbsttötung, einem Feld, wo vielleicht die Bedeutung der hier
untersuchten Freiheitsfrage am allerdeutlichsten erkennbar ist.
Inhalt
1.4.
Freiheit als Erlebnis
Es ist jedoch nicht üblich, die Freiheit als eine
Konstruktion zu erschliessen aus dem Artenvergleich, aus der
praktischen Unmöglichkeit ihrer Widerlegung oder aus ihren
tatsächlichen gesellschaftlichen Konsequenzen. Freiheit wird
nicht nur gelebt, sondern von Individuen vor allem andern
erlebt. Eher wahrscheinlich ist also, dass die Idee von
Freiheit ihrem Erleben entprungen ist. Insofern kann sie als eine
erklärungsbedürftige Erscheinung verstanden werden. Auch
wenn wir uns nicht auf direkte Erlebnisberichte verlassen wollten,
müssten wir aus Tatsachen des Verlustes von Erlebnisfreiheit
schliessen, dass hier ein Sachverhalt in der psychischen Organisation
die Aufmerksamkeit unserer Rekonstruktionstätigkeit verdient. Es
scheint sogar, dass Freiheit und Erleben in intimer Weise miteinander
verbunden sind. Das ist daraus ersichtlich, dass es
verhältnismässig selten Menschen (in Zuständen) gibt,
welche aussagen, dass ihr Erleben durch eine fremde Instanz bestimmt
wird, für sie gemacht wird, nicht mehr in ihrer eigenen
Willkür liegt. In den meisten Fällen wird das von den
Betreffenden selbst sowie von Dritten als ein abnormer Zustand, oft
mit Ängsten verbunden, als dysfunktional in den Bereich des
Pathologischen eingeordnet.
Auch gibt es Verwirrtheitszustände, in denen Individuen
für einen Beobachter verhältnismässig funktional
handeln, gemäss ihrem eigenen Bericht aber keine oder nur eine
verminderte Kontrolle mehr über sich selbst ausüben
konnten. Solche Zustände werden denn auch in Rechtsverfahren
anerkannt; sie rechtfertigen als "verminderte
Zurechnungsfähigkeit", sei sie aktuell oder chronisch, eine
teilweise oder gänzliche Entlastung von Verantwortlichkeit.
Recht viel häufiger gibt es Zustände, die Personen als
ungewöhnliche Veränderungen ihres eigenen Erlebens
beschreiben. Es hat sich dafür der Ausdruck veränderte
Bewusstseinszustände eingebürgert. Solche Zustände
erscheinen nach Einnahme von gewissen Substanzen (nach ihrer Wirkung
unter den Sammelnamen "psychotrope Drogen" klassififziert) aber auch
nach etwas ungewöhnlichen körperlichen Betätigungen,
so zB Hyperventilation, starke Ermüdung, extreme
körperliche Anstrengungen (wie Dauerlauf) oder geistige
Konzentration (wie Meditation, etc.) oder sensorischen
Sonderbedingungen (wie Überstimulation, andauernde
Unterstimulation oder Deprivation). Diese Bedingungen solcher
Erscheinungen zeigen, dass jedenfalls auch das Erleben einer
biologisch-somatischen Grundlage bedarf (vgl. Biol).
Die skizzierten Erscheinungsformen legen die
Verallgemeinerung nahe, dass diese Bedingungen zunächst geeignet
sind, den Erlebnisstrom in geringerem oder stärkerem Ausmass
nach Tempo und Verschiedenheit der Bewusstseinsinhalte zu
intensivieren und dabei auch das Gefühl einer Erhöhung der
Eigenkontrolle des Stroms zu vermitteln. Nicht selten schlägt
jedoch dieses eigene Kontrollgefühl um in Ohnmacht und den
Eindruck, der Erlebensstrom mache sich selbständig. Das mit
weniger extrem veränderten Bewusstseinszuständen oft
verbundene Glücksgefühl macht dann einer
Bedrohtheitserfahrung, Angst, Panik, etc. Platz. Dass es dabei bei
vielen Menschen (und möglicherweise in einigen Lebensphasen der
meisten Menschen) um äusserst starke, wichtige, existentielle
Selbsterfahrungen geht, zeigen die Folgeerscheinungen von
gehäuftem oder wiederholtem Herbeiführen solcher
Zustände; Stichwort: Süchte.
Vergleichbare, jedoch normalerweise nicht eigentlich
angstverbundene, Zustände sind freilich alltäglich auch
ohne toxische Vorbedingungen. So gibt es Berichte und Beobachtungen
über Tagträume oder gewisse Gruppenerfahrungen
(Intimgruppen oder Massen): Zustände, die ebenfalls zwischen
Eigen- und Fremdkontrolle des inneren Geschehensstromes (und manchmal
auch des äusseren) oszillieren. Vergleichbar sind auch die
Berichte über die Schlafträume (aber auch
Alpträume, Schlafwandeln, etc.), deren Verlauf sich der
Kontrolle entzieht, und die deshalb auffallen, weil wir im
Normalzustand in so hohem Masse den Eindruck der Steuerbarkeit von
Erleben und Handeln haben.
Bedeutsam ist noch die Festellung, dass die
Funktionalität des Handelns (also die Möglichkeit,
das Verhalten zielgerecht und wirklichkeitsangepasst zu vollziehen)
in solchen veränderten Bewusstseinszuständen für einen
Beobachter von aussen oft erstaunlich wenig beeinträchtigt
erscheint (zb unter dem einfluss von sog. psychoaktiven Drogen).
Allerdings ist das eine Frage des Grades; und zweifellos findet eine
Labilisierung statt, welche den Handlungsstrom insbesondere an
heiklen Stellen gefährdet (wo Routinehandlungen nicht
ausreichen, wo rasche und adäquate Entscheidungen verlangt
werden) und damit zu einem Risiko für Betroffene und ihre
Umgebung macht.
Inhalt
1.5.
Wie steht das Erleben von Freiheit zur Freiheit?
Im vorausegehenden Abschnitt dieses Kapitel wurde auf das Erleben
als eine Wurzel der beanspruchten Freiheit hingewiesen. Befragungen
dazu zeigen einen eigenartigen Widerspruch. M.R. Westcott (1982,
Quantitative and qualitative aspects of experienced freedom. Journal
of Mind and Behavior 3 99-126) hat Personen Situationsbeschreibungen
vorgelegt mit der Bitte, Aussagen über den Grad der in solchen
Situationen erlebten Freiheit zu machen. Das berichtete
Freiheitserleben scheint dann am stärksten, wenn man aus einer
Situation von Zwang (Schmerz, Versagung) befreit wird oder wenn man
eine erlernte Fertigkeit ausüben kann. Beides sind
paradoxerweise Bedingungen hoher Determination, im ersten Fall aus
der Situation, im zweiten aufgrund von eigener Begabung und
früherer Übung. Anderseits wird am wenigsten Freiheit
erlebt, wenn man vor besonders schwierigen Entscheidungen steht
Im Gegensatz zu diesen Innensichten attribuieren wir Andern dann
die grösste Freiheit, wenn sie eine Wahl zwischen gleichwertigen
Optionen getroffen; denn wenn eine der Optionen vor der oder allen
anderen einen für den Wählenden wesentlich günstigeren
Erwartungswert gezeigt hätte, müssten wir ja sagen, dass er
nur dem Wertgefälle gefolgt sei. Der Wählende selbst jedoch
fühlt sich dann am freisten, wenn er es fertiggebracht hat, eine
Option gegen alle "Vernunft" zu wählen; das wiederum wird von
der Reaktanztheorie als hochdeterminierte Reaktion auf bedrohte
Wahlfreiheit beurteilt. Die Widersprüche lassen sich beim
gegenwärtigen Stand der Forschung nicht auflösen.
Inhalt
1.6.
Freiheit als Systematik
Die vorstehend beschriebenen Sachverhalte über Freiheit sind
durch die bisherige Konstruktion des Funktionskreises (die
psychologischen Grundfunktionen Wahrnehmung,
Gedächtnis, Handeln) und der differenzierten
Binnenstruktur der psychischen Organisation (Kognition,
Motivation/Emotion, Lernen, Aufmerksamkeit)
nicht abzudecken. Denn wir stehen unter dem Eindruck, dass die
geschilderten Erscheinungen, egal ob von aussen oder von innen
betrachtet, einer vollständigen Regelhaftigkeit eines
"durchkonstruierten" Gebildes nicht gerecht werden.
Es ist immer wieder versucht worden (zB in algorithmischen
Modellen psychischer Funktionen) solchen Abweichungen von
Determiniertheit durch Einführung des Zufallsprinzips
Rechnung zu tragen. In der Tat ist es so, dass geregelte,
sollwertbestimmte Systeme, wenn sie durch zufällige
Einflüsse (von aussen oder als systemeigenes "Rauschen") eine
Zustandsänderung erfahren und diese dann als Folge ihrer
Rückkoppelungskreise auszuregulieren vermögen, einem
Betrachter in oft erstaunlichem Masse als lebensanalog oder
handlungsanalog verstanden werden (Beispiel: Homeostat von R Ashby,
ein wegfindender Roboter).
Sollwertbestimmte Regelsysteme sind eine Vorstellung, die sich in
geweissen Teilen der Psychologie (Sensorik, Motorik, Lernen,
Motivation, Handeln, etc.; vgl. etwa Bischof 1985, Klix 1971) einer
grossen Beliebtheit erfreuen. Ich bin nicht sicher, dass sie der
vorstehend exemplarisch geschilderten Freiheitsproblematik gerecht
werden können. Die Frage, woher die Sollwerte kommen und
ihrerseits Veränderungen erfahren, lässt sich nämlich
in dieser Konzeption nicht beantworten (es sei denn man lasse den
unendlichen Regress zu oder hole sie von aussen her herein). Was in
abgegrenzten Teilbereichen (Beispiele: räumliche Zielfindung,
Handeln in industrieller Arbeitsorganisation) sehr stimmige und oft
sogar anwendungsbereite Modelle ergibt, hat in einem so komplexen
Gebilde wie der psychischen Gesamtorganisation möglicherweise
heuristischen Wert; es besteht aber auch ein Risiko der
Horizonteinengung, Dem möchte ich aus dem erwähnten Grund
der Sollwertfrage entgehen, indem ich vorderhand ein eher
"lockeres", in gewissen Aspekten nur kybernetik-analoges
System-Denken vorziehe.
Wenn ich jetzt beispielhaft etwa an einen Lebenslauf eines
Menschen von aussen beobachtend und synthetisierend denke und mit
demjenigen etwa eines Pferdes oder Hundes vergleiche, so lassen sich
allgemein einige Ähnlichkeiten und eine Verschiedenheit
festhalten. Beide erscheinen einem Betrachter als eine Art Gestalt,
insofern wohl die grösste Zahl wenn nicht alle manifesten
morphologischen und verhaltensmässigen Erscheinungen irgendwie
zueinander passen, ein Ganzes bilden. Weitaus das meiste davon mag
als arttypisch charakterisiert werden; vieles beschreibt in
seiner Gesamtheit auch das individuell Charakteristische, dh
der Beobachter kann aus einem Teil des beobachteten Verhaltens etwa
überzufällig zutreffende Vorhersagen über das
Verhalten zu anderen Zeitpunkten des Lebenslaufes machen. Beide Typen
von Lebensläufen sind aber in ihrem Verlauf auch von einer
grossen Zahl von "Zufälligkeiten" bestimmt, insofern das
Milieu, in dem sich das Lebewesen aufhält, in seinen
Einflüssen auf das Individuum nur zu einem Teil von dem
Individuum selbst bestimmt ist. Beide Typen entwickeln jedoch auch
Präferenzen und Gewohnheiten für und
innerhalb eines einmal wirksamen Milieus, welche wiederum mit zu der
charakteristischen Gestalt gehören.
Worin ich nun jedoch einen Unterschied sehen möchte, ist die
Beobachtung, dass bei vielen Menschen, von einem gewissen
Alter nach der ersten Kindheit an jedenfalls, solche Gewohnheiten und
Präferenzen zunehmend eine gewisse Systematik erreichen,
die sich von derjenigen beim Tier deutlich unterscheidet. Es kann
offen bleiben, ob der Unterschied kategorial oder graduell sei.
Persönlich halte ich ihn eher für graduell, weil Menschen
interindividuell und über Altersstufen auch recht sehr
variieren; aber denoch recht massiv, weil er geeignet ist, doch ganz
andere Lebensläufe und Gesellschaften hervorzubringen.
Es scheint nämlich dass der der Kindheit entwachsene Mensch
in geringerem oder stärkeren Ausmass dazu übergeht,
verschiedene Erfahrungen seines Lebens untereinander in Beziehung zu
setzen, Lebensentwürfe zu prüfen und zu machen und
miteinander zu vergleichen, diejenigen anderer Personen, aber auch
einfach mögliche, fiktive, ausgedachte Lebensentwürfe, und
dann solche verschiedene Entwürfe untereinander vergleichend zu
bewerten, Handlungen im Hinblick auf solche Entwürfe zu
vorzuziehen bzw. zu vermeiden. Kurz der (mündige) Mensch bringt
eine eigene Systematik in sein Leben, die paradoxerweise eine
(selbstgewählte) Verminderung der aktuellen Freiheit des
Handelns zur Folge haben kann, gleichzeitig aber die Freiheit,
nämlich als Entscheid für einen bestimmten Entwurf, umso
stärker betont. Denn hat man gewählt, ist das Andere
(Boesch 1989) ausgeschlossen. Kurz, man kann einen Lebensentwurf und
das daraus bestimmte Handeln etwas widersprüchlich als eine
Systematik der eigenen Freiheit bezeichnen.
Nun lässt sich wohl eine solche Beschreibung leichter auf
innere Beobachtung von mir selbst und auf die Deutung von verbalen
Berichten anderer abstützen als auf Beobachtung von aussen.
Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass Lebensentwürfe und ihr
Vollzug stabilere und labilere Phasen aufweisen, was sich in
Verhalten rasch erkennbar macht (vgl. Entw); und besonders deutlich
wird eine solche Betrachtungsweise gestützt durch Erscheinungen
im Zusammenhang mit eigentlichen Brüchen in den Entwürfen.
Was ich hier vielleicht etwas umständlich am Beispiel
Lebensentwurf beschreibe, ist in der Psychologie vielfach unter
Bezeichnungen wie Identität, Selbstfindung,
Identitätsbruch, etc. untersucht worden. Die Literatur dazu ist
immens und reicht von der Verleugnung des Sachverhalts als
psychologisches Problem (zB Skinner) bis zu religiös oder
esoterisch gestimmten Fantasmen und Mythen (zB Jung); einen
Überblick bietet Wylie 1974/79; vgl. unten). Den Vorzug meiner
Perspektive auf den Sachverhalt von der Freiheit her sehe ich darin,
dass sie mich näher an möglich Prozessvorstellungen
über das Selbst führt und zudem leichter auch andere,
über die Grundfunktionen hinausreichende Erscheinungen in die
Konstruktion einbeziehen lässt (vgl. die nachfolgenden vier
Unterkapitel zu R).
Inhalt
1.7.
Reflexivität oder das Prinzip der sekundären
Repräsentation
Gesucht ist also eine Konstruktion, welche im Rahmen des bisher
allgemeinpsychologisch dargestellen Funktionen-Insgesamts, das
offenbar grundsätzlich zum Verständnis einfachen Lebens
(von Tieren, von kleinen Kindern) ausreicht, eine Art
Überbau darstellt. Wir brauchen einen solchen
Konstruktinsteil, wenn wir den Tatsachen der Freiheit und ihrer
Systematik (um es so paradox auszudrücken wie es uns
erscheint) gerecht werden wollen. Für Viele beginnt allerdings
die Psychologie überhaupt erst hier. Auf dem Hintergrund meines
Wissenschaftsverständnisses brauche ich nicht weiter zu
begründen (vgl. Meth), warum ich eine solche Abtrennung von
Sachverhalten aus einem Ganzen für ebenso verhängnisvoll
halten würde wie die in der akademischen Psychologie zu
beobachtende Vernachlässigung der gegenwärtigen
Thematik.
Gehen wir davon aus, dass über die Lebensspanne eines
Individuums zwischen W und H ein überdauerndes aber dynamisches
Gebilde laufend differenziert und aufgebaut wird, aus welchem unter
Zufluss der aktuellen Wahrnehmungsinformation alles Handeln, alle
weitere Entwicklung und auch die Aufmerksamkeitskontrolle der
Wahrnehmung bestimmt sind, so bleibt hier kein Platz für
Freiheit im beschriebenen Sinn. Zufälligkeit kann mitspielen im
Sinn von "Systemrauschen" und von teilweiser Arbitrarität der
Begegnungen des Individuums mit dieser oder jener
Weltoberfläche.
Jedenfalls haben wir uns die Konstruktion der allgemeinen
psychologischen Organisation gerade so gemacht; alles andere, auch
wenn es möglicherweise wirklichkeitsgerechter wäre,
würde unsere wissenschaftliche Zielsetzung in Frage stellen.
[In Klammer möchte ich anfügen, dass ich seit kurzem in
der semiotischen Begrifflichkeit eine Möglichkeit vermute, auch
schon die Grundfunktionen der allg. Psychologie etwas weniger
biologistisch als bisher zu behandeln und vielleicht mehr
"Freiheitsgrade" schon dort einzuführen ohne an
Begründbarkeit aufzugeben. Wohin das führt, ist derzeit
nicht abzusehehen, so dass ich hier zunächst die näher an
der psychologischen Literatur angesiedelte
Grundfunktion-Überbau-Konstruktion weiterführe.]
Die Frage bleibt also, wie das System die beobachtete
systematische Freiheit gewinnt. Meine formelhafte Antwort im Rahmen
unserer Konstruktion: indem die kognitive Struktur (G oder
Gedächtnis im erarbeiteten Sinn) in Teilen dupliziert und mit
dem Original in Relation gesetzt wird. Sie ist im
folgenden zunächst allgemein zu erläutern und soll
anschliessend in 4 Unterkapiteln näher in ihrem
Erklärungspotential aufgezeigt werden.
Allen oben stellvertretend für ein weites Feld beschriebenen
Sachverhalten von Freiheit un dihrer Systematik scheint mir diese
Idee gemeinsam: sie setzen G (einschliesslich K, M, L, etc.)
voraus und sie sprengen G. Wollen wir nicht aufgeben, G als
einen determinierten Komplex zu verstehen, in welchem alle Teile zu
einem bestimmten Zeitpunkt so sind wie sie sind, weil sie von anderen
Teilen des Komplexes her eindeutig bestimmt sind und ihre
Veränderung in der Zeit nur durch Beeinflussung der Teile des
Komaplexes untereinandere untereinander (K, M) sowie durch neuen
Input von den wahrnehmenden Teilsystemen her (W, A, L) bedingt sein
kann, so hat Freiheit nur den sehr beschränkten Platz in der
Konstruktion, der auf dem Weg über Input von aussen erzielt
werden kann. Ja, unter diesen Umständen wäre sogar
fraglich, ob nicht über die Selektivität der A-Funktion
alle Neuheit von Input ausgeblendet werden könnte. Wir
dürfen ja nicht vergessen, dass die M-Funktion in ihrer
aktivierenden Wirkung Postulat-Charakter hat, obwohl biologisch gut
erläutert, psychologisch nur wenig präzis begründbar
ist.
Die Einschränkung entfällt, wenn sich Teile der
kognitiven Struktur relativ selbständig von andern Teilen
absetzen können, ohne ihre Beeinflussbarkeit von diesen andern
Teilen und ihre Beeinflussung anderer Teile ganz aufzugeben. Die
Situation ist strukturgleich mit unseren Überlegungen zur
relativen Autonomie des Individuums von der umgebenden Welt
insbesondere im Zusammenhang mit W und G. Der Grundgedanke war dort:
wenn das Individuum mittels W Information (der Organismus Stoffe und
Energie) aus der Welt speichern (G) kann und so auch mit
räumlich oder zeitlich nicht aktuell wirkenden Umweltteilen,
gewissermassen in absentia und ohne ständigen
Realitätsdruck, "umgehen" kann (K, M), dann gewinnt es
Selbständigkeit in (von) seiner Umwelt und kann sie wahren, wenn
es zugleich ausreichend realtitätsgerechte Bezüge (W, L)
zur umgebenden Welt aufrechterhält und auf Halten und Sichern
sowohl der Eigenständigkeit wie der Bezogenheit
orientiert bleibt (M, A, P).
G ist also, so verstanden, mit Ausnahme des (in jedem Augenblick
nur kleinen, in der Akkumulation aber nicht unbeträchtlichen)
Inputflusses die Bestimmende des ganzen psychischen Geschehens. Das
im Bezug zur Umgebung erfolgreiche Rezept des Autonomiegewinns
innerhalb der psychischen Organisation wiederholen heisst: baue
eine Substruktur auf und grenze sie vom Rest des System einigermassen
(relativ) ab und repräsentiere mit dieser Substruktur
ausgewählte Aspekte der Gesamtstruktur. Lasse allen Input
zunächst in das Primärsystem G etc. und übernehme
dann, sei es aus aktuellem Input, sei es aus dem älteren
Primärsystem, Einiges in diese neue Sekundärstruktur. Es
kann sein, dass du für gewisse Bereiche die Primärstruktur
entlasten bzw. ihre Funktionalität verbessern kannst, wenn du
gewisse Inhalte und Formen ausschliesslich im Sekundärsystem
behältst und unter gewissen Umständen das Primärsystem
als ein dem sekundären untergeordnetes Basis- und
Exekutivstruktur führst. (Wenn du das Primärsystem vom
sekundären her allerdings zu seinem Nachteil überlisten
willst, musst du es recht trickreich anstellen.) Du musst für
das Sekundärsystem Formen der Speicherung und
Inbeziehungssetzung oder Komplexbildung von Inhalten aus dem
Primärsystem herausentwickeln, welche denjenigen im
Primärsystem zwar affin sind aber vielleicht in der
Spezialiserung weitergehen. Welche Inhalte zu übernehmen sind,
weisst du anfänglich nicht; aber ähnlich wie beim Erringen
der Primärstruktur, wird sich aus seiner Bewährung auf die
Dauer schon ergeben, was du brauchen kannst und was nicht. Lasse im
Prinzip im Sekundärsystem die gleichen Funktionsprinzipien
spielen, die im Primärsystem erfolgreich waren, dh benutze ein
gleiches Neuronal-/Humoralsystem als Informationsträger und
stelle dich auch im neuen Teilsystem auf eine eigene Mischung von
Festigkeit und Wandel ein. Das sichert die wichtige Relation zwischen
Primär- und Sekundärsystem, auch wenn du vielleicht neue
Strukturen (Grosshirn) analog den bisherigen (Stamm-, Mittelhirn)
aufbauen musst.
Man verzeihe mir den stilistischen Trick mit dem Aufbau-Rezept und
den physiologischen Konkretisierungen, der mir die Formulierung etwas
erleichtert hat. Sie sollte auch deutlich machen, das die
Sekundärstruktur nicht etwas Neues, von der primären
Separates sein kann; sie baut darauf auf und ist von der
gleichartiger, wenngleich ergänzter Natur. Die Unterteilung in
Primär- und Sekundärstruktur ist Ergebnis unseres
trennenden Denkens. Natürlich muss man sich einen langdauernden
bioevolutiven Prozess in der Stammesgeschichte der
menschlichen Art vorstellen, der mit der Herausbildung des Grosshirns
und damit sowohl morphologisch wie funktionell-inhaltlich mit den
Lebenstätigkeiten Nahrungserwerb, Artgenossenkommunikation etc.)
zusammenhängt: nämlich Befreiung des Mundes von
Manipulationsverhalten durch dessen Verlagerung auf die
Vorderextremitäten und die damit verbesserte "Bearbeitung" der
Umgebung durch Herstellen von Werkzeugen, räumlichen Strukturen,
Kultzeugen etc. sowie die Herausbildung des Sprechens und parallel
dazu die Spezialisierung der Füsse für aufrechten Gang und
der damit mögliche Aus"bau" des Hirnschädels mit der
Ausweitung der Möglichkeiten von G vor allem in kognitiver
Hinsicht. (Faszinierende Lektüre dazu: Leroi-Gourhan
1964/65).
Nebenbei: im ökologischen Bezug werden wir bei der
Kulturpsychologie die relative Verdoppelungsidee ein drittes
Mal einsetzen, bzw. ein viertes Mal, wenn wir annehmen, dass bereits
die Genomstrukturen aller Organismen nichts anderes sind als eine
"Verdoppelung" der Umwelt der betreffenden Art, nämlich in der
indirekten Form von "Rezepten", wie Strukturen (Organismen und ihr
Verhalten) aufzubauen seien, welche ein Chance haben, die
Genomstruktur zu reproduzieren. (Vgl. dazu etwa Dawkins 1976; Klopf
1982). Solche relative Verdoppelungen finden sich in Strukturen wie
(1) Genom und (2) Gedächtnis (von artgemäss und
erfahrungsgemäss relevanten ausgewählten Aspekten der
umgebenen Welt), (3) Reflexive Sekundärstruktur von
ausgewählten Aspekten von G, und schliesslich (4) in der
menschlichen Kultur als einer externen raum- und
zeitübergreifenden Konkretisierung von ausgewählten
Aspekten von G und R.
Bezeichnen wir das dritte, hier interessierende individuumsinterne
partielle Duplikat von G als sekundäres
Repräsentationssystem mit dem Kürzel R oder
Reflexivität. Die Benennung gilt im mehrfachen Wortsinn:
R reflektiert, dh widerspiegelt oder bündelt vermutlich manche
Eigenschaften von G; R entspricht aber auch dem Wortsinn des
"Reflektierens" als Nachdenken über, Abzielen auf etc.; und
schliesslich birgt die Bezeichung möglicherweise manches von
dem, was die Grammatiker als Reflexivität oder
Selbst-Rück-Bezug bei Verben und Pronomen gefasst haben.
Inhalt
1.8.
Freiheit und Reflexivität
Hier (oder eher am Schluss?) sollte eingehender gezeigt werden,
wie das Partialverdoppelungsprinzip das Freiheitsproblem allgemein
löst. Rolle von Zeit und Raum! Derzeit kann die folgende
beispielhafte Überlegung die vorgeschlagene Relativierung (nicht
seine Aufhebung!) des Determinismusprinzips vielleich
nachvollziehbarer machen.
Man muss das Notwendige (was den Gesetzen gehorcht und
somit nicht anders ablaufen kann, als die Gesetze zulassen) und das
Tatsächliche (was den Gesetzen entsprechend dann und dort
abläuft) unterscheiden. Wenn ein Chemiker eine Reaktion in Gang
bringt, gehorcht die Reaktion den Naturgesetzen; aber wann und wie,
weshalb und mit welchen Folgen sie in Gang kommt, beruht auf dem
Eingreifen des Chemikers. Entsprechend gehorchen alle im Hirn
ablaufenden Prozesse physiko-chemischen Gesetzmässigkeiten; wann
und wo im Hirn welche von den möglichen tatsächlich
vorkommen, ist aber nicht mehr Sache dieser Gesetzmässigkeiten
allein, sondern auch der dann gegebenen, historisch gewordenen, und
wirkenden Bedingungen.
Die Tatsache der Geschichtlichkeit von allem, was wir antreffen
können, ist in den Naturwissenschaften bis vor kurzem einfach
übersehen worden. Derzeit ist ein starker Wandel im Gang. Die
sog. Chaos-Theorie ist eine von mehreren Zugangsweisen, wie man der
Geschichtlichkeit auch bezüglich des Kosmos und der
nichtlebenden Natur gerecht zuwerden hofft. Im Bereich des Lebendigen
ist Geschichtlichkeit mit der Evolutionstheorie natürlich
präsent; aber die Prozesse in und zwischen den Zellen sind nur
ausnahmeweise so betrachtet worden. Natürlich ist
Geschichtlichkeit noch nicht gleichbedeutend mit Freiheit; aber es
besteht ein Zusammenhang. Das Verhältnis der verschiedenen
Wissenschaftsbereiche untereinander wird vermutlich in den
nächsten Jahren ganz wesentlich von einem neuen, viel
stärker geschichtlichen Naturverstäendnis bestimmt sein.
Durch eine solche Entwicklung wird das bisher eher schroffe
Verhältnis zwischen Natur- und Geisteswissenschaften
möglicherweise von seiten der Naturwissenschaften her eine
gewissen Entkrampfung erfahren können.
Im Rahmen einer physiologischen Betrachtungsweise genügt es
zu zeigen, dass im Hirn Teilbereiche bestehen, die sich von den
andern insoweit isolieren können, dass die Endzustände von
Prozessen in einem Teilbereich für die Auslösung von
Prozessen in einem andern Teilbereich von grösserem, kleineren
oder ohne Einfluss werden können, ohne dass die ersten von den
zweiten abhängig sind. Damit ist Geschichte konstituiert und
unmöglich gemacht, dass für den gesamten Hirnprozess eine
durchgängige Determiniertheit besteht, obwohl jeder einzelne
Prozessteil durchaus den biochemisch-physiologischen Gesetzen
folgt.
Das gleiche gilt natürlich für ein lebendes System in
seinem Verhältnis zur umgebenden Welt: es kann durchaus von ihr
abhangen ohne vollständig von ihr determiniert zu sein, wenn es
ihm gelingt, sich wenigstens partiell vom umgebenden System zu
isolieren.
1.9.
Formen der relativen Strukturverdoppelung oder der
Reflexivität
Soweit verfügen wir nun über ein sehr allgemeines
Prinzip, unter dem sich möglicherweise die systematisierte
Freiheit rekonstruieren lässt. Das Prinzip scheint, so weit ich
sehe, in der humanpsychologischen Perspektive drei oder vier
manifeste Formen gefunden zu haben. Es sind dies das bewusste
Erleben, das Selbst oder Ich, die Sprachlichkeit
und möglicherweise die Imagination von raumzeitlichen
Gestalten. Über die ersten drei davon gibt es, ohne dass die
Bezüge untereinander mehr als nebenbei verfolgt worden
wären und deshalb verhältnismässig isoliert
voneinander, drei reiche Literaturtraditionen. Über die vierte
Form lässt sich nur indirekt etwas aus der psychologischen
Literatur übernehmen.
Inwieweit die vier Formen als eigene Konstruktionen entwickelt
oder ob sie gemeinsam als Reflexivität behandelt werden
können oder sollen, ist für mich eine pragmatische Frage,
ähnlich wie diejenige nach der
didaktisch-forschungsstrategischen Separierbarkeit der Kompenenten
der Binnenstruktur (K, M, L, A). Mein Konstruktionsversuch der
psychologischen Organisaiton ist in diesem Bereich noch
programmatischer als in anderen; man wird einige Vorläufigkeiten
und besonders viele Irrtümer in Kauf nehmen müssen. Ich
behandle die Grundzüge der vier Konsttruktionen nacheinander,
obwohl viele Querbezüge bestehen.
Inhalt
2.
Vier Sekundärsysteme in der internen psychischen
Organisation
2.1. Bewusstes Erleben
oder wie können wir mit dieser privaten Gegebenheit
öffentlich-wissenschaftlich umgehen?
Es kann hier nicht darum gehen, eine Psychologie des Bewusstseins
zu überblicken oder aufzurollen. Ich beschränke mich auf
eine kritische Betonung der methodischen Schwierigkeiten mit dem
Bewussten für eine Psychologie von aussen. Für den
Psychologen von aussen muss Erleben zuerst umgesetzt werden, bevor er
damit umgehen kann. Man beachte, dass ich diesen Einwand ausserhalb
der Wissenschaft für verhältnismässig folgenlos halte,
soweit mein und jedermanns persönliches Erleben betroffen
ist.
Das wissenschaftliche Verstehen des Sprechens eines anderen
über sein Erleben bezieht sich aber genaugenommen nie auf sein
Erleben, sondern auf sein Sprechen; es mag möglich sein,
aufgrund der Analxse des Sprechens und weiterer Sachverhalten eine
Rekonst. Die nachstehenden Gedanken müssen daher notwendig
persönliche sein, freilich in öffentlichem Sprechen
ausgedrückt. Meine sprachliche Beschreibung der Lage eines
Erlebenden, ist, soweit ich sehe, eine direkte oder naive Umsetzung
meiner Erfahrung in Sprache; sie setzt keinen besonderen
theoretischen Standpunkt voraus als den in der verwendeten Sprachform
impliziten. Ich benutze "bewusst" und "erlebt" als völlig
gleichwertige Synonima. Das Substantiv "Bewusstsein" meide ich, weil
es eine Instanz nahelegt und überdies theoretisch belastet
ist.
Unter bewusstem Erleben verstehe ich eine private
Erfahrung, die jedem Menschen eigen zu sein scheint, allerdings ohne
dass jemand in der Lage wäre, das Erleben irgend eines andern
Menschen oder Tieres in Inhalt und Form eindeutig und sicher zu
erfahren. Die Zuschreibung von Erleben an Pflanzen (Fechner) mag
unplausibel sein und kraus wirken; sie ist, da Erleben nicht
operational definiert werden kann (geschieht zB im Koma wirklich
nichts "Psychisches"?, wird nichts erlebt oder nur später nichts
erinnert?) nicht widerlegbar.
Die Überzeugung, dass wir alle ähnlich erleben ist
allerdings jeder und jedem von uns eigen; sie lässt sich
ebensowenig beweisen oder widerlegen. Es scheint sinnvoll, das
Erleben als Vorgänge in einem internen Zeichenprozess in
einem recht flüchtigen und eher engen Sekundärsystem
aufzufassen, da mir im Erleben kein Erlebnisinhalt isoliert
erscheint, obwohl eigentlich nur einer aufs Mal "scharf"
gezeichnet auftritt, und keiner länger als Sekunden(bruchteile)
innerlich fixiert werden kann. Stets führen mich in meiner
Erfahrung Erlebnisinhalte zu andern Erlebnisinhalten oder zu
Referenzobjekten ausserhalb des Erlebens, was einen systemischen
Charakter nahelegt. Die Zeichenliste des Systems ist allerdings nicht
aufzeigbar, der Code oder Informationsträger ist unbekannt.
Wenn immer wir unser Erleben oder Erlebtes anderen Menschen
mitteilen wollen, müssen wir also zunächst eine
Übersetzung in ein anderes Zeichensystem vornehmen und der
Empfänger unserer Botschaft muss ebenso eine
Rückübersetzung vornehmen, wenn er die empfangene Botschaft
vollziehen, dh gemäss unserer eigenen Erfahrung, selber erleben
soll oder will. Das soll nicht heissen, dass an einen Empfänger
gerichtete Botschaften in diesem nur dann wirksam werden können,
wenn sie in seinem Erleben manifest werden. Wir haben vielmehr Belege
dafür, dass das Gegenteil möglich ist (zB das Aufwecken von
jemandem durch leisen Namensruf, die sog. unterschwellige Wahrnehmung
etc.). Für komplexere Botschaften mag es freilich schon
wahrscheinlich sein.
Bei solchen Übertragungen entsteht nun nicht nur die
Unsicherheit einer mindestens zweimaligen Transformation (vom
Sendererleben in den übermittelnden Sprach- oder anderen Code
und vom Code zurück ins Empfängererleben), sondern wie bei
allen kommunikativen Systemen nimmt die Botschaft gezwungenermassen
gewisse Eigenschaften des botschaftstragenden Codes an, die der
Empfänger nur bei einem völlig ein-eindeutigen und
redundanten Code oder bei Vorauskenntnis der Botschaft herausfiltern
kann.
Leider hat sich eingebürgert, als praktisch einzigen Code
für die Übermittlung von Erlebenszuständen oder
-inhalten die Sprache einzusetzen; dies besonder sin
wissenschaftlich-psychologischen Zusammenhängen.
Nichtsprachliche Zeichensysteme wie Mimik, Gestik, Tanz, Musik, Bild
sind möglicherweise für die Übermittlung gewisser
Aspekte der Erlebnisinhalte besser geeignet; aber auch in Kombination
mit oder ohne Sprache sind sie alle meinem eigenen Erleben in meinem
Urteil immer noch völlig inkommensurabel. Wie jedefrau erfahren
kann, die ihr Erleben jemandem erzählt und es sich
zurückerzählen lässt, ist die doppelte
Übersetzung katastrophal, sofern nicht extrem künstliche
Erlebnisinhalte eigens dafür hergestellt und übermittelt
werden; und selbst in solchen Fällen wird die Aktualisierung
dieser besonderen Erlebnisinhalte von zusätzlichen Erlebnissen
begleitet sein, die nicht in die Botschaft eingehen und in der
Rückübertragung fehlen.
Es ist selbstverständlich, dass eine Argumentation wie die
vorstehende, auf bewusstes Erleben abstellen muss, wenn sie ihrem
Gegenstand gerecht werden will. Dh sie kann gar keine Argumentation
für andere darstellen, sondern bloss einen Appell, die
geschilderte Erlebnis- und Kommunikationssituation nachzuspielen. Das
Ergebnis solchen Nachspielens und dessen Beurteilung muss wiederum
dem Empfänger des Appells überlassen bleiben.
Appellieren wir also zur Durchführung eines analogen
Erlebens-und-Sprach-Spiels mit unserer Vorstellung eines partialen
Sekundärsystems innerhalb der internen psychologischen
Organisation. Ich hoffe damit Einsicht zu bewirken, dass das bewusste
Erleben, verstanden als Vorgänge in einem Zeichensystem mit
unbekannter Charakteristik, auf die Beschreibung eines dynamischen
partialen Sekundärsystems innerhalb von G passt. Was
ein Erlebnissystem leisten könnte, wäre genau jenes
Wirksammachen von Inhalten von G, W, K, M in einer sekundären
Repräsentation und damit die Möglichkeit der "freieren"
Inbeziehungesetzung von Inhalten untereinaner, von aktuellen Inhalten
mit aktualisierten Gedächtnisinhalten und mit versuchsweise
entworfenen Inhalten im Hinblick auf künftige Zustände.
Aber diese knappe Skizze ist eine Fiktion; ich sehe keine
Möglichkeit eines empirschen Zugangs. Man kommt eben aus dem
Bewussten weder "hinaus" noch in ein Bewusstsein ausser dem eigenen
"herein". Und das meiste, was wir darum herum tun (können), ist
sprachlich. Demnach widmen wir unser Bemühen besser der Sprache
als einem weiteren Sekundärsystem.
Inhalt
2.2.
Sprachlichkeit oder was erreichen wir mit (konventionalen)
Repräsentationen von Repräsentationen?
2.2.1. Sprachlichkeit: Wie können wir uns
in der Welt mit den Anderen koordinieren?
Wenn wir das Sozialverhalten von Tieren beobachten (bei Arten, wo
die Individuen einander kennen) so fällt immer wieder auf, in
welch hohem Aussmass diffizile Koordinationsprobleme auf der Basis
von sozialen Instinkten ungewöhnlich effizient gelöst
werden. Im Vergleich dazu bringt uns Menschen die Sprachlichkeit zwar
zweifellos wesentlich erweiterte, wohl auch qualitativ andere
Möglichkeiten der sozialen Koordination; das kostet aber
zumindest einen Preis in Sachen Effizienz. Dass sprachliche
Kommunikation dem Empfänger das vermittelt, was ein Sender
intendiert, ist eine Frage, die ungewöähnlich schwierig zu
beantworten ist. Vermutlich ist die Leitidee der technisch
inspirierten Kommunikationstheoretiker, was im Sender als Quelle
vorliege, werden in den Empfänger unbeschädigt
transportiert, ein Wunschtraum eher als eine Wirklichkeit. Versucht
man über die Übergänge von den affenartigen Primaten
zu den Menschen bezüglich Kommunikation zu spekulieren, so liegt
eine Vermutung nahe, die ein unbekannter Weiser in die Formel
gekleidet hat, die Menschen hätten dann die Sprache erfunden
(erfinden müssen), als sie einander nicht mehr verstanden
hätten. Ob sie sich mit der Sprache besser verstehen als ohne,
wäre dann eine weitere, so generell unbeantwortbare
Anschlussfrage.
2.2.2. Was meinen wir mit Sprache in der
Psychologie?
Die Sprachlichkeit des Menschen ist eine evolutionär
einmalige Erscheinung. Obwohl auch Tiere miteinander kommunizieren,
verfügt keine Art über die zur menschlichen Artikulation
ausgebildeten Kehlkopfeigenschaften und, wichtiger, über die
entsprechenden Hirnstrukturen zur Produktion und zur Perzeption von
gesprochener Sprache. Diese biologischen Voraussetzungen von
Sprachlichkeit sind eine notwendige Bedingung; realisiert wird
Sprachlichkeit aber stets innerhalb von menschlichen Gesellschaften,
die eine je ganze bestimmte von unendliche vielen möglichen
Ausformungen von Sprache herausgebildet haben und pflegen.
Die Tatsache macht dies deutlich, dass kleine Kinder in den ersten
Lebenswochen und Monaten wesentliche Basismerkmale von gesprochener
Sprache, nämlich die Phoneme, angeborenerweise unterscheiden
können, die für eine bestimmte Sprache typische Auswahl und
Reihung von Phonemen zu bedeutungstragenden Einheiten aber erst im
Laufe des zweiten bis vierten Lebensjahres von ihrem Sprachmilieu her
erwerben müssen. Ähnliches gilt für die
Sprachproduktion, wo man vermuten kann, dass Kinder
zunächst viel mehr (gegen 100) Phoneme artikulieren können,
bevor sie sich auf die beschränktere Anzahl ihres Sprachmilieus
(typisch zwischen 20 und 40) einengen und sie in geeigneter Weise zu
Sinnträgern reihen. Weitere Merkmale der Sprache wie
grammatikalische Formen und Kategorien, Syntax, Tonfall,
Dialogformen, Schriftsprache u.a. werden angesichts der
Komplexität des Ganzen in erstaunlich kurzer Entwicklung
aufgebaut; die genau Rolle und das Zusammenspiel von vorgegebenen
allgemeinen Bedingungen und Erfahrung im Hören und Sprechen ist
im einzelen erst teilweise aufgeklärt.
So verstanden ist Sprache in erster Linie ein Instrument der
Kommunikation zwischen den Artgenossen bei homo
sapiens. Sie müsste daher in erster Linie in den Rahmen der
Sozialpsychologie gestellt und dort überindividuell als ein
Vorgang zwischen Sender und Empfänger behandelt werden. Doch ist
durch die knappe Darstellung deutlich geworden, dass Sprache nicht
verstanden werden kann ohne ihre Wurzeln in der
Wahrnehmungspsychologie (Hören, Lesen) und der
Handlungspsychologie (Sprechen, Schreiben) und der Kulturpsychologie
(wie sind denn die externen, vom Menschen loslösbaren
sprachlichen Strukturen in Schall und Schrift beschaffen). Wenn es so
ist, dass wesentlicheTeile des Handelns von Menschen in sprachlicher
Form erfolgen, so dürfte auch der Bereich des Kognitiven nicht
ohne Rücksicht auf Sprachlichkeit verstanden werden
können.
Aber ist denn alles in K sprachlich? Eine solche Annahme wäre
sicher falsch, und so stellt sich die Aufgabe, das Verhältnis
zwischen Sprachlichkeit und anderen Kognitionsformen und vielleicht
weiteren Teilen der Binnenstruktur der psychologischen Organisation
zu klären.
Bei allen Ausführungen sollte man sich bei allen
Gemeinsamkeiten immer auch wesentliche Unterschiede zwischen
Sprechsprache und Schreibsprache beachten.
2.2.3. Sprache als Zeichensystem
Was Sprache wirklich ist, kann also wohl nicht eine einzige
Antwort bekommen. Im vorstehenden Abschnitt war in psychologischer
Sicht von der Sprache als einem vollziehbaren Prozess und den
diesen Prozess ermöglichenden Voraussetzungen beim individuellen
Menschen im Dialog mit anderen die Rede; Saussure bezeichnete das als
la parole. Das ist was die Sprachpsychologie
interessiert, während den Sprachwissenschaftler
traditionell eher die vom Menschen losgelöste allgemeine
Struktur der Sprache, also la langue, interessiert, die
er in Wörterbüchern und Grammatiken erfassen kann, sei es
als eine Beschreibung des faktischen Gebrauchs von Sprache durch eine
Sprachgemeinschaft, sei es in Form einer Norm, die richtiges, gutes
Sprechen auszeichnen möchte. Die Sprachwissenschaftler haben im
Lauf einiger Jahrhunderte des Forschens über Sprache vorwiegend
induktiv solche allgemeine Strukturen zu finden gesucht, indem sie
Sprachen aufnahmen, in ihrem Wandel verfolgten und untereinander
verglichen, um das Gemeinsame und das je Spezifische einer bestimmten
Sprache herauszufiltern. Sie benutzen also, um Saussures
Unterscheidung weiterzuführen, parole als Weg zu
langue, während sich die Psychologen direkt für
parole interessieren und dabei langue als
überpersönliche Referenz einsetzen.
Ein Reihe von Wissenschaftlern versuchten jedoch diese induktiven
Vorgehensweisen zu ergänzen durch eine Art Vorausentwürfe,
allgemeine Rahmentheorien, an denen sich dann die Forschung im
einzelnen orientieren könne. Saussure und Peirce (sprich:
Pörss) gelten als die modernen Begründer der Semiotik
oder der allg. Lehre von den Zeichen. Saussure war
Sprachwissenschaftler, Peirce Universalwissenschaftler mit dem
Interesse an einer allg. Logik oder Theorie der Formen "von allem".
Am Beispiel der Sprache ist die Semiotik am ausgiebigsten
durchgeführt worden, sie ist aber viel allgemeiner und scheint
mir insbesondere ein Potential für die Beschreibung von
psychologischen Sachverhalten zu enthalten, das noch kaum erschlossen
ist (vgl. den Abschnitt über Semiotik im Kapitel1.1,
Funktionskreis, S. 23-26).
2.2.4. Die logische Struktur eines Zeichens als
dreistellige Relation
2.2.4.1. Semantik
Die Systematik der Bezüge zwischen Referenz und
Repräsentanz, wie sie sich für eine spezifizierte
Interpretanz in einer Semiose-Klasse darstellen.
- Ikon (Bildzeichen)
- Jene Bezugsform für eine Interpretanz zwischen Referenz und Repräsentanz, welche strukturelle Merkmale des Referenten in den Repräsentanten übernimmt. Strukturelle Entsprechungen sind idR formationsbezogen, va räumlich und zeitlich, zB Einschluss-Ausschluss, Vor-Nach, Vor-Hinter, Darunter-Darüber, Benachbart--Entfernt, etc.
-
- Index (Verweiszeichen)
- Die Verwertung eines für die Interpretanz gegebene ursächlichen (-->Symptom) oder zweckhaften (-->Signal) Zusammenhangs zwischen Referenz und Repräsentanz.
-
- - Symptom (Anzeichen)
- Ein Index, welcher auf einem für die Interpretanz gegebenen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen Referenz und Repräsentanz beruht. Um mit Anzeichen umgehen zu können, muss ein Interpretant den (intrinsischen) Zusammenhang kennen und kann ihn nicht ändern.
-
- - Signal (Hinweiszeichen)
- Ein Index, welcher auf einem für die Interpretanz gegebenen Mittel-Zweck-Zusammenhang zwischen Referenz und Repräsentanz beruht. Um mit Hinweiszeichen umgehen zu können, muss ein Interpretant den meist als arbiträres Hinweiszeichensystem gegebenen (extrinischen) Zusammenhang kennen.
-
- - Symbol (Konventionalzeichen)
- Jener Referenz-Repräsentanz-Zusammenhang, der durch eine Interpretanz arbiträr gestiftet worden ist und dem Interpretanten einer Semiose verfügbar ist.
2.2.4.2. Pragmatik
Bühlers Organon; Jakobson; Sprechakttheorie.
2.2.4.3. Syntaktik
Worin könnte eine ökopsychologische Syntaktik
bestehen?
Psychologie des Einheitenbildens: Kategorialität, Prototypen
etc.
Lewins Topologische Psychol. des Ein- und Ausschliessens
Phänomenale Kausalität
etc.
2.2.5. Sprache als
Reflexivität
In unserem Zusammenhang müsste nun die Rolle von Sprache als
innerpsychisches Medium ausgeführt werden. Meine These ist, dass
Sprachlichkeit als ein besonders wichtiger Fall von Reflexivität
den Überbau der menschlichen psychologischen Binnenorganisation
charakterisiert.
Ausführung aus Zeitgründen nicht mehr möglich.
Inhalt
2.3.
Imagination oder interne Raum-Zeit-Gestalten oder welche
Rolle spielen nichtsprachliche (ikonische)
Repräsentationen?
Ich mache hier einen (ungewöhnlichen)
Vorschlag, im personalen Überbau neben dem Selbst und der
Sprachlichkeit ein weiteres internes Zeichensystem mit den evozierten
Sekundäreigenschaften anzunehmen und langfristig der
empirischeneine Forschung ähnlich zugänglich zu machen, wie
wir es mit der Sprachlichkeit tun. "Vorstellung" ist an sich ein
altes Thema der Psychologie, das Bildliche bis hin zur sog. Eidetik
reicht. Eidetisch wird eine bei Kindern und in seltenen Fällen
bei Erwachsenen festgestellte Fähigkeit genannt, eine Situation,
oft nach einem kurzen Blick, "bildlich" so intensiv und detailliert
im Gedächtnis zu behalten und benutzen zu können, wie wenn
man eine Abbildung direkt vor Augen hätte. Die Fähigkeit
ist selten vorzufinden, in geringeren Graden charakterisiert sie
manchen Künstler oder Karikaturisten, der eine Art Projektion
eines geplanten Bildes auf seine Leinwand "werfen" kann und dann an
Details in einer Ecke zeichnet und dennoch die Proportionen des
Ganzen einhält, ohne zuerst eine umfassende Skizze auf das Blatt
zeichnen zu müssen. Man sollte sich aber von der statistischen
Seltenheit solcher Leistungen nicht ablenken lassen und die Frage
verfolgen, ob Bildliches ähnlich wie Sprache nicht nur eine
äussere, sondern auch eine innere Form, ein Medium darstellt, in
der Psychisches sich manifestieren kann.
Raum-Zeit-Gestalten können wir intern vollziehen in
der körperbezogenen
haltungsmässig-mimisch-gestisch-tänzerischen, in der
aussenweltbezogenen räumlichen, bildlichen, dinglichen
oder in der geschehnisbezogenen musikalischen, "filmischen",
"motorischen" u.ä. Vorstellung. In Anlehnung an das Feld
der bildlichen Vorstellungsforschung (imagery) spreche ich
vereinfachend von Imagination oder Imaginativität. Die
meisten dieser Vorstellungen haben irgendwie flüchtigen
Charakter, sind aber angenähert repetierbar, und sie sind wie
sprachliche Inhalte ein Stück weit, doch kaum je umfassend,
erlebbar. Anders als beim Erleben im allgemeinen verfügen wir
jedoch für Imaginatives im hier verstandenen Sinn über
perzeptive und exekutive Umsetzungsmöglichkeiten, dh wir
können Imaginationen und sprechbare Erlebensinhalte durch
Handlungen in realen Räumen und Zeiten konkretisieren (vgl. Umw,
Kult) Direkter als auf dem Umweg über sprachliche Beschreibung
sind Imaginationen in Raum und Zeit angenähert fixierbar und in
der Folge oder vielerorts uns selbst und anderen wieder
zugänglich. Und diese andern sind, besonders nach geeigneter
Vorbildung und Übung, ähnlich wie bei der mündlichen
oder schriftlich-sprachlichen Kommunikation - aber besser als beim
Erleben im allgemeinen, etwa bei Gefühlen - in der Lage,
Wesentliches aus unseren Konkretisierungen zu entnehmen und in ihrer
eigenen Imagination neu zu vollziehen.
In dieser ganzen Gruppe von, wie man vielleicht sagen kann,
kunstaffinen Vorstellungen realisieren viele wenn nicht alle
Menschen auf ihre Weise psychische Inhalte, denen sie, so glaube ich,
eine grosse Bedeutung für das individuelle wie für das
soziale Leben zumessen. In unserer Gesellschaft, besonders in den
gebildeten Schichten, ist die Pflege dieser psychischen Daseinsformen
seit einigen Jahrhunderten in hohem Masse von sprachlichen Formen
bedrängt worden, indem sie entweder auf pure
Instrumentalität der Illustration reduziert oder durch
prestigegeladene Hochstilisierung einer speziellen "Kultur"
reserviert werden. Während solche Vorstellungen zusammen mit
ihren externen Konkretisierungen das Leben zB des europäischen
Mittelalters in hohem Masse geprägt haben, sind sie etwa im
schulischen Alltag des 19. und 20. Jahrhunderts stark
vernachlässig worden. In jüngerer Zeit macht sich mit
Erscheinungen wie der Popularisierung von Musik und bildender Kunst
und besonders den elektronischen Medien eine deutliche Intensivierung
der Pflege dieser Seiten psychischer Existenz wieder bemerkbar. Viele
suchen sie auch in der Auseinandersetzung mit ihrer noch besser
erhaltenen Pflege in fremden Kulturen (Trachten, Bauweisen, Rituale,
Feste, Musiken u.a.m.) oder unter Stichworten wie "feminines
Erleben und Gestalten" zu erneuern und zu verbreiten.
Üblicher ist vielleicht, die Imagination von Raum- und
Zeitstrukturen mit dem Erleben überhaupt zusammenfallen zu
lassen. Sprachliches und Imaginatives sind jedoch, jedenfalls in
meiner Erfahrung, sozusagen kommunizierbarer als das Erleben selber.
Ich meine, dass zwischen dem Erleben und der Imagination eher eine
ähnliche Beziehung angenommen werden sollte wie zwischen dem
Erleben und der Sprache: Übersetzung und
Rückübersetzung scheint bei Sprachlichem und Imaginativem
leichter gangbar als beim Erleben tout pur.
Sprachlichkeit und Imaginativität sollten deshalb als
einander gleichwertige psychische Erscheinungen behandelt werden,
Erleben vielleicht eher als übergeordnete, aber weniger
artikulierte Vorform bzw. vorläufige Betrachtungsweise von
Innerpsychischem. Denn sie sind beide nur in gewisser Hinsicht
Erlebnisformen, in gewisser Hinsicht auch mehr.
Sollte das Ergebnis näherer Untersuchung wahrscheinlich
machen, dass mit dem Selbst, der Sprachlichkeit und der Imagination
die Zeichenformen des innerpsychischen Überbaus erschöpfend
aufgezählt und damit eine eigene Konstruktion für das
Erleben als überflüssig erwiesen sei, so wäre für
die Klarheit der Konstruktion der personalen Binnenstruktur mehr
gewonnen als verloren. Mein Versuch nährt sich aus der Hoffnung,
mit dem Konstrukt der Imagination aus gewissen methodischen
Schwierigkeiten des Erlebnisbegriffes herauszukommen und zugleich
wichtige Aspekte des Psychischen, nämlich das
motivationsaffinere Raum-Zeitliche, aus der methodischen Umklammerung
durch das kognitionsaffinere Sprachliche zu befreien.
Inhalt
2.4.
Selbst oder Ich oder was gibt dem Individuum über
Einheitlichkeit und Ganzheitlichkeit der Person hinaus seine
einmalige Identität: Ich ?
2.4.1. Was meinen wir mit Selbst oder
Ich?
Es handelt sich um einen ausserordentlich schwierigen Begriff mit
einer langen Denkgeschichte (etwa mit Sokrates' "Erkenne Dich
Selbst!" anfangend), wenig überzeugender empirischer Forschung
und verwirrlicher Nähe zur Umgangssprache. Bis in die
Jahrhundertmitte gibt es praktisch keine empirischen Untersuchungen;
was seither gemacht wurde, neigt zum Verfliessen mit
Persönlichkeits- und/oder Differentialpsychologie. Von der
Tatsache der Entwicklung ist das Selbst ebenfalls nicht abzutrennen,
wie der schöne Buchtitel zum Thema von G.W. Allport "Becoming"
zeigt. Allport zieht übrigens in seinen Schriften die
Bezeichnung "Proprium" vor, die gewiss mit "Selbst" verwandet, aber
weniger explizit als "Ich" den Erlebnisaspekt betont.
(A) Das Selbst gilt allgemein als jene psychologische
Konstruktion, welche die Gesamtheit der psychologischen Funktionen
eines Individuums auf einmalige Weise in eine einheitliche Gestalt
organisiert. In dieser Rolle kann man das Selbst als den Urspung des
individuellen Handelns bezeichnen und mehr oder weniger synomym mit
Ausdrücken wie Subjekt, Person, Agent, u.ä. verwenden, mit
denen man auf eine zentrale Instanz des Individuums verweist. Die
Schwierigkeit mit dem Begriff liegt offensichtlich darin, dass, wenn
das Selbst das Handeln der ganzen Person bestimmt, die Frage offen
bleibt, wer oder was denn das Selbst bestimmte; ein
unauflösbarer Kreis- oder Kettenschluss ist vorprogrammiert.
Es stellt sich zudem die Frage, in welchem Verhältnis Selbst
und Person zu sehen sind. Offensichtlich sind auch sozial lebende
Tiere in ihrem Verhalten gegenüber den Gruppengliedern von einer
weitgehenden Einheitlichkeit ihrer jeweiligen "Person" bestimmt;
komplexere Tiere kennen voneinander (weite Teile) ihre(r)
Lebensgeschichten und ziehen daraus Konsequenzen im Alltagshandeln
(vgl. etwa Waal, Frans de (1989) Peacemaking among primates.
Cambridge Mass., Harvard Univ. Press. (auch deutsch). Insofern sie
also einheitlich handeln, "sind" sie "Personen"; "haben" sie deswegen
auch schon ein Selbst oder Ich?
(B) Auch erlebnismässig bringt man das Selbst oder Ich
mit dem Zentrum oder Ursprung, also mit dem eigentlichen
Subjekt des Handelns in Verbindung: es ist "ich selbst", der
oder die handelt. Als erlebtes Selbst wird es aber gleichzeitig zu
(s)einem Objekt, indem das Subjekt aus sich selbst auch ein
Gegenüber macht. William James (1890) hat das in die schöne
englische Formel vom "I" als Subjekt gebracht, welches das "Me" als
Objekt erkennt. Das Selbst ist dann jenes Subjekt, das sich selbst
zum Objekt hat.
Die Bedeutungen (A) und (B) ziehen sich wie ein roter Faden durch
die Literatur; sie lassen sich nicht immer klar unterscheiden, weil
der Unterschied wieder einmal eher in der Betrachtungsweise als im
Sachverhalt liegt. Ein gängiger Sprachgebrauch (der Praxis)
beispielsweise, der beide Bedeutungen zu vermengen sucht, redet vom
Selbst als dem Inbegriff aller Gedanken, Gefühle, Strebungen,
Gewohnheiten, etc., welche ein Individuum als seine eigenen
erfährt oder welche ihm von Dritten als seine eigenen
zugeschrieben werden. Nur insoweit man die Bedeutung dieses
"Eigenseins" empirisch differenzieren kann, dürfte dieser
Begriffsgebrauch sinnvoll sein; sonst fällt er nämlich
zusammen mit dem Begriff der gesamten psychischen Organisation, und
es ist nichts gewonnen.
Bei beiden Begriffsaspektn handelt es sich so, wie die Begriffe in
der Literatur gebraucht werden, um Attributionen mit einem gewissen
Reifikationsanspruch: das Selbst, wenn es sich nicht um etwas
Psychisches handelte, wäre ein Gegenstand, den man sehen oder
greifen können müsste: das Subjekt im Subjekt als
"Homunculus" und das Objekt im Subjekt in Analogie zu
physischen handelnden und leidenden Substanzen. Der
Attributionscharakter ist in der Bedeutung (B) direkt erkennbar, wenn
ein Selbst dieser Art von einem Betrachter andern Personen
zugeschrieben wird. Solange ein Betrachter ein Selbst nur erlebend
für sich selbst beansprucht, handelt es sich um ein Erlebnis,
dem diese Subjekt-Objekt-Separierung nicht unbedingt eigen sein muss.
Sobald der Betrachter aber über sein eigenes Selbst sprachlich
berichtet, fällt er in Form der Selbst-Attribution notwendig in
eine Subjekt-Objekt-Sprachfigur, die er dann auf sich und andere
anwendet.
Viele Autoren vermeiden die Reifizierungsfalle, indem sie vom
Selbst grundsätzlich als dem Selbstkonzept sprechen,
welches ein Individuum sich selbst oder anderen zuschreibt. Damit
nähern wir uns der eigenen Betrachtungsweise (werden uns aber
vor Konstruktivismusfallen hüten müssen).
2.4.2. Genese des Selbst
Versuch zu zeigen, dass erste Voraussetzung die Fähigkeit zur
Identifikation von Artgenossen ist (auf Individualstufe oder auf
Gruppenstufe wie etwa bei sozialen Insekten), morphologisch und
verhaltensmässig. Welche Rolle spielen nun Externalisierungen,
angefangen mit Raumanspruchen, dabei? Der andere bildet einen Hof von
Bedeutungen, ich selber? Schliesst sich daran die Selbstreflexion
oder geht sie im inneren Sekundärsystem voran, oder ist beides
wechwelweise hilfreich? vgl. Boesch 1989/91, Kapitel 8.
2.4.3. Selbst als internes
Sekundärsystem
Beide dargestellten Bedeutungen des subjekthaften und des
objekthaften Selbst erfüllen durchaus die Verdoppelungsidee. Die
Durchführung ist derzeit rein heuristisch. Es hat wenig Sinn,
sie losgelöst vom Rest der Konstruktion zu beurteilen, da ihr
allfälliger Gewinn vorwiegend darin liegt, mit einem einfachen
und sehr allgemeinen Prinzip (relative Verdoppelung und Bezug) sehr
verschiedenartige Erscheinungen zu beschreiben.
Im konstruierten Sekundärsystem des Selbst sind
definitionsgemäss Inhalte aus G, allerdings als eine partielle
Selektion, repräsentiert und wirksam. Sind in einem so
verstandenen Selbst analoge Restrukturierungsvorgänge
möglich, wie wir sie früher im Bereich der kognitiven
Prozesse K angenommen haben, so gewinnt das Sekundärsystem als
Selbst gegenüber K infolge seiner grösseren
Selektivität zusätzliche "Freiheitsgrade" der
Umstrukturierung, weil ein Teil der in G wirksamen Zusammenhänge
oder Einschränkungen im Selbst unwirksam bleibt. Wenn die
im Selbst aus der von G relativ abgetrennten Restrukturierung
gewonnenen Zustände wieder nach K zurückwirken können,
so haben wir genau das gewonnen, was für das Subjekt des
Handelns postuliert wird, ohne dass wir eine besondere Instanz
annehmen müssen, die ihrerseits eines "Steuermannes" bedarf.
Obwohl das Selbst dann keine eigenständig entscheidende Instanz
ist, kann seine Wirkung auf K oder G wie die einer solchen
beschrieben werden.
Auch der zweite Aspekt des traditionellen Selbstkonzepts, die
Reflexivität, bedarf keiner eigenen Begründung mehr; ein
wechselseitiger Bezug zwischen den beiden Teilsystemen ist in ihrer
Konstruktion vorgesehen. Ob oder wie die Sache erlebnismässig
aussieht, ob die Subjekt-Objekt-Erscheinung genuin oder sprachlich
bedingt ist, braucht uns in der psychologischen Konstruktion nicht zu
kümmern. Es ist möglich, aber durchaus nicht notwendig,
dass die Vorgänge im Selbst mit den privat erlebbaren
Gefühlen, Feststellungen, Erwägungen, Schlussfolgerungen
usf. einigermassen zusammenfallen.
Der Vorzug der Sekundärsystem-Vorstellung liegt in der
grösseren Nähe zu den übrigen psychologischen
Funktionen und in ihrer Affinität zum Prozessdenken.
2.4.4. Selbst in psychologischen
Denksystemen
Nun haben freilich eine grosse Zahl von Autoren in ihren
psychologischen Denksystemen dem Begriff eine je eigene Bedeutung
verliehen. Sie können hier weder aufgezählt noch
exemplarisch erläutert werden.
2.4.4.1. Psychoanalyse,
Ich-Psychologie
Eine etwas eingegrenztere Bedeutung gewinnt das Selbst in
psychoanalytischem Kontext. So wird etwa von Rogers das Selbst
jenen psychischen Strukturen oder Schichten vorbehalten, welche dem
bewussten Erleben akzeptabel sind. Die entsprechenden
Personteile (Ich, bei Freud) sind werden dabei als Reaktionen oder
Konfliktverarbeitungsergebnis zwischen den urtümlichen
Triebzielen (Es) und den triebversagenden odler -regulierenden
äusseren oder internalisierten Instanzen (Über-Ich)
verstanden. In der Ich-Psychologie (Hartmann u.a.) wird dieser
Instanz eine grössere Eigensetändigkeit zugestanden; doch
bleibt die Ausgrenzung des Unbewussten als Verdrängtes. Die
Einschränkung ruft dialektisch nach ihrer Auflösung, so
dass in anderen tiefenpsychologischen Schulen, das Selbst auch seinen
komplementären Gegensatz oder "Schatten" (Jung) mit umfasst.
2.4.4.2. "Humanistische" Psychologie:
Selbst-Verwirklichung
Bei Rogers, Maslow und anderen wird das Selbst als ein Potential
verstanden, welches in jeder Person angelegt ist und nach
Aktualisierung oder Verwirklichung drängt. In der
Bedürfnispyramide Maslows erscheinen nach Befriedigung der
grundlegenden physiologischen Bedürfnisse, der Sicherheits- und
der Zugehörigkeitsbedürfnisse die Selbstwert- und die
Selbstvedrwirklichungsbedürfnisse; später wurde noch ein
Bedürfnis nach Transzendenz beigefügt.
2.4.5. Selbst in der Forschung
2.4.5.1. Aspekt des "I" (Selbst als
Subjekt)
Einschlägige empirische Forschung, die das postulierte Selbst
als Instanz des Handeln operational von der gesamten psychischen
Organisation abzutrennen vermöchte ist mir nicht bekannt, wenn
man von den überwiegend phänomenologischen Studien einiger
Gestalttheoretiker absieht (vgl. Koffka 1935).
Ein eher amüsanter Aspekt dieser Studien, der später von
Gibson aufgenommen worden ist, betrifft die Lokalisation des
wahrnehmenden Ichs im Körper, der sog. Stationspunkt. Die
Aussagen der Vpn lokalisieren ihn über der Nasenwurzel vor dem
Schnittpuntk der Sehstrahlen. Passend dazu ist der Umstand, dass in
der chinesischen Sprache das Wort für "Nase" auch zur
Bezeichnung dessen verwendet wird, was wir mit Selbst meinen.
2.4.5.2. Aspekt des "Me" (Selbst als reflexives
Objekt)
Tausende von Studien mittels Fragebogen hat Wylie (1979)
zusammengestellt. Die Studien beruhen auf wenigen methodisch
standardisierten Fragebogen bzw. meistens auf ad hoc Verfahren. Sie
fassen das Selbst mehrheitlich als eine kürzer- oder
längerfristige bestehende Disposition analog zu
Persönlichkeitsvariablen auf. Gültige Aussagen zur
Psychologie des Selbst als allgemeinpsychologische Struktur oder
Prozess lassen sich daraus nicht ableiten.
2.4.5.3. Verwandte
Forschungsthemen
In einer grossen Zahl von älteren oder aktuellen
Forschungsthemen sind Aspekte des Selbst involviert. Von den darin
aktiven Forschern werden sie mehr oder weniger explizit auf
Selbst-Begriffe bezogen. Auch hier sind prozessorientierte
Untersuchungen selten. Einige seien hier nur aufgezählt, nicht
weiter untersucht.
- Willensforschung, Volition (Vorsatz) - Anspruchsniveau (Lewin) --> Leistungsmotivation (Heckhausen)
- Intrinsische Motivation
- Kogn. Dissonanz, Konsistenz, Reaktanz (Festinger -->)
- Locus of Control (internal - external) (Rotter -->)
- Attributionstheorie (Heider -->)
- Geschlechtsrollen u.a. Gruppenidentitäten (vgl. Soz)
- Learned Helplessness (Seligman -->)
- Terminale und instrumentale Werthaltungen (Rokeach -->)
- Handlungspotential (Boesch)
- Self-Disclosure oder Privatsphäre (Geheimnis)
- Selbst in Ding- und Umweltpsychologe (vgl. Umw, Kult)
2.4.5.4. "Selbst" in
Bindestrich-Kombinationen
In allen psychologsich differenzierten Alltagssprachen findet sich
eine grosse Zahl von Wortgebräuchen in Bindestrich-Verbindung
mit Selbst-, Eigen- oder Ich; English & English (1958) haben
gegen 1000 solche Doppelwörter gezählt, von denen viele mit
mehr oder meist weniger Erfolg zu psychologischen Fachtermini gemacht
worden sind. Beispiele und Erläuterungen dazu finden sich in
jedem Fachwörterbuch.
Inhalt| To the Top