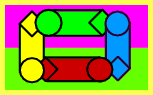Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 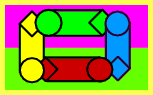 |
Magazine Article 1990 |
Wissenschaft interdisziplinär: Ohne Disziplin keine Interdisziplinarität | 1990.05 |
@SciPol |
15 / 20 KB Last revised 98.11.14 |
Unipress (Univ. Bern) Nr. 67 vom Dezember 1990, S. 20-24 | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
- Interdisziplinarität ist notwendig
- Drei Arten von Interdisziplinarität
- Instrumentelle Interdisziplinarität
- Multidisziplinarität als "Wert in sich selbst"
- Interdisziplinäre Leitideen
- Disziplinen sind die Voraussetzung von Interdisziplinarität
- Pragmatik der Interdisziplinarität: Das Ein-Sechstel-Modell
- Die "Schwimmringe" zu "Flossen" aufbauen!
Der nachstehende Text gibt den leicht ergänzten Inhalt von
Diskussionsbeiträgen des Verfassers an der
Münchenwiler-Tagung des Collegium Generale der Universität
Bern vom 6./7. Juli 1990 wieder.
Interdisziplinarität ist
notwendig
Interdisziplinär zu forschen, zu lehren
und zu lernen ist ein Wunsch vieler, freilich nicht aller Mitglieder
der Universität auf allen Stufen. Es ist aber auch eine
Forderung, die immer kräftiger von aussen an die
Universität herangetragen wird. Dass die Probleme unserer
Lebenswelt sich nicht um die Disziplinengrenzen kümmern, ist
eine Binsenwahrheit. Forschung und Lehre von den allerdringlichsten
Problembereichen in Umwelt und Gesellschaft her zu organisieren,
hiesse freilich, die Teufel des wissenschaftlich-industriellen
Zeitalters mit Belzebuben zu ersetzen. Die gegenwärtige Tendenz
vieler Kreise (einschliesslich einiger universitärer
Kräfte), aus der Universität immer mehr eine Ansammlung von
Fachhochschulen, spezialisierten Forschungsinstituten und
Dienstleistungssstellen zu machen, ist ebenso verhängnisvoll wie
die wahnsinnige Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die zu einer
Vervielfachung der wissenschaftlichen Disziplinen, ihrer hohen
Spezialisierung und ihrer oft weitgehenden Abschottung gegeneinander
geführt hat.
Vielleicht kann die gezielte Pflege von
Interdisziplinarität eine Milderung des Übels, allerdings
kaum seine Heilung, herbeiführen. Für die
Öffentlichkeit muss das Konzert der Verlautbarungen aus den
Wissenschaften wie Kakophonie wirken. Durch mediengemässe
Filterung und Entstellung, durch die übliche gewordene
Verwechslung von Wissenschaft und Technik, durch übersteigerte
und nicht eingehaltene Versprechungen u.v.a.m. ist ein Klima
entstanden, in dem nicht nur die vielen angenehmen Errungenschaften
des modernen Lebens den Wissenschaften und ihren Folgeunternehmungen
verdankt, sondern auch die neuartigen Gefahren und viele der alten
Ängste den Wissenschaften angelastet werden. Die Bereitschaft
steigt, dies den Wissenschaftern wo möglich heimzuzahlen, obwohl
man sehr wohl weiss, wie unverzichtbar geworden sie sind. Das Bild
einer riesigen Tinguély-Maschine drängt sich auf.
Allerdings kann sich der Laie, steht er vor den Wissenschaften, nicht
in entlastende Belustigungsgefühle retten, weil er weiss, dass
er täglich von der Maschinerie getroffen werden kann. Steigern
sich die Gefühle der Betroffenen von Hilflosigkeit in
Ausweglosigkeit, so kann es zu panikartigen
Zerstörungsanfällen kommen.
Besonders perfid sind die gegenwärtigen
Bedingungen übersteigerter Disziplinarität für die
Studierenden. Von den Wissenschaften fasziniert oder wenigstens an
ihrem Nutzen - für die Allgemeinheit oder doch für eine
Laufbahn - interessiert, werden sie durch die Spezialiserungsmuster
der Wissenschaften und die auf deren Durchsetzung angelegten
Studienpläne in einen Zwang versetzt, der den zeitgemässen
Versprechungen von Mündigkeit und Freiheit für ein eigenes
Leben ins Gesicht schlägt. Erfolg hängt zu sehr vom Grad
der Spezialisierung ab. Die Disziplinen aber - dazu herausgebildet,
der Vielfalt der Gegenstände gerecht zu werden, oder jedenfall
damit gerechtfertigt - verfehlen offensichtlich die Verhältnisse
und wirken wie Disziplinierungen, die von einem ganzheitlichen Leben
fernhalten.
Drei Arten von
Interdisziplinarität
Nun ist jedoch seit langem
Interdisziplinarität an der Universität durchaus auch eine
Wirklichkeit. Zwar gibt es keine brauchbare Erhebung darüber. In
der Forschung, besonders im Bereich der Naturwissenschaften und der
Medizin, übersteigen eine grosse Zahl von Projekten die
Disziplinengrenzen, und im Bereich vieler Geisteswissenschaften wird
seit alters her eine Tradition von Gemeinschaftsseminaren gepflegt.
Beides geschieht teils aufgrund freundschaftlichen Zusammenfindens
von Forschenden und Lehrenden und Lernenden, teils findet es
institutionelle Unterstützung in Form von formellen Projekten
oder dazu eingesetzten Kommissionen. Seltener ist allerdings, trotz
den Anstrengungen des Collegium Generale und der Akademischen
Kommission, die fakultätsübergreifende Kooperation. Eine
differenzierte Erhebung des interdisziplinären Geschehens und
insbesondere eine geeignete Kasuistik, die Einblicke in die
Voraussetzungen, Prozesse, Schwierigkeiten und Erfolge von
Interdisziplinarität aufzeigen könnte, ist ein Desiderat.
In Ermangelung solcher Daten über die Berner Verhältnisse
sind wir auf auswärtige Befunde, allgemeine Erwägungen und
persönliche Erfahrungen angewiesen.
Die meisten interdisziplinären
Unternehmen haben ihren Ursprung in disziplinären
Fragestellungen, deren Lösungen oder Lösungsversuche
innerhalb der Disziplin nicht gelingen wollen oder nicht befriedigen
können. Eine wichtige Unterscheidung ergibt sich, wenn man nach
dem Verhältnis zwischen den kooperierenden Disziplinen fragt. Es
scheint mir, dass die drei nachstehend skizzierten Weisen von
Interdisziplinarität bestimmte Affinitäten aufweisen: die
erste mit den Naturwissenschaften, die zweite mit den
Geisteswissenschaften, während die dritte sich um diese
traditionelle Separierung der Disziplinen gerade nicht kümmern
darf.
Instrumentelle Interdisziplinarität In vielen Projekten haben die einbezogenen Disziplinen für die ursprüngliche Fragestellung eine instrumentelle Funktion. Sie müssen, sei es technische, sei es wissensmässige, Voraussetzungen schaffen, damit eine Fragestellung überhaupt weitergetrieben werden kann. Die Bewertung der instrumentelle Funktion muss der Bewertung der Ausgangsfragestellung nicht nachstehen; denn nicht nur kann sie ein wesentliches Glied in einer Kette darstellen, sie kann auch zu einer Änderung der Ausgangsfrage zwingen. Instrumentelle Interdisziplinarität ist häufig und wichtig, aber sie reicht nicht aus.
Multidisziplinarität als "Wert in sich selbst"
Sobald man anfängt, sich mit einer Frage intensiv zu beschäftigen, gibt es, grob gesprochen, zwei Entwicklungsmöglichkeiten, die wohl eher mit dem Temperament des Wissenschaftlers als mit dem Forschungsgegenstand in Verbindung zu bringen sind: der eine Forscher kann sich mit seinem Gegenstand zusammen "einschliessen" und immer mehr über immer weniger -- schliesslich "alles über nichts" -- herausfinden; der andere kann seine eigene Rolle bei der Konstituierung seines Gegenstandes im Auge behalten und ein Bedürfnis dafür entwickeln, seinen Gegenstand auch in andere Perspektiven zu drehen. Fast alle Wissenschaftler sind heute bereit, ihre Disziplin als eine Folge oder einen verzweigenden Strom von Erkenntnissen zu verstehen, von denen in gewisser Hinsicht jeweils bessere die jeweils begrenzteren ablösen. Es ist merkwürdig, dass so wenig Wissenschaftler bereit sind, eine analoge Haltung ihrem Ausgangsgegenstand gegenüber einzunehmen. In multidisziplinären Auseinandersetzungen lernt man die Dogmen der eigenen Disziplin an den Vorurteilen der andern relativieren. Multidisziplinäre Arbeit ist praktische Wissenschaftstheorie.
Interdisziplinäre Leitideen
Aus multidisziplinären Konfrontierungen können sich Fragestellungen ergeben, die auf die gegenseitige Durchdringung zweier oder mehrerer gedanklicher Gebilde aus verschiedenen Disziplinen hin angelegt sind. So kann man beispielsweise "Wahrnehmung" oder "Umwelt" nicht verstehen, wenn man nicht bereit ist, die Grenzen zwischen Disziplinen wie Physik, Chemie, Biologie, Psychologie, Soziologie und Philosophie zugleich schärfer zu artikulieren wie aufzulösen. Man kann von Interdisziplinarität der Leitideen der Forschung oder des Verstehens sprechen. Sie beruht auf der in der Nachfolge von Kant in der Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts zunehmend deutlicher herausgearbeiteten Einsicht (Peirce, Einstein, Lewin, Polanyi, Kuhn, Foucault, Feyerabend u.a.), dass Gegenstände von Wissenschaften nicht einfach vorgefunden werden, sondern im wesentlichen durch Begrifflichkeiten, Methoden und Theorien konstituiert sind. Disziplinäre Gegenstandsbestimmungen sind demnach immer provisorisch, revisionsbedürftig und partiell. Versteht man sie als Stadien fortschreitender Verständnisverbesserung, so sind Disziplinengrenzen so nützlich und so dumm wie Grundstücks- oder Landesgrenzen.
Disziplinen sind die
Voraussetzung von Interdisziplinarität
Ich möchte also keineswegs die
Auflösung der Disziplinen anstreben. Aber sie sind Instrumente,
nicht Ziele. Sie allein können die begrifflichen und
methodischen Mittel bereitstellen, welche Gegenstände
konstituieren und behandelbar machen. Weil sie das tun, enthalten sie
aber auch zwingend in sich die Aufforderung, sie selbst zu
übersteigen. Es ist diese Konsequenz der
Disziplinen-Aufgliederung, die die Wissenschaft des 20. Jahrhunderts
nicht ernsthaft gezogen hat und die wir zu korrigieren
haben.
Ohne den Gründen nachgehen zu
können, glaube ich, dass die Vereinzelung der Disziplinen sehr
viel damit zu tun hat, dass das Werden der Wissenschaften in einem
viel höheren Grade von gesellschaftlicher Dynamik als von rein
fachlichen Entwicklungen geprägt ist. Disziplinen sind in erster
Linie Personen und Personengruppen. Man vergegenwärtige sich, in
welchem Masse ein junger Wissenschaftler darauf angewiesen ist, sich
an den aktuellen Strömungen seines Faches zu orientieren. Wenn
wir aber die Disziplinen so fest institutionalisiert haben, wie das
bei der gegenwärtigen Universität mit ihren hunderten von
"Einheiten" der Fall ist, so sollten wir wohl auch eine kluge
Institutionalisierung der Interdisziplinarität
vornehmen.
Es fehlt in der Schweiz schmerzlich so etwas
wie ein Zentrum für interdisziplinär-wissenschaftliches
Arbeiten (ZIWA). Die "Freisemester" zerstreuen uns alle sieben
Jahre "disziplinär" in alle Welt oder in einsame
Gelehrtenklausur. Ebenso notwendig wäre, uns
interdisziplinär im Umkreis des Landes zusammenzubringen. Sollte
ein schweizerisches ZIWA wirklich unsere finanziellen
Möglichkeiten und nicht nur den politischen Willen dazu
übersteigen, so böte vielleicht die europäische
Entwicklung Chancen für ein Gemeinschaftsunternehmen der
kleineren Länder. Eine Verdichtung des Freisemester-Zyklus und
das Angebot entsprechender Arbeitsmöglichkeiten, die wohl
über die Präsenzzeiten im ZIWA hinauswirken würden,
könnten die Qualität schweizerischer Wissenschaft im
Verhältnis zum Finanzbedarf stark verbessern.
Pragmatik der
Interdisziplinarität: Das Ein-Sechstel-Modell
Da aber die Schaffung eines solchen Zentrum
ein eher mittel- bis langfristiges Unternehmen sein dürfte und
weil Interdisziplinarität auf allen Stufen vom Gymnasium
über die universitäre Lehre bis in die Forschung jetzt
gepflegt werden sollte, möchte ich einen sehr einfachen
Vorschlag zur Diskussion stellen.
Es soll allen vollamtlich Unterrichtenden
und allen Studierenden an der Universität das Recht und die
Verpflichtung auferlegt werden, einen Sechstel ihres Pensums
interdisziplinär zu lehren und zu lernen.
Für die Professoren würde
das heissen, dass sie im Schnitt jedes Semester eine Wochenstunde
gemeinsam mit einem oder mehreren Kollegen aus andern Fächern
unterrichten. Gemeinschafts-Lehrveranstaltungen finden in manchen
Bereichen regelmässig statt; es handelt sich nicht um etwas
unerprobt Neues. Die gewisse Ausweitung und die institutionelle
Anerkennung dürfte aber eine deutliche Aufwertung und
verstärkte Wirkung dieser Veranstaltungen mit sich bringen. Ich
denke nicht, dass sehr viel Detailregelung nötig wäre. Denn
besser als Vorschriften würden das Interesse der Studierenden
und der Druck der Kollegen das Angebot von qualitativ hochstehenden
gemeinsamen Lehrformen und -inhalten fördern. Vielleicht
müsste man zu vermeiden versuchen, dass die Verpflichtung
ausschliesslich in Form von Beiträgen an Ringvorlesungen
abgegolten würde, obwohl das bereits ein Minimum an
Interdisziplinarität enthält, wenn wenigstens deren Planung
gemeinsam vorgenommen wird. Aber es würde ausreichen,
Missbräuche wie das ausschliessliche Kooperieren im allerengsten
Kreis durch Sichtbarmachen zu vermindern.
Die Regelung hat natürlich nur eine
Chance, wenn in die Studienpläne aller Fächer die
entsprechenden "Freiräume" eingebaut werden. Auch hier gibt
es schon einige Fächer, deren Programme ausdrücklich das
"Fremdgehen" vorsehen oder verlangen. Aber, so weit ich die
Verhältnisse überschaue, müssten wohl innert einer
gewissen Frist Anpassungen der Studienpläne verlangt werden, und
dies natürlich ohne Vermehrung des Gesamtpensums.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein
Fach gibt, welches ernsthaft darauf bestehen möchte, sein
Studienprogramm sei so randvoll mit absolut unentbehrlichen Inhalten,
dass eine Verfremdung eines Sechstels -- genau genommen handelt es
sich ja im Durchschnitt nur um einen Zwölftel des jeweiligen
Faches, weil die eigenen Fachvertreter an den Veranstaltungen auch
mit beteiligt sein können -- nicht in Frage komme. Worin sollte
sich denn sonst die Universität von irgendeiner Fach(hoch)schule
unterscheiden? Auch müssten die Fachvertreter bedenken, dass auf
diese einfache Weise ihre Absolventen auf dem Arbeitsmarkt für
sehr viele Tätigkeiten interessanter, attraktiver werden; und
dass müsste doch eigentlich den Studierenden zu wünschen
sein.
Das Ein-Sechstel-Modell hat viele
Vorteile und kaum Nachteile. Es sei denn, man betrachte es als
Nachteil, wenn etwas Besseres nicht mehr kostet als das Bisherige.
Entscheidend ist, dass Lernende und Lehrende für
interdisziplinäre Arbeit nicht "bestraft", sondern auf
selbstverständliche Weise belohnt werden: doppelt belohnt
werden, weil sie in der Erfüllung ihrer ganz normalen Pflicht
abenteuerliche Entdeckungen machen dürfen, ihren Horizont
erweitern und ihre Vorurteile einem Risiko aussetzen und zur
Disposition stellen können. Als Vorteile würde ich auch
bewerten, dass keine neuen institutionellen Strukturen geschaffen
werden müssen -- wir haben eh' schon zu viel davon. Anstatt in
Kommissionen unter endlosem und frustrierendem Zeiteinsatz um Ziele
und Programme zu kämpfen, könnten wir das Bessere von
morgen an tun. Wo die Studienpläne es erlauben, tun wir es ja
schon heute. Dass eine didaktische Unterstützungs- und
Beratungssstelle für interdisziplinäres Arbeiten und eine
kleine Projektbörse (im Haus der Universität!) zum Erfolg
des Unternehmens beitragen könnten, will ich nicht bestreiten;
aber besser ist vielleicht, was jeder Dozent auf Gegenseitigkeit von
seinen wechselnden Partnern im Lauf der Zeit persönlich aufnimmt
und weitergibt.
Die "Schwimmringe" zu "Flossen"
aufbauen!
Es scheint, dass viele Wissenschaftler nicht
wissen oder leicht und gerne vergessen, dass sie mit ihren
Disziplinen nicht auf Kontinenten oder grossen Inseln leben, sondern
vielleicht wie in Rettungsringen auf hoher See. Denn was wir erkennen
können, ist im Verhältnis zum Ganzen der Welt äusserst
punktuell, vorläufig und gefährdet. Interdisziplinär
arbeiten heisst jedoch weder über, noch im Leeren
zwischen den Disziplinen, sondern stets ausgehend von Disziplinen und
zusammen mit anderen Disziplinen, kurz mit und zwischen den
Disziplinen forschen, lehren und handeln; heisst vielleicht,
tragfähige Verbindungswerke zwischen den Rettungsringen bauen
nach dem Modell eines Organismus, in dem Zellen und Organe nur leben
und funktionieren können, wenn sie mit ihresgleichen in
Verbindung und Austausch existieren. Das ergibt zwar noch keine
Inseln, aber vielleicht wenigstens eine Art Flosse.
Top of Page