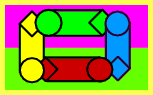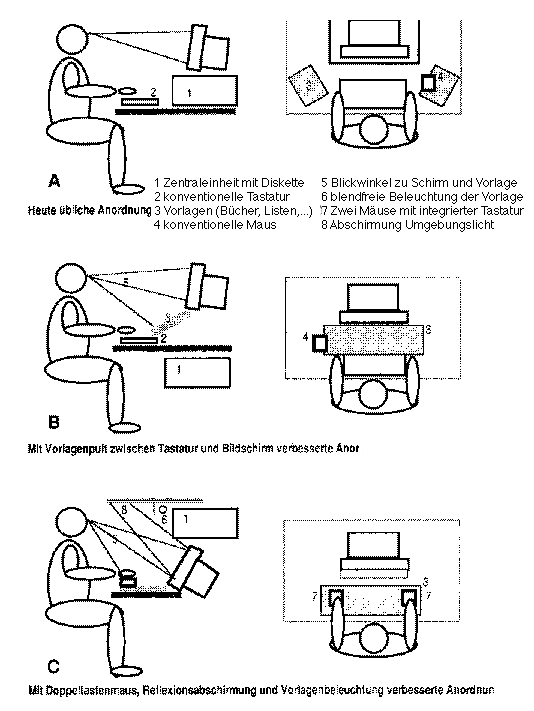Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 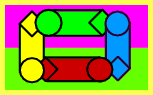 |
Journal Article 1990 |
Vom Bildungspotential der Mensch-Computer-Beziehung Ein Versuch zur Aufarbeitung einer verpassten Revolution | 1990.01 |
@HumComp @EnvPsy @CuPsy @Educ |
45 / 62KB 1 Abb.
Last revised 98.11.14 |
Informatik und Unterricht , Nummer 12, Februar 1990 7-17 | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Der
vorliegende Text beruht auf Teilen des Eröffnungsreferates am
Forum Informatik der Erziehungsdirektorenkonferenz, Valbella am 1.
-3. Juni 1989.
Inhalt
1.
Die Lehrer und die neuen Informationstechnologien
(NIT)
Das Forum Informatik der
Erziehungsdirektorenkonferenz hat seine Tagung 1989 unter den Titel
"Lehrer brauchen NIT -- NIT brauchen Lehrer" gestellt. Ich fasse die
beiden Sätze als Losungen des Zeitgeistes, vielleicht auch von
Interessengruppen, auf und möchte sie deshalb in ihrer Frageform
erläutern.
1.1 Brauchen Lehrer die neuen
Informationstechniken?
In den frühen 80er Jahren
hätte ich als Mikrocomputerfreak der ersten Stunde und aus einer
etwas radikalen Skepsis betreffend Schule heraus diese Frage mit
"nein" beantwortet. Dies in der Hoffnung, dass der Computer eine
einmalige Chance böte, die Schule ein bisschen auf den Kopf zu
stellen, dem Lehrer sein nicht ganz zweihundertjahrejunges
Übergewicht in der Bildung zu nehmen, das
Schüler-Lehrer-Verhältnis um dieses gekräftigte Dritte
herum, die Information, neu zu definieren. Die Vorstellung war
utopisch, aber nicht ganz irreal, weil die junge Generation mit
diesen Geräten so viel geschickter umgeht als die
ältere.
Inzwischen haben die Lehrer Tritt
gefasst. Eine neue Lehrerspezialisierung ist gefunden worden.
Informatik-Curricula wurden und werden konzipiert, Lehrerausbildung
dazu wird auf Trab gebracht. Bald ist Informatik -- wie
irgendein anderes Fach -- etabliert, mit Stoffplänen und
Prüfungsverfahren kanonisiert, mit nicht unbeträchtlichen
materiellen Investitionen auf Dauerexistenz abgesichert. Ihre
fächerübergreifende Bedeutung macht Informatik besonders
attraktiv, ja unentbehrlich. Anders als mit der "neuen Mathematik"
klappt die Innovation; denn Informatik verdrängt oder
verändert nichts, sie stockt vielmehr auf. Schliesslich ist
Informatik eine Technik, nicht bloss eine neue Sicht. Techniken waren
immer schon die kräftigeren Herrschaftsmittel als Ideen. Eine
Lehrerin oder ein Lehrer ohne Informatik, das würde von den
Schülern nicht mehr ernst genommen. Die erste Losung kann also
nicht mehr in Frage gestellt werden. Doch bleibt die Frage: was
für eine Informatik brauchen Lehrer?
1.2 Brauchen die neuen
Informationstechniken Lehrer?
Aus einer Verbindung von
differenzierter Sachkenntnis mit ungezügelter Phantasie heraus
bin ich auch zu einem "nein" auf diese Frage geneigt gewesen. Ich
hatte mir ausgemalt, wie Information mithilfe dieser Maschinen
und stark verbesserten Schnittstellen, "Gesichtern" und "Händen"
der Computer zum Menschen hin, im Zusammenleben und besonders in der
Bildung eine neue Rolle übernehmen könnte. Denn mit dem
Computer bekommt Information einige Eigenschaften, die bisher nur in
lebenden Systemen beobachtet worden sind. Im besonderen besteht die
Möglichkeit, Zeichensysteme höherer Ordnung auszubilden,
mit Repräsentationen von Repräsentationen (von
Repräsentationen...) und Operationen über Operationen
(über Operationen...) rational umzugehen. Die Formel von der
künstlichen Intelligenz, obwohl ich sie für
irreführend halte, versucht das auszudrücken.
Wenn die Computer (so meine
Fortführung des Arguments zur ersten Losung) wirklich ein
Potential hätten, die Schule aus ihren Verfestigungen
herauszureissen, dann könnte, ja, müsste dies
geschehen, ohne dass Lehrer die Verantwortung dafür
übernähmen. (Die Formel von der Verantwortung ist ja
zweideutig: die Macht über das Lernen übernimmt man wohl;
die daraus erwachsenden Konsequenzen müssen, ob sie wollen oder
nicht, später die Schüler tragen, seien sie angenehm oder
problematisch. Die unpersönliche Formulierung -- man --
sollte deutlich machen, dass ich nicht Schuld zuweisen will; die
Lehrer sind hier, wie die Schüler, weitgehend Gefangene ihrer
Rollen.)
Weitgehend, sage ich. Denn die
Lehrer hätten diesen Vorgang, die computerunterstützte
Revolution des Bildungswesens, eigentlich auch als ihreeigene Chance wahrnehmen können, nämlich indem sie
sich auf eine Rollenbereinigung eingelassen hätten. Von
den mehreren, untereinander im Konflikt stehenden Aufgaben ihres
Berufs hätten sie mit Gewinn einige an den Computer abgeben
können, um sich auf wesentliche Bereiche zu
konzentrieren:
Zum Beispiel
Informationsvermittlung: das kann der Computer, einmal
ausreichend entwickelt und vernetzt, graphisch und akustisch gereift,
einfach besser. Die besten Didaktiker hätten sich auf die
Entwicklung von modellhaften, interaktiven Lernumwelten konzentrieren
können, die pädagogischen Psychologen auf das Verstehen der
zwischen den Lernenden und den computerunterstützten
Lernumwelten entstehenden Austauschprozesse und ihrer
Folgen.
Zum Beispiel
Leistungsbewertung: die Welt selber, auch eine
Computermodellwelt, ist der optimale Bewerter. Statt Noten
auszuteilen, verweist sie über die Konsequenzen des Handelns auf
dessen Folgen und Sinn und steuert so jedes Lernen ungleich
gründlicher als der abstrakte Vergleich von gesetztem Lernziel
und Lernzielerfüllung oder der eklige, obwohl unumgängliche
Vergleich mit den Kameraden.
Entwicklungsbegleitung --
nein, das kann nur ein Mensch! Der Lehrer oder die Lehrerin, von der
Stoffvermittlung und von der Lernfortschrittsbewertung befreit,
hätte sich dem Kind zuwenden können, und das Kind
hätte sich der Lehrerin oder dem Lehrer zuwenden können.
Beide gemeinsam hätten aus der Stärke ihres gegenseitigen
Vertrauens heraus zum gesamten Stoff ein neues Verhältnis
gewinnen können: einen selbstverständlichen Abstand vom
Stoff, ein gemeinsam verabredetes Eingehen auf den Stoff. Befreit vom
Zwang zur Koalition des Lehrers mit dem Stoff, die sich nur allzu oft
gegen das Kind richtet, hätte das Lernen wieder ein Träger
von persönlicher und gemeinschaftlicher Entwicklung werden
können, anstatt ein zweifelhaftes Instrument der
Lebenschancenzuteilung, das nur zu oft falsche Hoffnungen vorgaukelt
und zugleich eigentlichen Lebenschancen im Wege steht. Wie wunderbar
leicht lernen doch kleine Kinder, lustvoll auf Neues gierig, wenn sie
voll Vertrauen von der Mutter oder Andern begleitet ihre
Entdeckungsreise in die Welt antreten! Und wie bereichernd ist es
für Kinder, immer wieder vorübergehend in die Lehrerrolle
zu schlüpfen -- lehrend lernt man am leichtesten -- für
andere, die etwas noch nicht ganz begreifen und bewältigen, bei
erträglichem Wissensvorsprung aus der Sicht der
Belehrten!
Mein Traum vom Computer als
Kartellbrecher der geläufigen Schulorganisation war
natürlich rasch ausgeträumt. Ich wollte ihn nicht
unterdrücken, weil er auch nach der verpassten Revolution noch
auf einen Spielraum hinweist, den der einzelne Lehrer hat und nutzen
könnte. Mit Hilfe der Informatik könnte nämlich die
Lehrer-Schüler-Beziehung zu einer neuen Partnerschaft werden, in
welcher der Stoff und die Bewertung nicht mehr so unbedingt
dazwischenstehen. Das setzt ein differenzierteres Verständnis
des Dritten in der Gruppe, des Computers, voraus.
1.3 Was für Lehrer braucht die
Informatik? Was für eine Informatik brauchen die
Lehrer?
Wenden wir uns also der
Realsituation zu. Die Schule hat Computer eingekauft -- oder sollte
ich sagen, sie wurde und wird vom Computer aufgekauft? Die kurze
Epoche der Polarisierung der Gesellschaft durch den Computer geht
ihrem Ende zu. Sich gegen den Computer Sträuben, ist genau so
sinnlos, wie sich ihm Ergeben. Wie können wir nun das beste aus
der Situation machen?
So wie es gelaufen ist, brauchen
die neuen Techniken natürlich Lehrer. Sie brauchen im
Interesse der Menschen solche Lehrer, welche sich nicht von den neuen
Informations-Techniken vereinnahmen lassen. Menschen, welche in
der Art und Weise, wie sie mit Informatik umgehen, erkennen lassen,
dass sie sich mit Kenntnis und Überblick über die Sache
nicht begnügen, sondern Durchblick haben.
Da verdient schon die Sprache, in
der die NIT daherkommen, Beachtung. Die beiden
Tagungstitelsätzchen repräsentieren nämlich
Grundstrukturen unseres abendländischen Weltbildes; sie kommen
mir wie ein Schlaglicht auf unsere Zivilisation vor, dies je für
sich und in ihrer Verbindung.
(1) Die sprachliche Struktur jedes Sätzchens ist: Subjekt und Objekt -- so ist die Welt eingeteilt, unsere Sprache kann eigentlich gar nicht anders: Lehrer gegenüber Technik; Benutzer gegenüber Computer; Lehrer gegenüber Schüler; Schüler gegenüber Lehrer; wir, ich gegenüber allem anderen. (2) Das Prädikat des Satzes, die gewählte Verbindung von Subjekt und Objekt, ist bei Losungen eine Relation des Sollens, der Forderung: "Brauchen" meint: so soll, so muss es sein, ungeachtet dessen was ist, oder dessen was auch sein oder werden könnte.
(3) Das zweite Sätzchen kehrt das erste um; das vorige Objekt wird zum Subjekt, das vorige Subjekt dann notwendig zum Objekt. Was in der Welt nicht geht, nämlich dass Dinge, Werkzeuge, Techniken handeln, schafft die Sprache spielend; und wir glauben es der Sprache, und lassen uns behandeln und ge- und verbrauchen von den Dingen, Werkzeugen, Techniken, während wir sie gleichzeitig für unsere "Objekte" halten. (Am Mensch-Umwelt-Bezug allgemein interessierte Leser seien auf Lang 1988 hingewiesen.)
Die Kommission, die den Titel
formuliert hat, möge meine Analyse verzeihen. Doch bin ich
dankbar für ihre erhellende Sprache, die mich herausgefordert
hat wie ein Programm, das noch nicht elegant genug ist. Und es ist ja
wirklich was dran, an dieser Umkehrung von Subjekt und Objekt, ob
erwünscht oder nicht. Als Tatsachenfeststellung mit der
banaleren Bedeutung von "brauchen" = verwenden stimmen beide
Sätzchen. Meint man sie als Sollensforderungen, muss man jedoch
doppelt fragen:
Was für Lehrer braucht die
Informatik? Und was für eine Informatik brauchen die Lehrer?
Was ist, kann, möchte, bewirkt, soll, darf... die
Informatik? Und welche Rolle können, sollen, dürfen,
müssen, wollen (!)... Lehrer dabei spielen? Stellen wir das
"Brauchen" als Sollen zunächst zurück, um etwas
unbehinderter verstehen zu können.
Inhalt
2.
Die Mensch-Computer-Beziehung oder "Schnittstelle" auf drei
Ebenen
Ich habe mein Nachdenken über
Mensch und Computer unter das unscheinbare Wort "Beziehung"
gestellt. Gerne spreche ich auch von "Partnerschaft", was ja
ein besonderer Fall von Beziehung ist. Partnerschaften zeichnen sich
aus durch eine gewisse Symmetrie der Beziehung; das schliesst
Verschiedenheit der Partner nicht aus. Partnerschaften missversteht
man jedoch, wenn man nur vom einen Beziehungspartner her schaut;
jeder Partner für sich genommen ist unvollständig. Man muss
eine dritte Position einzunehmen versuchen, jeden der beiden engeren
Blickpunkte relativieren, die Perspektive wechseln
können
Genau das will ich nun weiter tun:
die Mensch-Computer-Beziehung als ganze zu verstehen suchen.
War bisher von wirklichen und möglichen Partnerschaften zwischen
Lehrern und Schülern die Rede, so möchte ich nun den Blick
auf die Beziehung zwischen dem typischen Computer und seinem
typischen Benutzer richten. Im Vordergrund meiner Überlegungen
steht der sog. persönliche Universalcomputer, der in der Schule
dominiert, auf der einen Seite, und ein Mensch wie Du und ich auf der
andern. Eine an sich nötige tiefergehende Betrachtung der
Eigenheiten und Funktionsweisen der beiden "Partner" kann hier nicht
geleistet werden. Von besonderem Interesse dürfte aber die
sog. Schnittstelle zwischen Mensch und Computer
(M-C-"Schnittstelle") sein. Denn dort verwirklicht sich die Beziehung
konkret, dort sollte ihre Bedeutung am deutlichsten ablesbar sein.
Schnittstelle oder Interface (wörtlich "Zwischengesicht") heisst
der Träger der Informationsaustauschprozesse zwischen den
Partnern.
Auch diese sprachliche Bezeichnung
ist irreführend; denn M-C-"Schnittstellen" haben stets
Tiefe. Erstens wird die über die M-C-Schnittstelle
fliessende Information vorher und nachher in Stufen mehrfach im
Trägercode gewandelt, wodurch sie auch im Inhalt nicht
unverändert bleibt; zweitens stellt die über die
M-C-Schnittstelle in beiden Richtungen kommunizierte Information
stets nur einen Auszug aus der Gesamtinformation des
jeweiligen Senders dar und muss im jeweiligen Empfänger in
seiner eigenen Form in die dort schon bestehende Struktur
integriert werden. Man sollte sich bei dieser Betrachtung nicht
dadurch täuschen lassen, dass zwischen je einer der
Transformationsstufen auf beiden Seiten durchaus eine gute
Korrespondenz bestehen kann, zB zwischen Bytes und gelesenen
Buchstaben, dass aber auf einer einzelnen Stufe weder die
raumzeitliche Organisation solcher Elemente noch ihre Bedeutungen und
ihr Kontext schon mitenthalten sind. Es ist also die Analogie oder
der Übertragungsversuch von der technischen zur
M-C-"Schnittstelle" bedenklich falsch, wenn man davon ausgeht, dass
eine technische Schnittstelle ein Informationswandler ist, welcher
zur Immunisierung gegen Störung und zur Rekonstruktion im
Empfänger der vom Sender abgegebenen Information optimalisiert
ist. Oder will wirklich jemand in einem Computer die in seinem
Benutzer aktualisierte Information so gut wie nur möglich
approximieren und den Computer-Output als solchen in seinen Benutzer
hinein"spielen"?
Ich denke deshalb, dass es sich
lohnen müsste, die M-C-"Schnittstelle" genauer und
interdisziplinär zu untersuchen. In einer umfassenden
Übersicht lässt sich die "Schnittstelle" oder Beziehung auf
drei Ebenen sehen, welche je unterschiedlich tief in die beiden
Partner hinein- und darüber hinausreichen. Im Folgenden kann ich
bloss Schlaglichter auf verschiedene ihrer Aspekte werfen; für
Vertiefung muss ich auf die einschlägige Literatur verweisen
(vgl. die Liste im Anhang, nähere Angaben bei Lang & Fuhrer
i.V.). Faktenfeststellungen sowie Deutungen von und Kritik an
herkömmlichen Praktiken und erhellende Hinweise auf
Alternativen, also wertende Sätze, sollen nicht streng
voneinander geschieden werden, weil es mir in erster Linie um ein
Aufbrechen gewohnter Sichten und Denkweisen geht. Sicher kann und
muss man die drei Ebenen forschungsmethodisch und didaktisch
auseinanderhalten; in der Wirklichkeit kommt jedoch keine von ihnen
je allein vor. Deshalb ist es wohl angezeigt, bei jedem Umgang mit
Computer-Situationen die drei Beziehungsebenen in ihrer gegenseitigen
Durchdringung stets mitzudenken.
2.1 Mikroebene: die
ergonomische Schnittstelle oder das Hin und Her
von Information
Hier geht es um Eigenschaften an
den "Oberflächen" der beiden Partner, konkret um Bildschirm und
Tastatur auf der einen, Auge und Hand auf der andern Seite. Der
Hardware-Ergonomie der Gestaltung, Aufstellung,
Funktionalisierung dieser Gebilde geht die sogenannte
Software-Ergonomie, Software-Psychologie oder die "Human
Factors in Computing" zur Seite. Thematisiert werden hier
beispielsweise Formen und Anordnungen von Material auf dem Bildschirm
präsentierter Information und die vom Benutzer verlangten
Verhaltensweisen. Es ist zweifellos in diesen beiden Bereichen in den
vergangenen Jahren sehr viel Geschicktes zur Optimalisierung
der Schnittstelle geschehen. Der gängige (und wiederum
sprachlich fragwürdige) Ausdruck der
Benützerfreundlichkeit sollte aber nicht vergessen
machen, dass eigentliche Bewertungskriterien für diese so
genannte bessere Anpassung des Computers an den Menschen nach wie vor
fehlen, von ein paar Selbstverständlichkeiten bezüglich
Variablen wie Flimmerfrequenz, Schriftbildlesbarkeit u.dgl. einmal
abgesehen. Sicher darf die oft angezielte Maximierung der
Bearbeitungsgeschwindigkeit nicht ein umfassendes Kriterium sein. Bei
andern Aspekten wie zB der Blendfreiheit sind zwar die Probleme
erkannt, ihre Umsetzung in die Praxis am Aufstellungsort der
Geräte ist aber immer noch weitgehend im Argen (vgl. dazu
Abbildung 1). Und überdies lässt der um die Anpassung des
Computers an den Menschen entstandene Rummel heute wieder wie
früher und zum Schaden des Benutzers allzu leicht
übersehen, dass nach wie vor der Löwenanteil der Anpassung
nicht vom Konstrukteur des Computers sondern von seinem Benutzer
verlangt und von diesem wohl oder übel geleistet
wird.
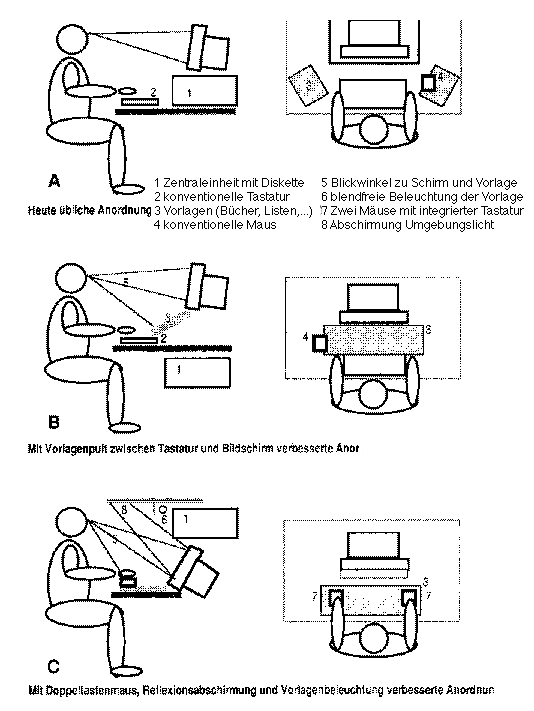
Abbildung 1: Ergonomie der
Mensch-Computer-Anordnung
Die schematisch dargestellten
Anordnungen sind als Denk- und Probieranregungen intendiert. (A) wird
im Text ausgiebig analysiert. (B) lässt sich
verhältnismässig leicht improvisieren. Leider liegen noch
keine ergonomischen Untersuchungen darüber vor. (C) würde
gründliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für ein
kombiniertes Einhand-Tastatur- und Zeige-Gerät voraussetzen.
Bisher gibt es dazu nur konzeptuelle Vorarbeiten.
2.2 Mesoebene: die
mentale Schnittstelle oder die beidseitigen
Hintergründe der Partner
Die Ergonomie droht auch
abzulenken von den Tiefenstrukturen der Schnittstelle auf beiden
Seiten. Ich werde in meinen weiteren Ausführungen klar zu machen
versuchen, dass Information im Teilsystem Mensch und im Teilsystem
Computer auf unterschiedliche Träger oder Codes angewiesen ist
und daher in diesen beiden Systemen auch unterschiedliche Formen und
Inhalte aufweist. Mit dem aus seiner üblichen Bedeutung
ausgeweiteten Begriff der Mentalität möchte ich auf
dieser Ebene auf Kontraste und auch auf die daraus resultierende
Dialektik an der Schnittstelle aufmerksam machen. Der Satz:
Das eigentliche Bild ist nicht auf dem Bildschirm, sondern im Kopf
des Benutzers, ist eine Einsicht, an die sich vermehrt Analysen
der impliziten Annahmen anschliessen sollten, welche der
Computerbenutzer über das Geschehen im Computer und welche der
Computerkonstrukteur und insbesondere der Programmierer über das
Geschehen im Kopf des Benutzers unvermeidlicherweise machen. Die
Intelligenz des Computers ist eben nicht die Intelligenz des
Menschen.
2.3 Makroebene: die
kulturelle Schnittstelle oder die Intensivierung
des sozialen Verbands
Die kulturelle Schnittstelle
schliesslich bezieht sich auf etwas, was seit einiger Zeit als die
"gesellschaftliche Dimension" der Informatik durchaus intensiv und
kontrovers diskutiert wird. Es geht konkret um die Folgen, welche die
Einführung der Computerei für das menschliche Zusammenleben
auf kurze und weitere Sicht zeitigen wird. Wieder wäre mir
lieber, wenn die sinnleeren Schwarz-Weiss-Polarisierungen (zB Frisst
oder schafft die Informatik Arbeitsplätze?) von
differenzierteren und kulturgeschichtlich fundierten Analysen
abgelöst oder wenigstens komplementiert würden (zB was
für Arbeitsvorgänge verändern oder schaffen diese
neuen Maschinen?). Betrachtungen über gesellschaftliche
Funktionen der Informatik kann ich aber hier aus Zeitgründen nur
andeuten.
Inhalt
3.
Informatik meint ein Mensch-Maschine-System als ein Ganzes -- oder
der Computer ist nicht einfach ein Objekt oder eine
Technik
Wenn diese Beschreibung des
wechselseitigen Inbezugtretens von Mensch und Computer auch nur
annährend zutrifft, so muss daraus eine These abgeleitet werden,
welche ich im dritten Teil dieser Betrachtungen formulieren und
erläutern möchte.
Bei den neuen Informationstechniken darf man nicht die Technik für sich sehen. Ein Computer für sich genommen ist ein wertloser Klumpen Plastic, Kupfer und Silikon, in dem Elektronen hektische Bahnen laufen; als Bestandteil eines Systems Mensch-Computer ist er jedoch ein aussergewöhnliches Produkt und Instrument der kulturellen Evolution des Menschen auf der Basis seiner biologischen Evolution.
3.1 Objektcharakter vs.
Systemcharakter von Computer und Benutzer
Den Computer kann man als
ein Objekt sehen, vom Menschen gemacht und daher im Belieben
des Menschen. Mit diesem engen Blick wird man ihn missverstehen. Auch
das Rad ist so ein Objekt. In Verbindung mit menschlichen
Aktivitäten ist es weit mehr: aus dem Karren zum
Gütertransport sind umfassende gesellschaftliche
Vernetzungssysteme geworden: die Räder an den Fahrzeugen haben
dann Strassen, Städte, Nationen hervorgebracht, die Räder
in den Uhren und den Maschinen haben die arbeitsteilige
Industriegesellschaft ermöglicht, haben Fabriken erzeugt, die
Städte zerstückelt und das Land zersiedelt. Von der
Töpferscheibe bis zur Werkzeugmaschine haben Räder zusammen
mit Menschen eine unglaubliche Dynamik entfaltet. Alle diese
Räder und was an ihnen hängt, sind längst nicht mehr
im Belieben des Menschen, der sie brauchen oder nicht brauchen, oder
der sie lieber auf eine andere als die von ihnen erzwungene Weise
gebrauchen möchte.
Ich versuche derartige Erfahrungen
auf das Feld der neuen Informationstechniken zu übertragen,
indem ich einige der zentralen Begriffe des Mensch-Computer-Systems
analysiere.
Der Ausdruck
Informationstechnologie steht ebenfalls noch nahe beim Objekt,
bei einem instrumentell gedachten, verallgemeinerten Werkzeug,
das in unserer Hand ist und nach unserem Belieben eingesetzt werden
kann. Vielleicht drückt sich im Wort "Technologie" unser
schlechtes Gefühl oder Gewissen aus: Gemeint ist ja einfach
eine allgemeine Technik, ein praktischer Vollzug von Ideen zu
Zwecken. "Technologie" müsste wörtlich auf eine Lehre
über, auf unser Verständnis von Technik verweisen. Ich
denke nicht, dass wir ein solches haben; der Ausdruck verwechselt
Wunsch mit Wirklichkeit. Wir sollten im Auge behalten, dass wir vom
Computer im günstigen Fall etwa so viel oder wenig verstehen,
wie vielleicht die Römer vom Rad: eine nützliche
Transporttechnik, noch kaum eine Ahnung von ihrer Langzeitwirkung als
einer evolutiven gesellschaftlichen Kraft.
Der Ausdruck Informatik ist
von allen üblichen derjenige, der am meisten auf die
Mensch-Maschine-Einheit bezugnimmt. Wenn er nicht so abstrakt und
damit so handlich wäre, könnte er darauf verweisen, dass es
um ein System mit zwei Teilsystemen geht, zwischen denen ein
Informationsfluss besteht und das über
Informationsflüsse mit weiteren Systemen, Menschen und
Maschinen, koordiniert ist. Die beiden Teilsysteme sind zunächst
der Computer und der Mensch; beide sind ihrerseits in Subsysteme
differenzierbar. Beide Teilsysteme können wir als
materiell-energetische Gebilde betrachten, deren Zustand sich
raum-zeitlich von Zeitpunkt zu Zeitpunkt verändert, und deren
hauptsächlichen Zweck oder Sinn wir darin erblicken, dass sie
auf Informationsverarbeitung angelegt sind.
Unter Information verstehe
ich mögliche Zustände bzw. die systematische
Zustandsvariation eines Gebildes, sofern diese für ein anderes
Gebilde etwas bedeutet. Der Informationsfluss vom einen zum anderen
Gebilde bewirkt im empfangenden Gebilde eine Veränderung derart,
dass der bisherige Zustand des empfangenden Gebildes kombiniert mit
der vom sendenden hereinkommenden Information einen neuen Zustand
hervorruft, der weder aus dem bisherigen Zustand des empfangenden
Gebildes selber noch allein aus dem Zustand des
informationsabgebenden Gebildes erklärt werden kann. (Es wird
häufig zwischen kommunikativer Information (zwischen Systemen)
und signifikativer Information (eines Systems für sich)
unterschieden; das ist nur sinnvoll, wenn man nicht übersieht,
dass auch Signifikation nur für einen informierbaren Betrachter
zustandekommt. Die Bits und Bytes im Computer-Memory allein sind
nicht für sich schon Information, sondern bloss ein
Informationspotential für andere Gebilde, welche den Code
kennen.)
Die Psychologie
beschäftigt sich allgemein mit dem Informationsaustausch
von lebenden Gebilden wie Menschen und Tieren mit ihrer Umgebung (so
meine etwas ungewöhnliche Definiton dieses Faches). Das ist
analog dem Interesse der Biologie für den Stoffwechsel und
Energieaustausch von lebenden Gebilden mit ihrer Umgebung. Die beiden
Austauschvorgänge sind nicht ganz voneinander zu trennen, weil
ja die Information, wenn sie im Zustand eines Gebildes "schlummert"
und wenn sie von Gebilde zu Gebilde fliesst, stets einen
materiell-energetischen Träger braucht.
So gesehen ist also auch der
Mensch ein informationsverarbeitendes System, welches
Information aus der umgebenden Welt wahrnehmend aufnimmt und handelnd
in sie abgibt, insofern Spuren von seinem Handeln in der Umwelt und
bei anderen Menschen zurückbleiben. Offensichtlich besteht eine
Analogie zwischen Menschen und den "intelligenten" Maschinen. Wollen
wir die "Schnittstelle" oder Beziehung zwischen diesen beiden
"intelligenten" Systemen unter dem Aspekt ihres
Informationsaustausches verstehen, so müssten wir nun
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen und Computern
nachdenken.
Das ist hier nicht möglich
(vgl. Ansätze dazu bei Lang i.V.). Er ist umso schwieriger
geworden, als sich seit einiger Zeit in weiten Teilen der Psychologie
eingebürgert hat, die informationsverarbeitenden Züge des
Menschen auf der Basis von Computerstrukturen und -algorithmen zu
modellieren. Dafür ist der Ausdruck "Computer-Metapher"
geläufig geworden. Als deskriptive Unternehmung verzeichnet
dieser Ansatz um den Preis einer Einengung der Sicht
beträchtliche Erfolge (Überblick bei Mandl & Spada
1988). Problematischer sind seine explikativen Ziele, da es sich ja
beim Computer um eine Hervorbringung gerade des zu erklärenden
Menschen handelt, mithin logisch ein Zirkularitätsrisiko
besteht. Eine Konsequenz dieser Vorgehensweise ist, dass man den dem
Computer zugeschriebenen Objektcharakter auch auf den Menschen
überträgt. Anstelle eines systematischen Zugangs zum
Problem versuche ich hier bloss, mit einigen Schlaglichtern
kulturgeschichtliche Einsichten zu evozieren.
3.2 Die konkrete
Gegenüberstellung von Mensch und Computer
Bisher war von der
Gegenüberstellung von Mensch und Computer als Subjekt und Objekt
und von ihrem gelegentlich vollzogenen Rollentausch in
allgemein-abstrakten Weise die Rede. Wenn wir von Information und
ihrem Fluss sprechen, so bewegen wir uns primär auf der mentalen
oder Mesoebene, die stets auf der Mikroebene konkretisiert werden
muss. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass dieser Gegensatz
ergonomisch so plump seinen Ausdruck findet. Wir stellen den Computer
zumeist als einen groben Kasten direkt vor uns hin, so dass er unser
Gesichtsfeld und unseren Arbeitsplatz fast ganz ausfüllt. Sein
"Gesicht", der Bildschirm, von dem wir den Informationsfluss
ablesen, muss ja schon gegenüber stehen, das leuchtet
funktionell ein; aber er könnte ohne funktionellen Schaden auch
so konstruiert werden, dass man ihn neben anderen
Informationsflüssen freier wählen könnte.
Ich kenne eine Sekretärin,
die hat den Schirm ihrer Textmaschine seitlich auf ein ziemlich hohes
Gestell plaziert. Sie schaut nur ausnahmesweise hin; weil sie so gut
blind schreiben könne, sagt sie. Ich denke, sie versucht gegen
beträchtlichen Widerstand des normierten Industrieprodukts und
gegen den Konformismusdruck arbeitsbezogener Rituale ihr
Verhältnis zum Computer auf eigene Weise zu finden, für
sich selbst zu definieren -- vermutlich nicht nur zu ihrem
Vorteil.
Noch stärker gilt diese
Vereinnahmung des Menschen durch sein selbstgeschaffenes Objekt
für die Tastatur, diesen technischen Saurier, den man mit
Beifügungen wie Maus und Tablett nur noch monströser
gemacht hat. Die Tastatur stiehlt uns den zentralen Teil unseres
Pultes, macht ihn für andere Tätigkeiten unbrauchbar,
stellt sich platzfüllend vor uns hin, merkwürdige
Verhaltensweisen von uns fordernd. Natürlich passt sich, wie
immer, der Mensch an; das zum Subjekt gewordene Objekt Computer ist
stärker.
Ich will das alles nicht weiter
ausführen, möchte aber die Entwicklung von Übungen
empfehlen, in denen man mittels Spiel mit unterschiedlichen
räumlichen Anordnungen von Mensch und Computer beim Benutzer ein
Sensorium für die Mehrschichtigkeit entwickeln, den Sinn
für verschiedene Rollenzuteilungen in der Partnerschaft
fördern könnte. Eine kecke Idee und einfache Sache ist zB
ein Lesepültchen zwischen Tastatur und Bildschirm (vgl. Abb. 1).
Vom Ergonomischen gehen nicht unbeträchtliche Auswirkungen auf
das Mentale aus (das war schon immer so); und (ich will nicht
übertreiben) ganz ohne Relevanz für das Sozio-Kulturelle
ist es auch nicht, wie wir mit diesen Gebilden unsere Welt
möblieren. Nichts gegen die technische Optimalisierung der
Mensch-Computer-Schnittstelle (zB Streitz 1988, Balzert 1988 u.a.);
sie greift mir nur etwas kurz, braucht technikübergreifende
Perspektiven.
Soweit meine rudimentären
Hinweise gewissermassen auf aktuelle und künftige Geschichten
des Computers in unserer Materialkultur. Mich reizt auch eine
rückwärtige Betrachtung, und die beginnt wieder auf der
mentalen Ebene und weitet sich dann ins Grosse und Kleine
aus.
3.3 Das Ende des Dualismus oder
Descartes' zweifelhafter Triumph
Wenn ich den Ausdruck "Gebilde"
als den neutralsten bezüglich der Natur von beobachtbaren
Gegebenheiten gewählt habe, so deswegen, weil wir in dieser
Hinsicht leicht Vorurteilen verfallen, indem wir oft etwas
bezeichnen, bevor wir verstehen, was es ist. Der Mensch ist lebend,
der Computer nicht -- das will ich akzeptieren; der Mensch agiert,
der Computer reagiert (wie er programmiert ist) -- da habe ich schon
Mühe, so klar geschieden ist das nicht; der Mensch ist ein
geistiges Wesen, der Computer ein materielles -- da weiss ich nicht,
was das bedeuten soll. Mit "Vorurteil" verweise ich hier auf das
abendländische Erbe des ontologischen Dualismus. Mit der
Behauptung, alles sei materiell und das Idelle Schein, ist der
Dualismus natürlich genau so wenig aus der Welt geschafft wie
mit der gegenteiligen Behauptung, das Materielle sei einfach eine
Konkretisierung von Ideen.
Um diese Geschichte
zugänglicher zu machen, möchte ich sie personalisieren in
der fiktiven These, der Computer sei Descartes' wahrer
Triumph. Betrachtet man aber Mensch-Computer-Systeme, so gilt die
Antithese, es sei gerade durch den Computer, der dessen
Methode in so hohem Masse erfülle und vollziehe, Descartes
gründlich widerlegt; und mithin sei jetzt gewissermassen das
Ende der Neuzeit nahe.
Descartes, der französische
Universalgelehrte der ersten Hälfte des 17. Jh. gilt als einer
der wichtigsten Begründer des wissenschaftlichen Zeitalters. Er
ist nicht nur der Erfinder der analytischen Geometrie, sondern hat
mit der Loslösung der Methode (cogito: was denkt, was
gedacht wird) von ihrem Gegenstand (sum: was ist) dem
Dualismus der Neuzeit wohl den stärksten Impuls gegeben. Was
"klar und deutlich" im Geiste (res cogitans)
repräsentiert ist, das ist die wahre Erkenntnis von der
gefühlten, diffusen, täuschenden Wirklichkeit des Leibes
und der materiellen Körper (res extensa). In der
analytischen Geometrie schaffte er es, den
unzulänglichen, weil bloss anschaulichen Umgang mit der
räumlichen Welt in scharfe, rationale Formeln der Algebra
umzusetzen: ein Triumph des Geistes über das Materielle, die
totale Beherrschung des Materiellen durch das Geistige, eine der
Geburtsstunden modernen Machertums. Mit dieser Trennungslogik ist die
Entwicklung unseres Wissenschaftensystems und der daran
anschliessenden Techniken bzw. Technologien angelegt. Was im
Binärsystem abgebildet werden kann, kann auch der binären
Logik (dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten) unterzogen werden, und
wird, wenn die Logik aufgeht, "klar und deutlich" erfasst und
handhabbar. Für Descartes müsste der Computer die
Erfüllung seiner kühnsten Träume sein. Der Computer,
eine Emanation der res cogitans, verkörpert den Gipfel
des rationalen Zeitalters.
Bis man den Menschen in die
Betrachtung mit einbezieht. Dann zerfällt unmittelbar der
Dualismus; denn er führt zu absurden Konsequenzen.
Offensichtlich ist der Computer eine Maschine, ein Automat, wie
Descartes sagen müsste, da er Tiere als Automaten beschrieb,
also das rein Körperliche, nämlich Maschinen ohne den
rationalen Geist. Wenn jetzt aber das "Klare und Deutliche"
ausgerechnet in und durch eine Maschine zustandekommt, dann kann
etwas nicht stimmen mit der Unterscheidung; dann ist entweder der
Mensch nichts so besonderes mehr, weil auf einer Stufe mit dem
Materiellen, oder das Materielle, Täuschende macht sich auf
seine Weise und völlig überraschend geltend.
Es ist in diesem (metaphysischen)
Zusammenhang äusserst spannend zu beobachten, wie Computer immer
wieder heftige Gefühle, Faszination und existentielle Bedrohung
auslösen bei Menschen, die sich ungesichert durch Routine auf
sie einlassen (vgl. etwa die Beispiele bei Volpert 1985, Rosemann
1986 oder Faulstich & Faulstich-Wieland 1988). Die amerikanische
Ethnologin Sherry Turkle (1984) hat besonders aufschlussreiche
Beobachtungen und Befragungen von Kindern aller Altersstufen dazu
vorgelegt. Offenbar fordert der Computer als ein "evokatorisches"
(Turkle 1984) oder magisches Objekt (vgl. Boesch 1983) im
unbefangenen Benutzer massive metaphysische
Auseinandersetzungen heraus, die genau mit dem traditionellen
Dualismus bzw. dem daraus hervorgegangenen seichten Materialismus
unseres gängigen Weltbildes konfrontiert sind und damit zu Rande
kommen müssen
Turkle hat bei Kindern und
Erwachsenen typische Entwicklungsstufen dieser Auseinandersetzung
unterschieden. Zunächst werden der Maschine menschliche
Eigenschaften zugeschrieben; dann beginnt aber der Mensch rasch,
über sich selbst nachzudenken, und zwar bevorzugt in Termini der
Maschine ("Computer-Metapher" als psychologische Theorie). Nach
dieser Anthropomorphisierung der Maschine und dieser
Mechanomorphisierung des Menschen (Caporael 1987), die beide
genau dem dualistischen Denkschema verhaftet sind, folgt im
günstigen Fall die Relativierung von beidem. Der Mensch
befreit sich von der subjektzentrierten wie von der objektzentrierten
Sicht der Welt. Er sieht dann ein, dass beide Sichten nicht
Welteigenschaften sind, sondern bloss Ergebnisse von Wechselwirkung
im System Mensch und Maschine (vgl. auch Lang 1988).
Dass man Kinder und Erwachsene bei
diesem Stufengang behutsam unterstützen sollte, scheint mir eine
wichtige Aufgabe des Informatiklehrers. Das braucht nicht so
abstrakt-philosphisch vor sich zu gehen, wie ich es hier beschreibe.
Die metaphysischen Abenteuer von Vor- und Grundschulkindern, wie sie
Turkle berichtet, sie sind oft spannender als ein Kriminalroman; und
sie sind nicht nur stellvertretend existentiell.
Es ist auch nicht nur ein
individueller Einsichtsprozess, der hier sichtbar wird, sondern ein
allgemeiner Vorgang der Erkenntnisgewinnung über die
Erkenntnismittel, bei der die Informatik Geburtshelfer spielt. Ich
kann noch einmal an Descartes anknüpfen. In der Tat ist der
Computer einsame Spitze im Rationalmachen von sonst nicht
bewältigbaren Zuständen und Vorgängen. Wenn das
Programm stehen bleibt, dann stimmt etwas nicht mit der Theorie bzw.
dem die Theorie verkörpernden Algorithmus. Descartes müsste
begeistert gewesen sein über so viel "Klarheit und
Deutlichkeit", falls er den Schock über die Materialisierung der
res cogitans rasch überwunden hätte.
Das stimmt aber wieder nur, wenn
man den Computer allein betrachtet. Nimmt man den Menschen dazu, so
ist heute schon offensichtlich, dass der Computer zunehmend wichtiger
wird als ein ideales Verfahren zu Anschaulichmachung von überaus
komplexen und dynamischen Zusammenhängen. Er erlaubt
gewissermassen, die analytische Geometrie auf den Kopf zu
stellen: Was äusserst komplex, aber durch gute Theorie klar
und deutlich geworden ist, kann nun mit geschickter Modellierung
wieder in eine solche Form gebracht werden, dass es menschlichem
Denken und Fühlen, nämlich der Intuition, überhaupt
zugänglich wird, so zugänglich wird wie der Umgang mit den
alltäglichen Dingen. Man denke an dynamische Computermodelle von
Naturgesetzen wie Ballistik oder von menschgemachten Komplexen wie
Industrieanlagen. Und sie können erst noch interaktiv sein, im
ausprobierend spielerischen Umgang mit den Modellwelten ist für
jedermann und jedefrau zu spüren, nachzuerleben, mit lebensnaher
Aufregung durchzumachen, was das abstrakte Gleichungssystem wirklich
enthält. Bisher leisteten das nur die begabtesten Mathematiker;
und sie konnten es nicht weitergeben.
3.4 Programme zum Abschnurrenlassen
oder "offene Informatik"
Die Überwindung dieser
Dualismen von Materie und Geist, von Denken und Fühlen, von
Subjekt und Objekt hin zu einer konstruktiven Dialektik zwischen
beiden möchte ich noch anhand eines ebenfalls der Didaktik
näherkommenden Vorgangs verdeutlichen. Ich meine den Unterschied
zwischen dem Ablaufenlassen eines Programms und dem
kreativenDialog mit einer Programmstruktur.
Informatik ist eine Chance, auf
normative Setzungen verzichten oder sie jedenfalls abschwächen
zu können, weil die Informationsstruktur einer im Computer
modellierten Sache ähnlich wie eine zugängliche
Wirklichkeit selber erklärt, ob sie funktioniert oder nicht. Man
vergleiche dies mit Unterricht in Grammatik von Sprachen
beispielsweise: hier muss per Konvention eine Norm festgelegt und ihr
Erwerb und ihre Einhaltung durch den Schüler vom Lehrer
überprüft werden; auch dann, wenn der Lehrende diese Norm
längst in Frage stellt. Auswendiglernen(lassen) der Norm ist der
für beide Beteiligten naheliegende "Ausweg", über dessen
Absurdität die meisten Beteiligten sich einig sind.
Man kann natürlich auch im
Informatikunterricht Programmziele normieren und Algorithmen zum
Abschnurrenlassen herstellen lassen. Aber ähnlich wie beim
kreativen Umgang mit Sprache (ob Texte oder grammatische Sichten
darauf) ist gute Software wie ein Gebirge, in dem jedes
geglückte Wegstück mehr ist als ein erreichtes Ziel,
nämlich auch die Eröffnung neuer Sichten und neuer Wege,
neuer Möglichkeiten und Herausforderungen; und man kommt um das
Herausgefordertsein, Abwägen und Wählen gar nicht herum.
Beim Programmieren ist das wohl am ausgeprägtesten der Fall. Es
ist bedauerlich, dass der Ausdruck "Hacker" seinen
ursprünglichen Pioniersinn so rasch einem Widersinn hat lassen
müssen.
Aber es gibt auch spezielle und
universellere Standard-Applikationen in bestimmten Sachbereichen, die
durchaus mit dem Programmieren verglichen werden können und die
manchmal widerständige, manchmal anregende Partner sind für
Dialoge im beschriebenen Sinn. Ich möchte solche Strukturen
als offene Informatik bezeichnen. Dabei denke ich an manche
Grafikprogramme, an Modellsimulationen, sogar an kreativ betriebene
Tabellenkalkulation oder Textbearbeitung; gerade im Umgang mit dem
Wort scheint sich Einiges anzubahnen, was wir noch schlecht absehen
können. Leider erfüllt Spiel-Software solche Kriterien
heute noch selten. Mir scheint, dass Informatikunterricht darauf hin
angelegt werden kann und soll, den Benutzer für die kreativen
Angebote des Computerpartners zu sensibilisieren.
Inhalt
4.
Vom Potential der Mensch-Computer-"Partnerschaft"
Mit der vorgebrachten Kritik an
der Objektivierung des Computers will ich nicht die
technischen Aspekte der Computerei schlecht machen. Ich
bekenne gerne, dass ich sie geniesse und kaum mehr ohne sie auskommen
könnte. Aber der Gewinn, den mir diese materielle Manifestation
menschlicher Kulturtätigkeit in ideeller Hinsicht
gebracht hat, nämlich insbesondere das Verständnis der
verschiedenen Formen, die Information annehmen kann, und wie sie
dabei ihren Charakter ändern kann, usw.: das alles ist mir doch
recht viel wichtiger geworden. Die Torheit der vielen Psychologen,
die sich der Computer-Metapher als Theorie des Menschen verschrieben
haben, ärgert mich; doch bin ich ihnen auch dankbar, dass sie
mit ihrem Holzweg alternative Sichten herausfordern.
Auf die Frage, wie man Einsichten
über die "M-C-Partnerschaft" in Unterrichtsprogramme umsetzen
könnte, muss ich sagen: das geht wohl nicht direkt. Es ist eher
Hintergrundsverständnis, das jeder und jede, die mit Informatik
umgehen, und ganz besonders jede und jeder, die unterrichtend mit
Informatik umgehen, einmal und immer wieder zur Kenntnis nehmen
sollten. Es müsste eher einfliessen in die Schaffung eines
Informatik-Milieus oder -Klimas; in Curricula oder Kursprogrammen
eher in Form des berühmten roten Fadens als in Form von
abzuhakenden Lehrzielen.
Es geht dabei um die Entwicklung
eines ständig wachen Sensoriums dafür, ob man diese
rationalen Maschinen einsetzt, um dem sie bedienenden Menschen ein
noch einmal zunehmendes Mass an Zwang, die totale
Rädchenhaftigkeit in der grossen Maschinerie
aufzuerlegen, oder ob diese externen Denkmittel eine Perspektive
grösserer Freiheit eröffnen, ob sie unsere
Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten, den sog.
Handlungsspielraum, eher erweitern als verengen? (Hinter dieser heute
sehr aktuellen Frage verbirgt sich allerdings die bange Frage von
morgen, ob wir uns eine nicht-rädchenhafte Zivilisation
überhaupt noch leisten können werden? Ob wir nicht
möglicherweise mit der Preisgabe der Würde der Person
dafür bezahlen werden müssen, dass wir wenigstens
überleben?) So gesehen hat Informatik das Potential eines
Bildungsfaches. Und genau das gehört in die Schule; die
Ausbildung in Informatik kann man weitgehend dem Selbststudium
und der Arbeitswelt überlassen.
Mich fasziniert, dass eine
Übersteigerung eines Aspekts -- ich habe im Anschluss an
Descartes von der totalen Rationalität des Binärdenkens
gesprochen -- sein Gegenstück herausfordert: dass die
Überrationalität im Computer die Freiheit im menschlichen
Partner aufzeigt, zu ihrer Nutzung auffordert und den Umgang mit ihr
fördert. Eine computerunterstützte Schulrevolution der 80er
Jahre mag verpasst sein; noch ist aber nichts verloren, wenn
ausreichend viele Informatiklehrer ausreichenden Abstand nehmen von
ihrem Objekt, von ihrer Technik, während sie sich für sie
einsetzen. Und ihr dann in freierer Beziehung begegnen
können, und diese Haltung als offene Informatik
möglichst vielen Schülern und Schülerinnen
weitergeben. Je mehr von dem Intellektuellen, Rationalen, Eindeutigen
wir an diese Maschinen delegieren können, ohne uns ihnen zu
verkaufen, desto offener werden wir im günstigen Fall
für die andere Seite unserer Existenz, für unsere
Gefühle, für unsere Beziehungen, für
Menschlichkeit.
Inhalt
Ausgewählte neuere
Literatur
Der Verfasser dankt seinem Mitarbeiter PD Dr. Urs
Fuhrer für wertvolle Beiträge und
Hinweise.
Ackermann D 1987
Handlungsspielraum, mentale
Repräsentation und Handlungsregulation am Beispiel der
Mensch-Computer-Interaktion. Diss.phil. Univ. Bern /
ETH-Z.
Baetz M L 1985
The human imperative: planning for
people in the electronic office. N.Y.,
Holt-Rinehart-Winston.
Balzert H et al. (Eds.)
1988
Einführungin die
Software-Ergonomie. Berlin, Springer.
Boesch E E
1983
Das Magische und das Schöne:
zur Symbolik von Objekten und Handlungen. Stuttgart,
Frommann-Holzboog.
Caporael L R
1987
Anthropomorphism and
mechanomorphism: two faces of the human machine. Computers in
Human Behavior 2 215-234.
Culbertson J A &
Cunningham L L(Eds.) 1986
Microcomputers and education.
Chicago Univ. Press.
Dreyfuss J M & Dreyfuss S E
1986
Mind over machine. N.Y., Free
Press.
Eurich C 1985
Computerkinder. Reinbek,
Rowohlt.
Faulstich P &
Faulstich-Wieland H 1988
Computer-Kultur. München,
Lexika.
Frese M; Ulich E & Dzida W
(Eds.) 1987
Psychological issues of
human-computer interaction in the work place. Amsterdam, North
Holland.
Gaines B 1986
From timesharing to the sixth
generation: the development of human-computer interaction.
International J. of Man-Machine-Studies 24 1-27.
Gergely S M 1986
Wie der Computer den Menschen und
das Leben verändert: ein kritischer Ratgeber für Eltern,
Lehrer und Schüler. München.
Green T R G; Payne S J &
van der Veer G C (Eds.) 1983
The psychology of computer use.
London, Academic.
Lang A 1983
Mensch und Computer: Bedrohung
oder Chance? Unipress Nr. 41, Dezember 1983 26-31.
Lang A 1985
Die Computer nicht allein den
Technikern überlassen. Technische Rundschau 77
58-61.
Lang A
1988
Die kopernikanische Wende steht in
der Psychologie noch aus! - Hinweise auf eine ökologische
Entwicklungspsychologie. Schweizerische Zeitschrift für
Psychologie 47 (2/3) 1988 93-108.
Lang A in
Vorb.
Computerunterstützte
Betrachtungen zum Menschenbild. In Vorbereitung für Gymnasium
Helveticum.
Lang A & Fuhrer U in
Vorb..
Psychologisches zur
Mensch-Computer-"Partnerschaft". Ms. in Vorb.
Mandl H & Spada H (Eds.)
1988
Wissenspsychologie. München,
Psychologie Verlags Union.
Pea R D & Sheingold K
(Eds.) 1986
Mirrors of minds: patterns of
experience in educational computing. Norwood NJ, Ablex.
Rosemann H
1986
Computer: Faszination und
Ängste bei Kindern und Jugendlichen. Frankfurt,
Fischer.
Streitz N A
1988
Psychologische Aspekte der
Mensch-Computer-Interaktion. In Zimelong & Hoyos (Eds.):
Ingenieurspsychologie. Göttigen, Hogrefe.
Suchman L A 1987
Plans and situated actions: the
problem of human-machine communication. Cambridge Univ.
Press.
Turkle S
1984
Die Wunschmaschine: Vom Entstehen
der Computerkultur. Reinbek, Rowohlt.
Ulich E 1987
Technik als Option. Technische
Rundschau 79(5) 8-13.
Volpert W
1985
Zauberlehrlinge: die
gefährliche Liebe zum Computer. München, dtv.
Inhalt
| To
Top of Page