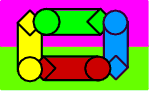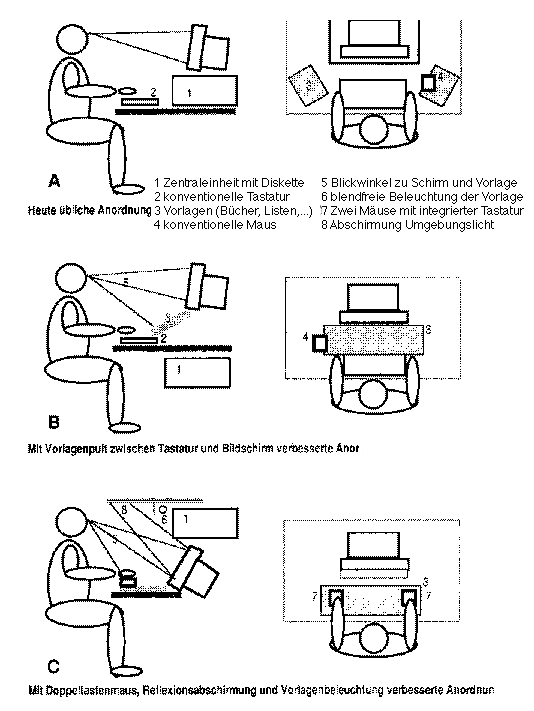Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 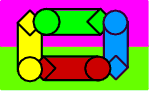 |
Unpublished Manuscript for Journal Article, 1989 |
ERKENNTNIS UND PRAXIS DES MENSCH-COMPUTER-VERHÄLTNISSES | 1989.05 |
@HumComp @EnvPsy @CuPsy |
60 / 72KB + 1 Abb. Last revised 98.11.05 |
Alfred Lang & Urs Fuhrer | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Zusammenfassung
Der Computer ist für die Psychologen in zwei Hinsichten
wichtig geworden. Einerseits ist die Psychologie zu einem Beitrag zur
Optimalisierung seiner Instrumentalität als
Datenverarbeitungswerkzeug aufgerufen. Anderseits hat sie sich seiner
als Modell für den Menschen bemächtigt. Diese beiden
Umgangsweisen mit dem Computer werden anhand einer globalen
Literaturübersicht kritisch betrachtet und mit den Thesen
konfrontiert, (a) der Computer sei nur im Verein mit dem ihn
benutzenden Menschen überhaupt zu verstehen, und (b) die
Computer-Metapher als Erklärungsmodell sei höchst
bedenklich. Zur Erläuterung dieser Thesen werden Mensch und
Computer in einigen ihrer typischen Merkmale aufgewiesen und
verglichen. Ferner wird die "Schnittstelle" zwischen den beiden
Teilen oder "Partnern" im kombinierten informationsverarbeitenden
System hinsichtlich Stand und Lücken der psychologischen
Forschung untersucht, dies auf den drei Ebenen der Ergonomie, der
symbolisch-kognitiven Prozesse und der sozio-kulturellen Bedingungen
und Folgen.
Abstract
The computer has become important for psychologists in two
respects. Firstly, psychology is called up to contribute towards an
optimalization of its instrumentality as a data processing device.
Secondly, psychology has seized upon the computer as a model of man.
On the basis of a global literature review, both of these types of
intercourse with the computer are evaluated and confronted with the
theses (a) that computers are bound to be misunderstood if separated
from their bond with the user, and (b) that the computer-metapher for
modeling man will prove to become a serious hazard. Both theses are
illustrated by pointing out and comparing some typical characters of
humans and computers. In addition the "interface" between the two
parts of or "partners" within the combined information processing
system is investigated on three levels, i.e. the ergonomic, the
symbolic-cognitive, and the socio-cultural level, as to the state and
needs of psychological research.
Inhalt
In den fünfziger Jahren verwendeten ein paar Spezialisten
unhandliche Computer, seit den sechziger Jahren setzte man sie in
Forschung, Militär und Industrie im grossen Massstab ein, mit
den siebziger Jahren begann die Welt der persönlichen Computer.
Damit wird der Computer, wie die Ethnologin Sherry Turkle (1984)
meint, immer mehr zu einem zentralen "Akteur" unserer Kultur.
Computer werden von Menschen gemacht und genutzt; es ist damit zu
rechnen, dass Computer auch auf den Menschen nachhaltig
zurückwirken. So ist auch die Psychologie aufgefordert,
über das Verhältnis zwischen Mensch und Computer
nachzudenken, empirische Grundlagen für ihre menschengerechte
Konstrutkion und ihren humanen Einsatz zu erarbeiten und die damit
verbundenen Möglichkeiten und Gefahren aufzuzeigen.
Computer lösen oft heftige Gefühle aus, und zwar auch
bei Menschen, die nicht in unmittelbarem Kontakt mit ihnen stehen
(Turkle, 1984, Volpert, 1985). Man spürt die Faszination von
etwas Neuem und Spannendem. Aber man fürchtet die neuen
Maschinen auch als etwas Mächtiges und Bedrohliches. Computer
sind magische Dinge, kaum je neutral. Die individuellen Einstellungen
zu diesem Objekt sind ausgesprochen ambivalent (vgl. Faulstich &
Faulstich-Wieland, 1988). Sie wirken aktiv auf uns ein, sind
"evokatorische Objekte" (Turkle, 1984), die uns gefangen nehmen,
stimulieren, stören und verunsichern. Geistige Tätigkeiten
oder jedenfalls Transformationen von Information in Zeichensystemen,
bisher den Menschen vorbehalten, werden mehr und mehr von Maschinen
übernommen, was das Bild vom Menschen direkt und nachhaltig
tangiert. Der Computer verkörpert die Ordnung schlechthin, die
in der Konsequenz das eigentlich Menschliche, was immer das sein mag,
bedrohen könnte. An der "Schnittstelle" von Mensch und Computer
müssten sich interessante Einsichten über das Zusammenspiel
dieser beiden "Partner" gewinnen lassen. Will man sich mit der
"Schnittstelle" zwischen zwei Systemen befassen, so liegt es nahe,
sich zunächst den beiden Systemen je für sich
zuzuwenden.
1. Was
ist ein Computer?
Mit "Computer" ist in diesem Beitrag die Konkretisierung einer
Turing-Maschine im Sinne von John von Neumann gemeint. Wir wissen
recht gut, was ein solcher Computer ist (z.B. Gerke, 1987), weil er
ja von Menschen entworfen und gebaut wird. Solche Maschinen dienen
dem Umgang mit Information in Zeichenform. Die zwei wesentlichen
Merkmaledieser Computer sind: (a) die prinzipiell
unbegrenzte Herstellbarkeit und Speicherbarkeit für Zeichen aus
einem endlichen Alphabet und (b) die Möglichkeit der logischen
Inbezugsetzung aller aus dem Alphabet konstruierten Zeichen mit allen
konstruierbaren mittels Operationen.
Der heute übliche Digitalrechner wird dementsprechend als
Prozess in Raum und Zeit realisiert: (1) Es wird eine endliche
Zeichenmenge ausgewählt und im Binärsystem darstellbar
gemacht; (2) in jedem Augenblick wird eine Auswahl (A) aus dieser
Zeichenmenge in einem Speichermedium konkretisiert; (3) eine kleinste
Auswahl aus A wird jeweils untereinander nach logischen Regeln so
prozessiert, dass (4) die konkretisierte Zeichenmenge A zu A'
verändert, erweitert oder reduziert werden kann.
Charakteristisch dabei sind die TrennungvonSpeicherungundProzess, d.h. es handelt sich um
eine äusserst stabile "Welt", von der nur immer ein ganz kleiner
und eindeutig bestimmter Teil aufs Mal von Veränderung betroffen
ist. Weiter werden Objektzeichen und Operatorzeichen
aus der gleichen Zeichenmenge konkretisiert, sind aber dennoch in
zwei Klassen geschieden, insofern die einen jene Transformationen
erleiden, die ihnen von den anderen auferlegt werden. Schliesslich
ist bedeutsam, dass es sich um einreinsyntaktischesSystem handelt, d.h. es bestehen Regeln
dafür, wie Zeichen gebildet und transformiert werden, nicht
jedoch, was die Zeichen bedeuten.
Wenn der Computer mehr sein soll als ein in sich geschlossenes
Zeichensystem, muss man ihm deshalb eine Semantik
beifügen. Das bedeutet, dass er eine Einrichtung erhalten muss,
durch welche wenigstens einige seiner Zeichen Referenten bekommen und
somit auf etwas ausserhalb seiner konkreten Zeichenmenge verweisen.
Der Computer braucht also einen "semantischenPartner".
Hier interessiert uns der Menschalsdirekter
"semantischerPartner"desComputers. Der
typische moderne Universal-Computer verfügt über eine
Tastatur als primäre Input-Einrichtung sowie über
Bildschirm oder Drucker als primäre Output-Einrichtung. Diese
sind zusammen mit den zugehörigen Treiberprogrammen dazu
gedacht, einem Menschen als Benutzer zu ermöglichen, wenigstens
einen Teil der Zeichen semantisch zu lesen. (Grundsätzlich ist
die Situation nicht anders, wenn Sensoren und Effektoren den Computer
mit seiner Umgebung verbinden, bloss haben hier Menschen die
Zuordnung von bestimmten Weltzuständen zu bestimmten Zeichen
ein- für allemal festgelegt.) Damit sind wir von der
Computerseite bei der uns interessierenden
Mensch-Computer-"Schnittstelle" angelangt.
Inhalt
2. Was ist
ein Mensch?
Schwieriger wird es sein zu sagen, was ein Mensch ist. Dieser ist
- im Unterschied zum Computer - nach unserem wissenschaftlichen
Verständnis nicht nach einem im voraus festgelegten, vom
Menschen getrennt existierenden und damit einsehbaren Bauplan
gemacht. Folglich ist es nicht möglich, ihn als Konkretisierung
eines allgemeinen Prinzips zu verstehen. Hingegen kann man sehr wohl
versuchen, sich auf induktivem Wege ein Bild zu machen, d.h. aus
seinem manifesten Verhalten Prinzipien zu (re-)konstruieren, die dann
- ähnlich, aber nicht gleich wie ein Bauplan - wesentliche
Merkmale zusammenfassen. Man wird sich freilich auf kontroverse
Prinzipien-Vorschläge einstellen müssen.
Sinnvoll ist allgemein, den Menschen als ein Regeln folgendes
System zu verstehen und zwar ein System, das nicht nur in Raum und
Zeit existiert, sondern sich in der Zeit auch wandelt. Aber was sind
die Regeln? Wir können uns heute ein grobes Bild seiner
Entstehung im Rahmen der kosmischen, biologischen und kulturellen
Evolution machen. Wir wissen hingegen nichts Sicheres über seine
Zukunft. Und wie bei aller induktiven Erkenntnis können wir nie
sicher sein, dass unser Bild vollständig ist. Jederzeit
können bisher unerkannt gebliebene Eigenschaften zum Vorschein
kommen oder neue Eigenschaften überhaupt erst herausentwickelt
werden, die eine Revision unseres Bildesfordern.
Die Bilder, die wir uns vom Menschen machen, sind in der Tat sehr
vielfältig und unterschiedlich. Sie sind
nämlich abhängig davon, welche der manifesten oder
erschlossenen Eigenschaften man für zentral und welche man
für akzidentell betrachtet. Ferner weckt Erkenntnis über
Menschen stets ein Rekursionsproblem; denn über den
Menschen gewonnene Erkenntnis besitzt ein Potential, gerade den
Menschen zu ändern, indem er diese Erkenntnis zur Kenntnis nimmt
und daraus Konsequenzen zieht, indem er entweder mehr oder weniger
danach handelt oder sich ihr zu verweigern versucht. Der Computer ist
ein besonders eindrückliches Beispiel rekursiver Tätigkeit
des Menschen (Hofstadter, 1985).
Eine heute in weiten Teilen der Psychologie - und darüber
hinaus - dominierende Auffassung des Menschen ist die eines
informationsverarbeitendenSystems (z.B. Newell &
Simon, 1972; Gerke, 1987). In der Tat ist nicht zu verkennen, dass
wir mit den Sinnesteilsystemen Information über die Welt
aufnehmen und auf dem Weg über Drüsen- und
Muskeltätigkeiten Information an die umgebende Welt abgeben.
Wichtig ist dabei auch die Vorstellung eines Speicherteilsystems (des
Gedächtnisses) in welchem individuelle Erfahrungen inFormvonRepräsentanten niedergelegt und
geordnet sind. Diese Repräsentanten wiederum können
selektiv verwertet und laufend verändert werden, so dass die
Verhaltenssteuerung durch mehr oder anderes als den unmittelbaren
Input determiniert ist.
So gesehen hat das Individuum einen verblüffend
ähnlichen Aufbau wie der Computer, oder besser, der Computer
einen ähnlichen Aufbau wie der Mensch. Auch der Mensch ist als
ein Zeichensystem beschreibbar, das in Raum und Zeit als ein Prozess
realisiert wird, welcher syntaktischen Regeln folgt. Wir möchten
hier nicht die sinnleere Frage aufwerfen, ob Mensch und Computer
gleich oder verschieden sind (vgl. dazu u.a. Simon, 1979; Anderson,
1983; Weizenbaum, 1978; Dreyfuss & Dreyfuss, 1986), sondern bloss
die erwähnte Gemeinsamkeit ein Stück weit verfolgen
und vier interessante Unterschiede herausarbeiten.
Inhalt
3.
Mensch und Computer: Parallelen und Differenzen
3.1. Individuen als semantische Systeme
Im Unterschied zum Computer ist im menschlichen
Informationsverarbeitungssystem die Semantik eigentlich immer schon
mit dabei. Die Zuordnungen von Zeichen und Referenten oder die
Bedeutungen sind nicht beliebig und willkürlich wie im Computer,
sondern jeder konkrete (z.B. neurophysiologisch oder biochemisch
realisierte) Informationsträgerprozess "weiss" gewissermassen um
die von ihm getragene Information, ist also, wie der
Computerwissenschaftler sagen würde, für die getragene
Information nicht transparent. Man spricht heute von
informationsspezifischen "Kanälen" (z.B. Gibson, 1966);
eine alte Formulierung der semantischen Gebundenheit ist das "Gesetz
der spezifischen Sinnesenergie" von J. von Müller. Das hindert
nicht, dass die Kanäle bezüglich der Information, die sie
übertragen können, entwicklungsfähig sind und je nach
ihrem Zustand die eintretende Information unterschiedlich wandeln und
weitergeben. Demgegenüber ist im Computer alle qualitativ oder
quantitativ unterschiedliche Information in völlig gleicher
Weise - im Binärsystem oder ein-eindeutigen Transformationen
davon - enkodiert.
3.2. Selbstaktive Speicherungs- und
Verarbeitungsprozesse
Aehnlich bedeutsam wie der materiell-energetische Stoffwechsel
für Organismen ist für Individuen der Informationsaustausch
mit ihrer Umgebung. In beiden Fällen treten nicht nur
Assimilationen derart auf, dass selektiv Teile oder Aspekte aus der
Umgebung "hereingenommen" und in neuartiger Weise zusammengefügt
werden, sondern es ist auch in beiden Fällen ein "Puffereffekt"
zu beobachten, welcher das System ein Stück weit unabhängig
von aktuellem Input von Stoff, Energie und Information, also von
seiner Umgebung macht.
Dennoch ist die psychische Organisation ebensosehr auf Information
angewiesen (um nicht zu sagen "süchtig") wie der Organismus auf
Nahrung der passenden Art (z.B. Kempe, 1977). Denn es handelt sich
beim Menschen um ein selbstaktives Informationsverarbeitungssystem.
Gespeicherte Information wartet nicht, bis sie von Operatoren
abgerufen wird, sondern sie macht sich immer wieder von sich aus
geltend. Es wäre sogar angemessen zu sagen, dass die
Inputfunktion nicht so sehr das "Material" für die Speicherung
liefert, als dass sie die Eigentätigkeiten des Systems
bloss moduliert. Demgegenüber ist der Computer nicht
"süchtig", weder nach Energie noch nach Information.
3.3. Zugang zu gespeicherter Information: ortsadressiert vs.
inhaltsadressiert
Noch weiss man überhaupt nicht, wie Information im
menschlichen System enkodiert wird. Das ist vielleicht das
allerwichtigste der offenen Welträtsel; es wird kaum im
allgemeinen Denken als offene Frage wahrgenommen. Als sicher gilt,
dass sie im wesentlichen auf Nerventätigkeit basiert. Über
die Zuordnung zwischen Information und neuronalen
Aktivitätsorten und Aktivitätsmustern in peripheren
Subsystemen ist einiges bekannt; die Grundlage der Speicherung ist
jedoch völlig ungewiss (vgl. Matthies, 1986). Dennoch
können funktionelle Aussagen darüber gemacht werden, unter
welchen Bedingungen welche Art von
Informationsverarbeitungs-Leistungen möglich sind. Die
(Kognitions-) Psychologie verfügt über einen grossen Schatz
solcher Aussagen faktischer wie hypothetischer Art; sie haben sich
allerdings bisher nicht auf eine einheitliche und anerkannte Ordnung
bringen lassen. Von den Erkenntnissen, die uns unter den hier
interessierenden Gesichtspunkten relevant scheinen, wollen wir eine
Hypothese herausgreifen, die einen wichtigen Unterschied zwischen
Informationsverarbeitung durch Menschen oder durch Computer auf ein
Schlagwort bringt: Information sei im Computer ortsadressiert,
im Menschen inhaltsadressiert.
Speicherung im Computer setzt eine finite Portionierung voraus,
die Information wird gewissermassen in Kästchen abgelegt. Einem
Speicherplatz im Computer (RAM- oder Diskadresse) ist
"gleichgültig", was sein Inhalt ist. Das hat zur Folge, dass ein
Inhalt für den Operator zum Abruf von Information verloren ist,
wenn dieser ihre Adresse (den "Ort" des Kästchens) nicht
verfügbar hat. In der psychischen Organisation hingegen scheinen
die Informationen aufgrund der verschiedenen Affinitäten ihrer
Inhalte und ihrer Formen zugänglich zu sein. Erfahrungen
ähnlichen Inhalts bilden stets einen oder mehrere
Komplexe, auf die später von den verschiedenartigsten
Aspekten her wieder zugegriffen werden kann. Solches versucht man in
von Neuman'schen Computer-Repräsentationen mittels
Relationensystemen von Informationselementen zu modellieren (z.B. in
Form von Propositionen, semantischer Netzwerke, kognitiver Schemata,
u.ä.). Obwohl darüber seit einigen Jahren sehr viele
Experimente und Theorien gemacht wurden (vgl. Mandl & Spada,
1988), wissen wir noch kaum, wie die Relationenbildung in der
psychischen Organisation vor sich geht. Die Methode der
Relationenbildung setzt zwingend Informationselemente
voraus, über deren Natur wir in Unkenntnis des Träger-Codes
natürlich nur mutmassen können. Das umfangreiche Korpus an
Untersuchungen und Theorien bezieht sich zudem fast ausschliesslich
auf sprachliches Material, und das ist wohl ein Spezialfall.
Ferner bilden in der psychischen Organisation wohl fast alle diese
Informationskomplexe inter- oder extrapolierte Inhalte aus, welche
ihrerseits fast wie Erfahrungen behandelt werden, obwohl sie niemals
als solche vorgekommen sind. Das sind dann z.B. mögliche
Affinitäten mit oder Gegensätze zu virtuellen Inhalten,
Idealtypen und dergleichen. Die psychische Organisation schafft sich
durch die intensive Verflochtenheit aller Inhalte
untereinander (das Wissen insgesamt) ihre eigene Welt, ohne in
der Regel den Kontakt mit der umgebenden (realen) Welt ganz zu
verlieren. Ein Programmierer muss hingegen für alle Inhalte und
alle ihre Aspekte Adresslisten führen, die Relationen eigens
stiften und dafür wiederum Adresslisten anlegen. Falls ein
einziges Bit verloren geht oder den Wert wechselt, ist ein Inhalt
nicht (oder nur mittels fehlererkennender bzw. -korrigierender Codes)
wieder auffindbar. Andererseits stelle man sich beispielsweise vor,
dass ein Student die Adresse einer Kommilitonin verloren hat. Er geht
zu einer sinnvollen Zeit ins Mensacafé und aus vielen
kaffeetrinkenden Studentinnen erkennt er seine Bekannte wieder,
selbst wenn diese inzwischen eine dunkelrandige Brille trägt und
ihre Haare kurzgeschnitten hat. Solche, mit Ortsadressierung
unvereinbaren Effekte haben in gedächtnispsychologischen
Untersuchungen verschiedentlich nachgewiesen werden können (vgl.
Baddeley, 1986).
3.4. Operanden und Operatoren; Identität und
Selbstreflexion
Obwohl im Hinblick auf die kognitionspsychologische Forschung nun
vielleicht der Eindruck erweckt worden ist, fast nichts sei sicher,
ist eine der empirisch stützbaren Aussagen, dass auch in der
psychischen Organisation die in der Mathematik geläufige
Unterscheidung vonOperatoren und Operandenunentbehrlich ist (z.B. Anderson, 1983; theoretisch ist
allerdings auch dies nicht unbestritten). In propositionalen
Formen finden sich Operanden und Operatoren in der Logik (Terme und
Relationen) und in der Sprache (Subjekte und Objekte einerseits,
Prädikate und Attribute andererseits). Auch im Handeln und im
Denken dominieren solche Strukturen in der prozeduralen Form,
dass etwas durch einen Akt in etwas Anderes übergeführt
wird. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die Terminologie
Operator und Operand gewählt wurde. Sie ist auch in den
Computerprozeduren in der Gegenüberstellung von Programmen und
Daten fundamental. Die Tatsache, dass Operatorengruppen ihrerseits in
gewissen Zusammenhängen als Operanden behandelt werden
können oder dass Operanden und Operatoren zusammen in bestimmten
Fällen zu neuen Paketen geschnürt und dann wie ein
Superoperand oder -operator behandelt werden können ("object
oriented programming") lässt die Trennung auf einer jeweils
tieferen Ebene bestehen. Auch das "logische Programmieren" darf einem
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Relationensysteme im
von-Neumann-Computer durch Prozeduren aus Operatoren und Operanden
realisiert werden; und die sog. Neuronalcomputer werden derzeit
ebenfalls in digitalen Prozeduren emuliert. Der Begriff des
Produktionssystems, letztlich identisch mit demjenigen der
Turing-Maschine (Hunt, 1989), bringt das auf die Essenz.
Eine der folgenreichsten "Erfindungen" der modernen
Computerpioniere (theoretisch John von Neumann, praktisch erstmals
John V. Atanasoff; vgl. Mackintosh, 1988) war die Idee, Operanden und
Operatoren im gleichen Medium des Binärcodes
darzustellen. Natürlich ist ihre interne Unterscheidbarkeit
damit nicht aufgehoben. Die Feststellung, dass die im Computer
konkretisierte Zeichenmenge nichts anderes als eine Menge von
Operanden und Operatoren darstellt, wobei die Operatoren bloss
selektiv auf ihnen affine Operanden (Datentypen) anwendbar sind und
die möglichen Operationen das Relationenpotential aller
Operanden untereinander definieren, könnte also unter
informationsorientierter Sicht auch auf die psychische Organisation
zutreffen. So verstanden, wäre der Mensch ein Spezialfall einer
Turing-Maschine, und um ihn zu erklären, müsste man nur
genau jene Restriktionen spezifizieren, welche nötig sind, damit
der Computer gerade jene und keine anderen "Produktionen" herstellt,
zu welchen auch der Mensch fähig ist (Hunt, 1989). Die Menge
aller möglichen Operanden und ihrer durch Operatoren
realisierbaren Relationen, die einem Menschen grundsätzlich
verfügbar sind, entspräche dann etwa dem, was man das
Weltbild, die innere Repräsentation der umgebenden Welt und das
Handlungspotential, kurz, die "kognitive Struktur", dieses
Individuums nennen kann. Solange nichts über korrespondierende
Operanden-Operatoren-Separierung in den neuro-humoralen
Trägerprozessen bekannt ist, lässt sich der Ansatz
natürlich als Heuristik einsetzen.
Nun muss man aber zu dieser Arbeitshypothese einer möglichen
Gemeinsamkeit von Mensch und Computer noch eine Beifügung
machen, die wieder auf eine Differenzierung hinausläuft.
Während die Operatoren im Computer untereinander nur durch ihre
Logik bzw. durch die ihnen affinen Operanden verbunden sind, ist bei
der psychischen Organisation nicht zu übersehen, dass die
Gesamtheit der Operatoren (und wohl auch der Operanden) durch ein
integrierendesPrinzip zusammengehalten wird.
Erlebnismässig erscheint dies beispielsweise als "Ich" oder
"Selbst", allgemein als die Identität der Person.
Damit bezeichnen wir die Tatsache, dass sich ein Mensch während
seiner ganzen Lebensspanne - trotz vielerlei Wandels in seinem Wissen
und Können -, als mit sich selbst identisch erfährt. Auch
für Dritte erscheinen wir - oder Dritte erscheinen uns - als
über das ganze Leben mit sich identisch (von pathologischen
Fällen sei hier abgesehen). Damit verbunden ist vermutlich eine
weitere Eigenart psychischer Organisation: Das "Ich" wird nicht nur
als ein uns vereinheitlichendes Prinzip, sondern zugleich als etwas
von uns selber Abstand Nehmendes erfahren. Es handelt sich um eine
partielle, mutmasslich im Zusammenhang mit Sprache mögliche
"Verdoppelung" der kognitiven Struktur, die uns erlaubt, über
uns selber nachzudenken. Man spricht von Selbstreflexion und
vom Selbstbewusstsein.
Wir nehmen an, dass Identität und Selbstreflexion und
ähnliche Erscheinungen auf Repräsentationen zweiter Ordnung
beruhen, d.h. auf Repräsentationen von Repräsentationen.
Entscheidend dürfte sein, dass die sekundären oder
Meta-Repräsentationssysteme nicht in einem
ein-eindeutigen Verhältnis zu den primären zu stehen
scheinen und dennoch die Gesamtheit der primären
Repräsentationen betreffen. Informationsaustausch mit ihrer
Umgebung pflegen die Tiere auch, aber nur die weitestentwickelten -
sicher der Mensch mit seinem Grosshirn - bilden den
Informationsaustausch noch einmal partiell ab und überwachen ihn
als ganzen. Sekundärroutinen im Computer sind hingegen immer
zielspezifisch. In gewissem Sinne lassen sich die
Meta-Repräsentationen der psychischen Organisation als Theorien
über die Funktionsweise des eigenen Systems auffassen (vgl.
Wellman, 1985). Mit Identität und Selbstreflexion sind
Phänomene angesprochen, die sich der physikalisch-technischen
Modellierung im von-Neumann-Computer infolge seiner Linearisierung
entziehen (z.B. Mandler, 1988). Abzuwarten bleibt, ob in
künftigen nicht-arbitrierten parallelprozessierenden Maschinen
ein-mehrdeutige Relationen bewältigbar werden.
3.5. Bedenken zur Computer-Metapher
Die vier herausgegriffenen Punkte machen deutlich, dass zwischen
Mensch und Computer eine Affinität besteht, die nicht ohne Grund
zur sogenannten Computer-Metapher geführt hat. Weil der
Computer so gut verstanden wird, setzt man ihn als Modell für
das noch nicht Verstandene, das Funktionieren des Menschen ein.
Die Computer-Metapher ist heute speziell im Bereich
kognitionswissenschaftlicher Theoriebildung sehr verbreitet (vgl.
Mandl & Spada, 1988; Pylyshyn, 1984). Wir halten sie - bei allem
Interesse für viele Einzelbefunde, die sie hervorbringt -
für nicht unproblematisch (vgl. Allport, 1975). Es ist
logisch unannehmbar, einen Gegenstand durch ein Prinzip
erklären zu wollen, welches eine Hervorbringung genau des zu
erklärenden Gegenstandes darstellt, also demselben untergeordnet
anstatt über- oder nebengeordnet ist. Dieser
Zirkularitätseinwand gilt streng genommen sogar für die
blosse Beschreibung eines Systems in Termini eines seiner
Teilsysteme; ein unabhängiges tertiumcomparationis ist dem Menschen allerdings
grundsätzlich nicht verfügbar, rationale Psychologie
deshalb notwendig irrational.
Doch auch in pragmatischer Perspektive scheint es uns
ungünstig, dass die Computer-Metapher den Psychologen und
Anderen den Blick verstellen kann auf Phänomene, die ausserhalb
ihres Horizontes liegen. Man denke zum Beispiel an die allgemeine
Grundannahme diskreter Informationselemente und ein-eindeutiger
Relationensysteme beim Computer, welche, auf die psychische
Organisation übertragen, vermutlich unangemessen ist (Dreyfuss
& Dreyfuss, 1986). Damit verbunden sind auch die
forschungsmethodischen Probleme der Beziehung zwischen
psychologischer Theorie und Computer-Programm (vgl. Hermann,
1982).
Konkret bedeutet dies: Informationsverarbeitungsmodelle der
psychischen Organisation auf der Basis der Computer-Metapher sind
apriorisch oder tautologisch. Sie stecken hinein, was sie
herausbekommen wollen. Das wäre nicht so problematisch, wenn
solche Modelle bloss als Heuristik dienten und dann in einer
unabhängigen Rechtfertigungsstrategie Falsifizierungschancen
ausgesetzt würden. Solche Strategien werden jedoch heute nur
ausnahmeweise verfolgt. Die Folge ist, dass der Mensch dieser
Denkweise nicht von Maschinen zu unterscheiden ist. Und dies
geschieht nicht deshalb, weil er in Wirklichkeit eine Maschine
wäre, sondern einfach deswegen, weil er sich zu seiner
Beschreibung eines solchen Erkenntnismittels bedient. Als formale
Modelle sind sie nützlich, aber als solche auch beliebig auf
alle Sachverhalte anwendbar und daher deskriptiv praktisch,
explikativ aber wertlos.
Inhalt
4.
Schnittstelle auf drei Ebenen
Die vier Vergleichsaspekte und die generelle methodologische
Vorsichtsmahnung sollen ausreichen, wenn wir uns nun der
"Schnittstelle" zwischen Mensch und Computer nähern. Wir
untersuchen Eigenschaften der beiden Partner sowie die beim
Zusammenwirken entstehenden Folgen. Wenn zwei so komplexe Systeme
aufeinander treffen, ist eigentlich zu erwarten, dass sie nicht bloss
einen Berührungspunkt haben. Mit dem Begriff "Schnittstelle"
meinen wir folglich eine Vielzahl von Uebergängen,
selbstverständlich in beiden Richtungen. Der Terminus ist auch
insofern irreführend, als die Interaktionsprozesse auf beiden
Seiten in die Tiefe reichen. Sie sollen in drei Ebenen (in
aufsteigender Komplexität) gruppiert werden.
4.1. Mikroebene: Informationsaustausch oder die ergonomische
Mensch-Computer-"Schnittstelle"
Auf einer Mikroebene interessiert der direkte
Informationsaustausch zwischen den beiden Teilsystemen: Bildschirm
und Tastatur sowie Auge und Hand sind die prominenten
Schnittstellenoberflächen, die beim Universalcomputer
interessieren. Hardware- und Software-Ergonomie, d.h. die Anpassung
von Computer-Systemen an den Menschen sind die gängigen
Sammelkategorien für Fragen geworden, die sich mit der
Optimalisierung des direkten Informationsaustausches
beschäftigen. Dabei stehen Fragen der Gestaltung von
Möbeln, Tastaturen, blend- und flimmerfreier Bildschirme
(Hardware-Ergonomie) oder die menschbezogene Optimierung von Software
(Software-Ergonomie, Software-Psychologie) im Zentrum des Interesses
(z.B. Balzert u.a, 1988; Streitz, 1988). Die mit dem Namen
"Mensch-Computer-Interaktion" bezeichnete Disziplin umfasst
weitgehend die Themenkreise aus der Hardware- und Software-Ergonomie,
leider allzu oft eingeschränkt auf die sog.
Benutzerfreundlichkeit.
Die damit zusammenhängenden Fragen berühren verschiedene
wissenschaftliche Disziplinen (vgl. Balzert u.a., 1988). Die
Tatsache, dass Computer von Menschen benutzt werden, macht die
Bedeutung der Psychologie für den Entwurf von Computersystemen
unmittelbar deutlich. Dabei scheint es, dass eine wesentliche
Diskrepanz zwischen Mensch und Computer, wenn man sich an den
Uebergängen auf der Mikroebene orientiert, damit zu tun hat,
dass bei der zwischenmenschlichen Kommunikation drei
Zeichenfunktionen genügen (z.B. Bühler, 1934), beim
Computer eigentlich zwei: Beschreibung (Operand) und Appell
(Operator). Ausdrucks- oder expressive Zeichen sind in
Algorithmen unsinnig. Der Computerbenützer fügt sie aber im
Dialog mit seinem Computerpartner bei der Informationsaufnahme vom
Bildschirm in Form von interpretierenden Mutmassungen und auch bei
der Informationsabgabe etwa in der Art und Weise seiner
Tastaturbehandlung und verbal oder mimisch hinzu; doch der Computer
reagiert darauf in keiner Weise. Die systematische Nutzung von
menschlichem Ausdruck durch den Computer müsste ohne
vorgängige Digitalisierung und mithin Umsetzung in Deskriptives
oder Appellatives notwendig zu Problemen in den Algorithmen
führen und wird deshalb vermieden. Man darf vermuten, dass der
"fossile" Charakter der heute üblichen Tastaturen mit diesem
Umstand zusammenhängt. Expressive Momente sind beim
Informationsdisplay jedoch erwünscht und möglich, wie etwa
der Einsatz von akustischen Signalen oder von visuellen Aspekten wie
Blinken, Schriftart und -grösse, Rahmungen, Farbigkeit und
räumlicher Anlage zeigt. Allerdings werden heute solche
expressiven Darstellungsfunktionen mehrheitlich noch ungeschickt
gehandhabt (Balzert u.a., 1988). Nicht selten sehen überdies
deskriptive und appellative Zeichen wie Daten(objekte),
Operanden und ihre Relationen bzw. Operatoren auf dem Bildschirm
völlig gleich aus und werden mit wenigen Ausnahmen durch
gleichartige Tastenbedienung erfasst.
Mit der angesprochenen Asymmetrie der Zeichenfunktionen der beiden
Partner lassen sich möglicherweise auch die unseres Erachtens
falschen Hoffnungen angehen, die an künftige Erfassungssysteme
im akustischen Kanal heute immer wieder geknüpft werden.
Abgesehen von den offenbar kaum maschinell zu emulierenden
perzeptiven Konstanzleistungen fällt auf, dass im menschlichen
Handeln der verbale und der manuelle Output-Kanal ein recht
unterschiedliches Verhältnis zum Handlungseffekt aufweisen. Eine
manuell geleistete Objektbearbeitung (Verlagerung, Verformung) ist
stets unmittelbar von taktilem, meist zusätzlich
auch visuellem und/oder auditivem Feeback begleitet.
Lautäusserungen gehen demgegenüber zunächst ins
Ungewisse; auch insofern sie nicht rein expressiv, sondern
kommunikativ, in der Regel auf einen Artgenossen intendiert sind,
erlaubt erst eine ganz andere Verhaltensweise des Partner den
mittelbaren Rückschluss auf die Wirkung der
eigenen Äusserung. Ja, das häufigste Indiz für
angemessenes Verständnis einer Äusserung ist das Fehlen
einer darauf bezogenen Rückmeldung (Foppa, 1987). Selbst wenn es
sich erweisen sollte, dass Computerbenützer sich in ihrer fast
grenzenlosen Anpassungsbereitschaft auch an akustische
Eingabegeräte gewöhnen würden, möchten wir im
Sinne unserer Überlegungen zum Mensch-Computer-Vergleich
für Techniken plädieren, welche den Unterschied dieser
Interaktionsweisen betonen und also den Computer zur Hauptsache der
Hand vorbehalten.
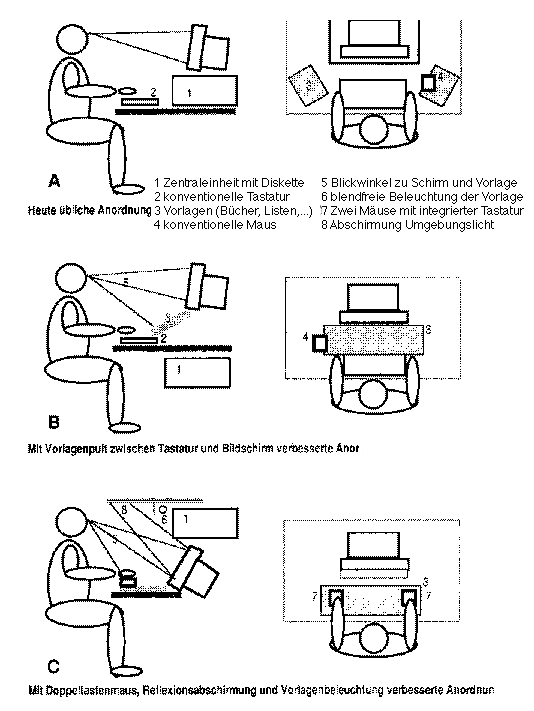
Abbildung 1: Ergonomie der Mensch-Computer-Anordnung (vgl.
Text)
Die Abbildung 1 veranschaulicht schematisch drei verschiedene
mögliche Bezüge zwischen Mensch und Computer auf der
ergonomischen Ebene der Geräteaufstellung. (A)
zeigt die heute dominierende Anordnung, bei welcher der Computer dem
Menschen so total auf den Arbeitsplatz gestellt wird, dass andere
Tätigkeiten auf einen zweiten Arbeitsplatz ausweichen
müssen und Information in anderer Form unvermeidlich eine
periphere Lage und Rolle einzunehmen genötigt ist. (B)
zeigt eine mit geringem Aufwand verbesserte Anordnung, welche
wenigstens der Informationsaufnahme in anderer Form ihren Platz gibt.
Die Spezialisierung der linken, raum-affinen Hand auf die Bedienung
der Maus ist vermutlich empfehlenswert; empirische Untersuchungen
dazu stehen leider noch aus. (C) ist eine derzeit utopische
Anordnung, welche nicht nur eine Reihe der häufigen
Beleuchtungs- und Reflexionsprobleme lösen könnte, sondern
durch Freimachung einer zentralen Arbeitsfläche dem Computer
seinen gebührenden Spezialplatz zuweist. Voraussetzung dazu sind
allerdings psycho-ergonomische Entwicklungsarbeiten für eine
neue Tastatur, welche das analog-räumliche Zeigeprinzip und das
tastaturbezogene Digitalprinzip im gleichen Gerät integrieren
und die Freiheit der Verwendung einer oder beider Hände in
spezifizierter oder flexibler Bedeutung dem Benutzer freistellt.
Wie gesagt wird in der zwischenmenschlichen Interaktion fast jede
Kommunikation expressiv begleitet (z.B. Argyle, 1972).
Mangelhafte, fehlerhafte oder indirekte soziale Kommunikation wird
von seiten des (menschlichen) Partners durch verbale oder
nichtverbale Hinweise signalisiert. Der Partner wird so auf bestimmte
Rahmenbedingungen des Dialogs aufmerksam gemacht. Entsprechende
Modi finden sich in Computersystemen erst in rudimentärer
Form vor (vgl. Balzert u.a., 1988). Problematisch ist dabei nicht,
dass die Interaktion innerhalb bestimmter Modi erfolgen muss, sondern
dass der Benutzer in einem falschen, oft unpassenden Modus gefangen
bleibt, dies gar nicht oder erst spät merkt und spezielle
Anstrengungen zum Moduswechsel unternehmen muss. In der menschlichen
Kommunikation sind die Modi so subtil und selbstverständlich,
dass man den Uebergang nicht merkt. Sie verschwimmen auch leicht
ineinander. Die Modi sollen folglich in Anzahl, Ordnung und Zuordnung
so gestaltet sein, dass sie nicht als Modi erscheinen, wohl aber
erscheinen können, wenn man sich fragt.
Auf der ergonomischen Ebene möchten wir auch jene
Entwicklungsrichtungen lokalisieren, die sich mit Fragen der
Optimalisierung des Informationsaustausches unter dem Gesichtspunkt
sozio-technischer Systeme beschäftigen (z.B. Udris & Ulich,
1987). Weil der Entwurf von Computersystemen immer auch Aufgaben- und
damit Arbeits- und Organisationsgestaltung ist (bzw. sein
müsste), hat sich während der letzten Jahre insbesondere in
der Arbeits- und Organisationspsychologie ein starkes Interesse an
hardware- und software-ergonomischen Fragen sowie an Problemen neuer
OrganisationsformenmenschlicherArbeit (z.B.
Telearbeit) herausgebildet (z.B. Frese & Brodbeck, 1989; Frese,
Ulich & Dzida, 1987; Ulich, 1983; 1988; Kraut, 1987; Blackler,
1988; von Benda, 1988). Man ging sogar soweit, psychologische und
ergonomische Erkenntnisse in Handbüchern zusammenzutragen (Smith
& Mosier, 1986). Schliesslich hat man auch begonnen, sich im
Schnittbereich von Arbeits-, Organisations- und
Architekturpsychologie verstärkt mit Fragen der Gestaltung des
physischen Arrangements "elektronischer" Arbeitsplätze zu
beschäftigen (z.B. Wineman, 1986; vgl. auch Abb. 1). Allerdings
wird diese stark ergonomische Orientierung neuerdings selbst
innerhalb der Arbeits- und Organisationspsychologie als unzureichend
empfunden (z.B. Bungard & Jöns, 1988).
4.2. Mesoebene: individuelle und kollektive Denk- und
Handlungsformen oder: der Computer als Mentalitätsimpuls
Ergonomie, wenn sie konsequent über Kriterien wie
Benützerfreundlichkeit hinausgeht, mündet in die Einsicht,
dass das entschiedende Bild nicht auf dem Schirm, sondern im Kopf des
Benutzers zu finden ist. Und auch dieses "Bild" ist nicht bloss ein
aktueller Informationssatz, sondern ist Teil einer kognitiven
Formation des Menschen, die als "Mentalität" bezeichnet werden
kann. Dabei soll der Begriff "Mentalität" nicht
alltagssprachlich, sondern als die organisierte Gesamtheit der Formen
und des Stils kognitiver Prozesse verstanden werden. Die
Schnittstelle hat auch auf der Menschseite Tiefe. Es geht also darum
aufzuzeigen, was die Benutzung informationsverarbeitender Maschinen
für das Denken und die Intelligenz und für das (soziale)
Handeln des Menschen bedeuten.
Es ist unbestritten, dass der Computer dem Menschen ein Werkzeug
für geistige Aktivitäten anbietet. Werkzeuge
ermöglichen wie andere Objekte aber nicht nur eine Erweiterung
des individuellen Handlungspotentials (Boesch, 1983), sondern es ist
damit zu rechnen, dass sie menschliches Denken und Handeln
verändern. Dass der Mensch sich der rasanten Entwicklung, die
der Computer in den gut vier Jahrzehnten seiner bisherigen Existenz
durchgemacht hat, nicht nur passiv anpasst, sondern kulturell
koevoluiert, ist aber zunächst eine These. Dennoch wäre es
falsch und sicher zu einfach, nun nach einer allgemeingültigen
Wirkung des Computer auf Menschen zu suchen (z.B. Caporael &
Thorngate, 1984).
Ueber die Möglichkeiten eines Transfers vom Programmieren auf
allgemeine kognitive Fähigkeiten, die keinen direkten Bezug zum
Programmieren haben, gibt es erst wenige empirische Befunde (vgl.
Pea, Kurland & Hawkins, 1986). Nach einem Jahr Praxis mit LOGO
erreichten beispielsweise Neun- bis Elfjährige bei einem
Wortpuzzle und einer Umordnungsaufgabe bessere Ergebnisse als eine
Vergleichsgruppe ohne Programmiererfahrung. Weil Umordnen und
Kombinieren formale Denkoperationen implizieren, stützt dieses
Ergebnis teilweise Paperts (1980) Behauptung, dass das Programmieren
zur Entwicklung formal operationaler Denkfähigkeiten führt,
worin abstrakte Sachverhalte durch Zerlegung in Einzelschritte
konkret nachvollziehbar werden.
Bei der Diskussion weitergehender Wirkungen auf das menschliche
Verhalten, die durch den Umgang mit Computern bedingt sind, beruft
man sich erstaunlicherweise immer wieder auf einige wenige
Veröffentlichungen (z.B. Weizenbaum, 1978; Eurich, 1985;
Volpert, 1985), deren Aussagen weitgehend auf idiosynkratischem
und/oder anekdotischem Datenmaterial beruhen. Darin drückt sich
etwa die Befürchtung aus, dass das Denken bedingt durch den
Umgang mit Computern nur noch maschinengleich funktioniere, wodurch
die klaren und eindeutigen Strukturen der "künstlich"
geschaffenen Welten von Computerprogrammen den individuellen Denkstil
sowie das soziale Handeln prägen, was sich wiederum im Umgang
(auch) mit der konkreten Welt nachteilig auswirke (Volpert, 1985).
Dadurch bedingt sei eine einfache "Weltsicht" sowie die Gefahr einer
Vermischung von Kunstwelt und realer Welt (von Hentig, 1987). Bei
dieser Argumentation wird leider nicht immer klar zwischen
möglichen Einflüssen der Informatik und der Bild-Medien
unterschieden.
Bis heute existieren leider erst wenige Untersuchungen zur Frage,
ob die Arbeit am Computer das individuelle Denken und das soziale
Handeln mechanisiert. Die Untersuchungen richten sich zudem
nicht auf den Nachweis, dass sich das Denken als solches
verändert hat, sondern auf die Kognitionen der Personen
darüber. Sowohl in den Untersuchungen von Pflüger &
Schurz (1986) als auch von Fuhrer (1988) meinten die Probanden, dass
sich ihr Denken bedingt durch den Umgang mit Computern verändert
habe. Die Probanden von Pflüger & Schurz (1986) gaben an,
dass sie logischer, systematischer und algorithmischer an Probleme
herangehen. Die Studie von Fuhrer (1988) bietet insofern ein etwas
differenzierteres Bild, als sich die Probanden hinsichtlich der
subjektivenEinschätzungderVeränderungihresDenkens in
Abhängigkeit davon unterschieden, welche Bedeutungen sie mit dem
Computer verbinden. Dabei schätzen Probanden, für die der
Computer eine epistemische Bedeutung (Suche nach eigener
Identität) hat, die Veränderung signifikant höher ein
als Probanden, die dem Computer eine sachlich-instrumentelle
Bedeutung (gutes Arbeitsinstrument) zuschreiben. Zudem deuten die
Interviews mit den Probanden darauf hin, dass sich bei jenen, die dem
Computer eine epistemische Bedeutung zuschreiben, ihr Denken
über sich selbst verändert zu haben scheint. Aehnliche
Veränderungen werden auch von Turkle (1984) aufgezeigt. Die
Methodik dieser Untersuchungen muss aber offen lassen, ob der Effekt
in der Sache oder in der Meinung über die Sache
gründet.
Eine weitere interessante Perspektive zur Analyse von
Veränderungen im Denken ist die Frage, wieweit der
Computer-Jargon zum "Jargondes Denkens" wird.
Selbst bei rein technischen Diskussionen werden Begriffe verwendet,
die sonst nur zur Bezeichnung menschlichen Denkens und Verhaltens
verwendet werden (Turkle, 1984). Viele Menschen, die nie Programme
geschrieben haben, betrachten Computer als Geräte, mit denen man
mathematische Operationen ausführen, Texte schreiben und
bearbeiten, Daten verwalten kann. Doch wenn man erste
Programmier-Erfahrungen gemacht hat, stellt man fest, dass Computer
Geräte sind, die Informationen verarbeiten, dass sie
Mitgestalter von Symbolwelten und Sprache sind. Der Computer wird zu
einer "psychologischen" oder "metaphysischen Maschine", und zwar
nicht deshalb, weil man sagen könnte, er habe eine Psyche,
sondern weil er Einfluss darauf hat, wie wir über uns selber
denken (Turkle, 1984).
Doch ist nicht nur die Neigung festzustellen, auf den Computer
menschliche Eigenschaften zu projizieren (Anthropomorphismus).
Es zeigt sich zugleich eine Tendenz in die entgegengesetzte Richtung:
Der Mensch beginnt, über sich selbst und andere in Begriffen zu
denken, die ursprünglich Eigenschaften und Funktionen der
Maschine bezeichneten (Mechanomorphismus). Anthropomorphismus
und Mechanomorphismus sind aber weder Eigenschaften von Menschen noch
Eigenschaften von Maschinen, sondern beide konstituieren sich erst in
der Wechselbeziehung zwischen den beiden "Partnern" (Caporael,
1987).
Wichtige Fragen künftiger Forschung müssten sich zum
Beispiel damit befassen, wie sich mechanomorphekognitive
Repräsentationen entwickeln und welches die Folgen für
das individuelle und kollektive Handeln sind. Einen ersten, auf der
Piaget'schen Stufentheorie aufbauenden Ansatz hat Turkle (1984)
vorgelegt. Eine weitergehende These vertritt Salomon (1979), wonach
die symbolverarbeitenden Systeme der neuen Medien nicht nur die
aktuellen kognitiven Verarbeitungsprozesse beeinflussen, sondern
durch wiederholten Umgang mit einem Symbol-System übe dieses
auch auf die kognitivenRepräsentationsprozesse
einen prägenden Einfluss aus. Das würde bedeuten: Die
Codierungsformen der neuen Medien prägen die Denkmuster,
Vorstellungsbilder und Problemlöseschemata. Salomon kann diese
"Kultivierungsthese" auf die zuerst von Whorf (1963) ausgearbeitete
Theorie stützen, die besagt, dass das Kommunikationssystem einer
Gesellschaft - die Sprache - das individuelle Denken und, so
würden wir vermuten, auch das kollektive Handeln nachhaltig
beeinflusst. Die Kultivierungsthese impliziert die interessante
medienpädagogische Frage, welchen Einfluss der immer intensiver
werdende Umgang mit Bildschirmmedien auf die
Repräsentationsformen der heranwachsenden Generation haben wird.
Neuere Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass unter bestimmten
Bedingungen (z.B. bei längerfristigem Umgang mit einem Medium,
bei intensiver Zuwendung) eine Uebertragung mediensprachlicher
Verhaltensmuster auf völlig andere Bereiche erfolgen kann
(Salomon, 1984).
Hinsichtlich der Frage nach einer sozialenIsolierung bedingt durch intensiven Umgang mit Computern (z.B.
Eurich, 1985; Volpert, 1985), ergibt sich aufgrund der ersten
empirischen Untersuchungen ein recht klares Bild. Computereinsiedler
sind die Ausnahme und selbst unter Hackern beobachtet man starke
soziale Gruppenbildungen (Turkle, 1984). In schulischen Institutionen
hat man beobachtet, dass Schüler intensiver miteinander
kommunizieren, wenn sie am Computer arbeiten (z.B. Hawkins &
Sheingold, 1986) und stark dazu neigen, neue soziale Gruppen zu
bilden (Turkle, 1984; Herman, 1988). Innerhalb grösserer
Organisationen, in die Computer eingeführt wurden, hat man
ebenfalls eine Intensivierung der direkten sozialen Kontakte
beobachtet (vgl. Kiesler & Sproull, 1987). Dass die dichtere
Kommunikation nicht bloss ein Artefakt ist, d.h. durch die Probleme
im Zuge der Implementation der neuen Systeme bedingt ist, belegen die
Arbeiten der Gruppe um Sara Kiesler an der Carnegie-Mellon University
in Pittsburgh. Diese Studien belegen aber auch, dass in bestehenden
sozialen Strukturen, bedingt durch eine "Umverteilung"
individuellerKompetenzen und der daran gebundenen
sozialen Positionen, Veränderungen induziert werden. Ueber die
längerfristigen Veränderungen, die sich innerhalb sozialer
Systeme (z.B. in Schulklassen, Familien, Arbeitsteams) ergeben, weiss
man aber noch kaum etwas.
Betrachtet man die Ergebnisse der dargestellten Untersuchungen zu
den mentalen Einflüssen im Ganzen, so drängt sich eine
Dialektik zwischen den formalen, rationalen, maschinellen
"Denkformen" einerseits und den informellen, intuitiven,
emotionsgefärbten Umgangsweisen mit Information anderseits als
Kernproblem auf. In mancher Hinsicht kann man in der Informatik einen
Höhepunkt der rationalen Methodik des
abendländischen Wissenschaftsideals sehen. Descartes müsste
den Computer als seinen grössten Triumph erleben und zugleich
als Vollendung der Bestimmung der "denkenden Substanz", welche in
klarer und deutlicher Weise den diffusen Gegebenheiten der Materie,
des Raumes, der Zeit, des Leibes usw. gerecht wird. Bei näherer
Betrachtung müsste er allerdings erschrocken festellen, dass die
Informatik seinen Dualismus erschüttert oder widerlegt;
denn es ist ja eine "ausgedehnte Substanz", ein materielles Etwas,
das da so tut, wie wenn es "denken" würde, das da klarere und
deutlichere Strukturen realisiert, als sie der denkende Mensch
vermag. Und wenn Descartes, wie wir es empfehlen, den Blick auf die
neugewonnene, übergeordnete Einheit der
Mensch-Computer-"Partnerschaft" richten würde, müsste er
auch feststellen, dass hier die Umkehrung der Zielsetzung seiner
analytischen Geometrie angelegt ist: wohl kann ein von menschlichem
Denken entworfener Algorithmus eine komplexe Sache auf ihre klare
Struktur bringen und so einen Konsistenztest abgeben; aber ebenso
bedeutsam - wenn nicht bald schon wichtiger - ist der Computer als
ein Instrument der Aufbereitung von überkomplexer Information in
eine der menschlichen Anschauung nachvollziehbare Form.
4.3. Makroebene: die Rolle des Computers im sozio-kulturellen
System
Auf der dritten, der Makroebene interessieren uns die Folgen,
welche die Vergesellschaftung von Mensch-Computer-Partnern
hervorbringen. Obwohl dies den Bereich der Psychologie
überschreitet, möchten wir wenigstens den Blick darauf
lenken.
Die biologische Evolution hat dieses ebenso wunderbare wie
problematische Grosshirn hervorgebracht, welches den
Informationsaustausch höherer Lebewesen mit ihrer Umgebung in
einem besonderen Zeichensystem abbildet und organisiert. Die
kulturelleEvolution hat darauf im wesentlichen mit der
Herausbildung zweier weiterer Zeichensysteme reagiert. Das erste ist
die WeltderArtefakte: die Werkzeuge, die
Kultobjekte, die Alltagsdinge, das Gebaute, die Häuser, die
Siedlungen. Das heisst allgemeiner: ein System von zusätzlichen
kulturellen Raum- und Zeitstrukturen. Das sind also die konkreten
Symbole der stofflichen Kultur. Das zweite ist die WeltderSymbolealssolche: also die Sprache,
die gesprochene, später die geschriebene, auch die Bilder, die
Musik. Das sind die geistigen Zeichen der ideellen Kultur, welche
Traditionen ermöglichen wie Mythen, Wissenschaft, Recht,
Technik, Geld, Politik, Ideologie u.a.. Beide Zeichensysteme, die
Objektkultur und die Denkkultur, haben die
Unzulänglichkeiten des Grosshirns vor allem bezüglich der
Stabilisierung der zwischenmenschlichen Verhältnisse sowie ihre
kurzlebige Vergänglichkeit teilweise zu kompensieren vermocht;
allerdings sind sie nahe daran, ihren Schöpfer, den Menschen in
seiner Existenz zu gefährden.
Wie ordnet sich der Computer in diese Errungenschaften ein? Er
scheint Aspekte der beiden Zeichensysteme zu integrieren: ein
einzigartiges Artefakt, welches die symbolische Welt aus ihrer
Passivität herausführt: die Zeichen treten mit Zeichen in
Interaktion, ohne dass immer unmittelbar ein Mensch sie führen
müsste. Im Computer machen sich die Zeichen partiell
selbständig und treten mit ihren menschlichen Schöpfern in
Interaktion. Lösen sie ihn gar ab, wie einige Computerfreaks es
glauben oder glauben machen möchten? Oder ist der Computer
einfach eine Fortsetzung der bisherigen Zeichensysteme, eine
machtvollere Sprache und Schrift gewissermassen, ein weiteres
Herrschafts-Instrument in der Hand von Menschen zur Festigung
bestehender sozialer Strukturen (Weizenbaum, 1977) oder zur
Herausbildung neuer sozialer Systeme? So betont beispielsweise
Mowshowitz (1980) die Folgen davon, dass der Computer Information
selegiert und filtert und somit - im Sinne von Schütz &
Luckmann (1979) - zu sehr spezifischen Verteilungen des
"Wissensvorrates" innerhalb einer Gesellschaft führt und
folglich die Herausbildung bestimmter - unter Umständen neuer -
Sozialstrukturen bedingt.
Aber Computer als Objekte unterliegen selbst einem
Bedeutungswandel. Es dürften sich im Laufe der Zeit bestimmte
Rituale menschlicher Beziehungen herausbilden, wie sie Elias
(1978) beispielsweise in der gesellschaftlichen Veränderung des
Essens schildert. Weiter nimmt die Komplexität technologischer
Objekte ständig zu, unsere Gesten werden aber immer einfacher
(Baudrillard, 1968) oder fallen - etwa im Falle nonverbalen
Verhaltens bei elektronischer Kommunikation - völlig weg.
Schliesslich überbrücken neue Informationstechnologien
nicht nur die räumlichen Distanzen, sondern mit der
elektronischen Kommunikation auch die zeitlichen Einbindungen
individuellen Handelns: "Jeder kommuniziert mit jedem jederzeit",
propagiert die Telekommunikationswerbung. Obwohl das ja
offensichtlich unmöglich ist, muss die Sinnfrage gestellt und
diskutiert werden.
Mit den Wirkungen solcher Regulationsformen des Zusammenlebens
müssen wir heute fertigwerden, obwohl erst spätere
Generationen diese Evolutionen werden beurteilen können. Aus der
Geschichte der Zeichensysteme und ebenso aus der Sozialgeschichte
gegenständlicher Aneigung von Dingen (Elias, 1978) können
wir immerhin lernen: Die Objektkultur und die Denkkultur haben sich
immer dann als problematisch erwiesen, wenn sie sich vom Menschen
losgelöst haben, verobjektiviert und verabsolutiert worden sind.
Die kulturelle Evolution gefährdet dann sich selbst, wenn der
Mensch seinen Möglichkeitssinn (Robert Musil) mit seinem
Wirklichkeitssinn verwechselt. Dazu lädt der Computer wie
kaum eine frühere kulturelle Errungenschaft ein. Die Verwendung
der Computer-Metapher in der Psychologie ist nur ein Beispiel
dafür. Das Korrektiv gegen diese Verwechslung muss und kann nur
vom Menschen her kommen. Deshalb meinen wir, es sei eine der
aktuellsten Aufgaben der Psychologie, die
Mensch-Computer-"Schnittstelle" auf allen ihren Ebenen zu
thematisieren und den Blick auf das übergeordnete Ganze, die
Mensch-Computer-"Partnerschaft", zu lenken.
Inhalt
5.
Schlussbemerkung
Computer sind als Gegenstand und als Hilfsmittel psychologischer
Forschung in einem beträchtlichen Ausmass bereits zu
Alltagsobjekten und -routinen geworden. Wir haben es für
angezeigt gefunden, eher grundsätzliche und programmatische
Überlegungen darüber einzuleiten, ohne den Kontakt mit der
Sache anhand von Forschungsliteratur und direkter Erfahrung
aufzugeben. Die "Schnittstelle" zwischen Mensch und Computer hat sich
für den Einstieg in eine solche Reflexion als geeignet
erwiesen. Es ist wünschenswert, dass der Computer als
Erkenntnismittel nicht allein den Spezialisten überlassen
wird, sondern dass sich Psychologen aller Teildisziplinen mit den
Voraussetzungen und Folgen dieser Denkweisen über den Menschen
befassen. Dass die Psychologen zur Praxis des Umgangs mit dem
Computer etwas beizutragen haben, findet zunehmend Anerkennung. Zu
wünschen ist freilich eine weite und offene Sicht, die sich
weder in der Unterrichtung von Menschen für gegebene Computer
noch in der Anpassung der Computer an gegebene Menschen
erschöpft, sondern Impulse zu ihrer gemeinsam Evolution gibt und
diese Entwicklungen beobachtet und bewertet. Angesichts der Brisanz
beider Themenkreise sind eigentlich fast alle Teilbereiche der
Psychologie angesprochen.
Inhalt
Literatur
Anderson, J.R. (1983). The architecture of cognition.
Cambridge, MASS: Harvard University Press.
Allport, D.A. (1975). Critical notes: The state of cognitive
psychology. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 27,
141-152.
Argyle, M. (1972). Soziale Interaktion. Köln:
Kiepenheuer & Witsch.
Baddeley, A. (1986). Working memory. Oxford: Claredon
Press.
Balzert, H. u.a. (1988) (Hrsg.). Einführung in die
Software-Ergonomie. Berlin: de Gruyter.
Baudrillard, J. (1977). Le système des objects.
Paris: Gallimard.
Benda, H. von (1988). Neue Technologien:
Mensch-Computer-Interaktion. In D. Frey, C. Graf Hoyos & D.
Stahlberg (Hrsg.), Angewandte Psychologie. München: Urban
& Schwarzenberg, im Druck.
Blackler, F. (1988). Information technologies and organizations:
Lessons from the 1980s and issues for the 1990s. Journal of
Occupational Psychology, 61, 113-127.
Boesch, E.E. (1983). Das Magische und das Schöne: Zur
Symbolik von Objekten und Handlungen. Stuttgart:
Frommann-Holzboog.
Bungard, W. & Jöns, I. (1988). Neue Kommunikations- und
Informationstechniken im Büro- und Verwaltungsbereich als
Gegenstand der Arbeits- und Organisationspsychologie.
Köln-Mannheimer Beiträge zur Wirtschafts- und
Organisationspsychologie, Heft 2, 13-42.
Bühler, K. (1934). Sprachtheorie. Jena: Fischer.
Caporael, L.R. (1987). Anthropomorphism and mechanomorphism: Two
faces of the human machine. Computers in Human Behavior, 2,
215-234.
Caporael, L.R. & Thorngate, W. (1984). Computing: Prophecy and
experience. Journal of Social Issues, 40(3).
Carroll, J.M. (1987) (Ed.). Interfacing thought: Cognitive
aspects of human-computer interaction. Cambridge, MASS: MIT
Press.
Dreyfuss; H.L. & Dreyfuss, S.E. (1986). Mind over
machine. New York: The Free Press.
Elias, N. (1978). Ueber den Prozess der Zivilisation.
Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Frankfurt:
Fischer, 5. Auflage.
Eurich, C. (1985). Computerkinder. Reinbek b/Hamburg:
Rowohlt.
Faulstich, P. & Faulstich-Wieland, H. (1988).
Computer-Kultur. München: Lexika Verlag.
Foppa, K. (1987). Dialogsteuerung. Schweiz. Zeitschrift
für Psychologie und ihre Anwendungen, 46, 251-257.
Frese, M. & Brodbeck, F.C. (1989). Computer in Büro
und Verwaltung. Berlin: Springer.
Frese, M., Ulich, E. & Dzida, W. (1987) (Eds.).
Psychological issues of human-computer interaction in the work
place. Amsterdam: North-Holland.
Fuhrer, U. (1988). Handeln im Kontext neuer
Informationstechnologien. Forschungsbericht, Nr. 51,
Psychologisches Institut der Universität Freiburg im
Breisgau.
Gerke, P.R. (1987). Wie denkt der Mensch? München:
Bergmann.
Gibson, J.J. (1966). The senses considered as perceptual
systems. Boston: Houghton Mifflin.
Hawkins, J. & Sheingold, K. (1986). The beginning of a story:
Computers and the organization of learning in classrooms. In J.A.
Culbertson & L.L. Cunningham (Eds.), Microcomputers and
education (pp. 40-58). Chicago, ILL.: Chicago University
Press.
Hentig, H. von (1987). Das allmähliche Verschwinden der
Wirklichkeit. München: Hanser, 3. erw. Auflage.
Herman, J.L. (1988). The faces of meaning: Teachers',
administrators', and students' views of the effects of ACOT. Paper
presented at the annual meetings of the AERA, New Orleans, April
1988.
Hermann, T. (1982). Ueber begriffliche Schwächen
kognitivistischer Kognitionstheorien: Begriffsinflation und
Akteur-System-Kontamination. Zeitschrift für Sprache und
Kognition, 1, 3-14.
Hofstadter, D.R. (1985). Gödel, Escher, Bach - ein
endloses geflochtenes Band. Stuttgart: Kohlhammer.
Hunt, E. (1989). Cognitive Science: definition, status, and
questions. Annual Review of Psychology, 40, 603-629.
Kempe, P. (1977). Wenn die Sinne schweigen, sprechen die Nerven.
Psychologie Heute, 4(8) , 13-18.
Kiesler, S. & Sproull, L.S. (1987) (Eds.). Computing and
change on campus. New York: Cambridge University Press.
Kraut, R.E. (Ed.), (1987). Technology and the transformation of
white-collar work. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Mackintosh, A.R. (1988). Dr. Atanasoff's Computer. Scientific
American, 259, 72-78.
Mandl, H. & Spada, H. (1988) (Hrsg.).
Wissenspsychologie. München: Psychologie Verlags
Union.
Mandler, G. (1988). Memory: Conscious and inconscious. In P.R.
Solomon, G.R. Goethals, C.M. Kelley & B.R. Stephens (Eds.),
Memory: Interdisciplinary approaches (pp. 84-106). Berlin:
Springer.
Matthies, H. (1986). Learning and memory: Mechanisms of
information storage. Oxford: Oxford University Press.
Mowshowitz, A. (1980). Ethics and cultural integration in a
computerized world. In A. Moswshowitz (Ed.), Human choice and
computers (pp. 251-269). Amsterdam: North-Holland.
Newell, A. & Simon, H.A. (1972). Human problem solving.
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Papert, S. (1980). Mindstorms. Children, computer and powerful
ideas. New York: Basic Books.
Pea, R.D., Kurland, D.M. & Hawkins, J. (1986). LOGO and the
development of thinking skills. In R.D. Pea & K. Sheingold
(Eds.), Mirrors of minds: Patterns of experience in educational
computing (pp. 178-197). Norwood, NJ: Ablex.
Pflüger, J. & Schurz, R. (1987). Der maschinelle
Charakter: Sozialpsychologische Aspekte des Umgangs mit
Computern. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Pylyshyn, Z.W. (1984). Computation and cognition: toward a
foundation of Cognitive Science. Cambridge Mass.: MIT Press.
Salomon, G. (1979). Interaction of media, cognition, and
learning. San Francisco: Jossey-Bass.
Salomon, G. (1984). Media's effects on children's thinking
patterns. Educational Media International, 4, 2-7.
Schütz, A. & Luckmann, T. (1979). Strukturen der
Lebenswelt. Frankfurt: Suhrkamp.
Simon, Th.W. (1979). Philosophical objections to programs and
theories. In M. Ringle (Ed.), Philosophical perspectives in
artificial intelligence (pp. 225-242). Brighton, Sussex:
Harvester Press.
Smith, L.S. & Mosier, J.N. (1986). Guidelines for designing
user interface software. Bedford, MASS.: The MITRE
Corporation.
Streitz, N.A. (1988). Psychologische Aspekte der
Mensch-Computer-Interaktion. In B. Zimolong & C. Graf Hoyos
(Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie:
Ingenieurpsychologie. Göttingen: Hogrefe, im Druck.
Turkle, S. (1984). Die Wundermaschine: Vom Entstehen der
Computerkultur. Reinbek: Rowohlt.
Udris, I. & Ulich, E. (1987). Organisations- und
Technikgestaltung: Prozess- und partizipationsorientierte
Arbeitsanalysen. In K. Sonntag (Hrsg.), Arbeitsanalyse und
Technikentwicklung (S. 49-68). Köln: Wirtschaftsverlag
Bachem.
Ulich, E. (1983) (Hrsg.). Technologie und Kultur. Psychosozial,
3 (ganzer Band).
Ulich, E. (1988). Arbeits- und organisationspsychologische
Aspekte. In H. Balzert u.a. (Hrsg.), Einführung in die
Software-Ergonomie (S. 49-66). Berlin: de Gruyter.
Volpert, W. (1985). Zauberlehrlinge: Die gefährliche Liebe
zum Computer. Weinheim: Beltz.
Weizenbaum, J. (1978). Die Macht der Computer und die Ohnmacht
der Vernunft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Wellman, H.M. (1985). The child's theory of mind: The development
of conceptions of cognition. In S.R. Yussen (Ed.), The growth of
reflection in children (pp. 169-206). Orlando: Academic
Press.
Whorf, B.L. (1963). Sprache, Denken, Wirklichkeit. Reinbek:
Rowohlt.
Wineman, J.D. (1986)(Ed.). Behavioral issues in office
design. New York: Van Nostrand.
Inhalt
| Top of
Page