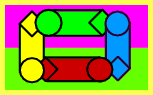Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 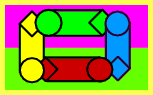 |
Journal Article 1987 |
Gemeinschaft und Vereinsamung im strukturierten Raum: psychologische Architekturkritik am Beispiel Altersheim | 1987.01 |
@DwellTheo @DwellRes @DwellPrax @EcoPersp |
59 / 63KB Last revised 98.11.01 |
Alfred Lang; Kilian Bühlmann & Eric Oberli Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 46 (3/4) 277-289. | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Inhalt
Zusammenfassug: Aspekte einer Wohnpsychologie werden
essayartig auf drei Ebenen dargestellt. (a) Eine theoretische Skizze
gibt eine psychologische Antwort auf die Frage, warum wir so bauen
wie wir bauen: das Gebaute und Gestaltete wird als externalisierte
Erkenntnis- und Handlungsstruktur aufgefasst, deren wesentliche
Funktion in der Regulation von Autonomie und Integration von
Individuen und Gruppen gesehen wird. (b) Ausschnitte aus drei Studien
in einem Altersheim zeigen die empirische Fruchtbarkeit dieser
Heuristik. (c) Ein psychologisch fundiertes Verständnis des
Bauens und des Benutzens des Gebauten ist von hoher praktischer
Relevanz.
Abstract: Communality and Lonesomeness in structured space:
a psychological critique of architecture for the elderly. Some
features of a psychology of the dwelling process are presented in the
form of an essay on three levels. (a) On a theoretical level a
psychological answer is given to the question why we build the way we
build: the built and the designed is conceived as an externalized
cognitive and action structure, the essential function of which is
seen in the regulation of autonomy and integration of individuals and
groups. (b) The empirical relevance of this heuristic is demonstrated
with some results of three studies done in a home for the elderly.
(c) A psychologically founded understanding of building and of using
the built is also of high practical relvance.
- 1 Wohnpsychologie
- 1.1 Gebautes als externale Erkenntnis- und Handlungsstruktur
- 1.2 Was leistet das Bauen für das Wohnen der Menschen?
- 1.3 Autonomie und Integration
- 1.3.1 Aktivationskonzept
- 1.3.2 Entwicklungskonzept
- 1.3.3 Interaktionskonzept
- 2 Untersuchungen im Altersheim
- 2.1 Umwelt und Wohnen im Alter
- 2.2 Das Altersheim Aespliz: Zugangsweisen und Befunde
- 2.2.1 Verhaltenskartographie: was tun die Betagten wann und wo und mit wem?
- 2.2.2 Spurensicherung: wie ist der Dialog der Betagten mit ihrer physischen Umwelt?
- 2.2.3 Gespräch- und Möglierungsstudie: wie deuten und definieren die Betagten ihren Umweltbezug?
- 3 Konstruktive Architekturkritik vom Menschen aus
- 3.1 Ein Rundgang mit Ausblicken
- 3.1.1 Die Zimmertür
- 3.1.2 Gruppenraum oder Korridor?
- 3.1.3 Die Wohngruppe oder das Betagten-Management
- 3.1.4 Ess-Saal oder Gemeinschaftsraum?
- Literatur
Dieser Aufsatz soll einen Einblick in unser umweltpsychologisches
Denken und Forschen geben. Die Darstellung ist essayartig und auf
drei Ebenen zu lesen: (a) als eine Skizze der Wohnpsychologie des
Erstautors, (b) als Kurzbericht über die empirische Diplomarbeit
der beiden Mitautoren, (c) als Heuristisches und Praktisches zum
Nutzen der Betroffenen. Der Text ist in Anlehnung an diese Ebenen
gegliedert, greift aber auch vor und zurück. Der Beitrag
plädiert für eine intensivere Integration
ökopsychologischer Erkenntnisse in die Architekturtheorie, in
die Baupraxis und insbesondere in den täglichen Umgang mit dem
Gebauten.
Wohnpsychologie
Wohnpsychologie ist zunächst eine Antwort auf die Frage,
warum die Menschen bauen und was sie in und mit dem Gebauten tun. Es
ist üblich, diese Warum-Frage mit dem Hinweis auf Funktionen des
Gebauten zu erledigen: Schutz vor Witterung und vor Feinden,
Aufbewahrung von Vorräten und Besitz, Erleichterung von
Vitalfunktionen wie Erholung und Aufzucht. Fragt man, warum gerade so
gebaut wird wie gebaut wird, so wird auf klimatische Bedingungen und
verfügbare Baumaterialien und die darauf gründenden
Traditionen verwiesen. Solche Argumentationen mögen partiell
stimmen, verstellen jedoch den Blick auf wesentlichere
Bedingungen.
Aus dem Vergleich menschlichen Bauens mit territorialem Markieren
und instinktgesteuertem Bauen beim Tier wird deutlich, dass es um
miteinander verbundene räumliche und soziale
Strukturierungsprozesse geht. Es ist also angezeigt, das Bauen und
den Umgang mit dem Gebauten zumindest als eine Manifestation der
psychischen und sozialen Organisation des Menschen zu begreifen.
Bauen und Gebautes sind nun wohl seit langem ein zentraler Gegenstand
kulturgeschichtlicher und ethnographischer Verständnisversuche;
eine Kulturpsychologie und -soziologie des Bauens als die
Herausarbeitung ihrer allgemeinen Bedingungsgrundlage gibt es jedoch
nur in Ansätzen (vgl. zB Boesch 1980; Csikszentmihalyi &
Rochberg-Halton 1981; Rapoport 1982; Broadbent et al. 1980).
Ohne auf Einzelheiten der Herleitung und Begründung eingehen
zu können (vgl. Lang 1988 a und c) möchten wir hierzu ein
allgemeines Theorem zur Bedeutung des Gebauten darstellen und hernach
seine Konkretisierung zum Verständnis des Wohnens
skizzieren.
Gebautes als externale Erkenntnis- und
Handlungsstruktur
Als Psychologen verstehen wir unseren Gegenstand, den Menschen,
i.d.R. als ein relativ abgeschlossenes Gebilde, dessen Verhalten und
Erleben im wesentlichen aus ihm selbst erklärt werden soll,
nämlich aus seiner sogenannten Erkenntnisstruktur, das ist das
angeborene und im Lauf der Lebensgeschichte aufgebaute innere
Bedingungs-Insgesamt des Erlebens und Verhaltens. Diese Aussage
trifft gleicherweise zu, ob man Bewusstsein als eine essentielle
Eigenschaft der Erkenntnisstruktur oder als ein Epiphänomen
betrachtet. Handlungsprozesse interessieren fast ausschliesslich als
Resultat solcher psychischer Bedingungen; nur ausnahmsweise, etwa in
der Sozialpsychologie, werden sie ihrerseits zu Bedingungen der
psychischen Organisation (von andern). Der grossangelegte Versuch der
Behavioristen, diese Akzentsetzung auf den Kopf zu stellen und nur
noch Reiz und Reaktion, also Weltereignisse anstatt Psychisches, zu
thematisieren, ist -- obwohl methodisch unverzichtbar -- inhaltlich
gescheitert. Könnte es sein, dass diese beiden Zugangsweisen,
die individuumszentrierte wie die weltzentrierte, den Menschen
verpassen, weil sie übersehen, dass ein Mensch ohne seine Umwelt
gar nicht existenzfähig ist?
Es gibt in der Tat keine guten Gründe für den
üblichen scharfen Schnitt zwischen innen und aussen (Lang 1985).
Wir versuchen deshalb, aus der bestehenden Blockierung der
Psychologie mit einem ökopsychologischen Ansatz herauszukommen,
welcher Mensch-Umwelt-Einheiten zu seinem Gegenstand erhebt (Lang
1988 a und c).
Demgemäss ist zu erwägen, dass die Verhaltensbedingungen
weder als Stimulation noch als Interpretation ausreichend begriffen
werden, sondern stets externe und interne Komponenten kombinieren. So
wird unwichtig, ob wir diese Bedingungen innerhalb der psychischen
Organisation oder ausserhalb lokalisieren. Wenn wir den Gedanken des
Funktionskreises (von Uexküll und Kriszat 1934) ernstnehmen,
sollten insbesondere auch jene Verhaltensbedingungen interessieren,
welche wir Menschen selber hergestellt haben: das ist, im weiten Sinn
verstanden, die Kultur (Boesch 1980). Das Gebaute nimmt da sicher
einen prominenten Platz ein, sowohl infolge seines
kulturgeschichtlich frühen Ursprungs wie auch seiner
ubiquitären Wirkung. Die Überlegung gilt jedoch in analoger
Weise für alles Gestaltete, seien es die Dinge des Alltags, sei
es die Kunst oder Kultur im engeren Sinn (vgl. Csikszentmihalyi &
Rochberg-Halton 1981).
Solche Überlegungen führten uns zum Versuch, das Gebaute
und das Gestaltete als eine externale Erkenntnis- und
Handlungsstruktur zu begreifen, in welcher ähnlich wie beim
Genom und beim Individualgedächtnis eine Erfahrungsgeschichte
nicht nur "niedergeschrieben" wird, sondern sich jederzeit im Erleben
und Verhalten generativ geltend machen kann und also stets wieder zu
etwas führt. Gebautes und Gestaltetes ist zumeist nicht nur viel
dauerhafter als das Individualgedächtnis, das wir im Kopf haben;
es ist auch stets mehreren Menschen gemeinsam, ist also wie das
Geschriebene ein kollektives oder soziales Zeichensystem oder ein
Code.
Nach allem, was wir bisher über die Bedeutung gebauter
Strukturen für das menschliche Dasein wissen, ist nicht zu
übersehen, dass diese Wechselbezüge zwischen Mensch und
physischer Umwelt ähnlich wie die nichtverbale Interaktion im
Sozialbezug sehr urtümlich sind und im bewussten Erleben nur
äusserst spärlich und meistens verzerrt einen Niederschlag
finden. Es besteht also eine Aufgabe für die
(Umwelt-)Psychologie, die Bedeutung und die Leistungen dieses
überindividuellen Aktiv-Gedächtnisses aufzuzeigen und seine
Bedingungen, sein Werden und seine Wirkungen wissenschaftlich zu
rekonstruieren. M.a.W. wir zielen auf eine Formulierung einer
"Grammatik" oder Semiotik des Bauens und des Umgangs mit Gebautem.
Auch im Wohnen und in andern Tätigkeiten im Gebauten und um das
Gebaute herum manifestiert sich diese "Sprache". Derzeit
verfügen wir nur über Fragmente zu solcher Semiotik in
ihren signifikativen und kommunikativen Aspekten (Broadbent et al.
1980; Eco 1976).
Wie wir aus den verschiedenen Theorien der Sprache und anderer
Codiersysteme wissen, lassen sich immer wieder drei Leistungen von
Zeichensystemen mehr oder weniger deutlich voneinander unterscheiden
(wir verwenden mit Absicht eine ungebundene Terminologie, weil
schärfere oder weitergehende Differenzierungen bestimmter
Ansätze, etwa der Sprechakttheorie, hier nicht verfolgt werden
können): (a) die Zeichen legen etwas dar oder
repräsentieren etwas für jemanden; (b) die Zeichen
drücken für jemanden etwas aus oder machen jemanden auf
etwas aufmerksam; (c) die Zeichen veranlassen jemanden zu etwas oder
bewirken bei jemandem etwas. Das gilt auch für Gebautes; doch
dürfte in unserem Zusammenhang die zweite und vor allem die
dritte Leistung von besonderem Interesse sein. So reflektiert oder
repräsentiert eine zwischen zwei Gruppen gebaute Mauer die
Zweiteilung eines Ganzen; wichtiger ist sie aber als ein Aufweiser
von Trennung und Zugehörigkeit für alle Beteiligten; und
sie bestimmt räumliches und soziales Verhalten sowohl der
Hiesigen wie der Jenseitigen, indem sie diese zugleich zueinander
attrahiert und voneinander fernhält. Ähnliches liesse sich
von vielen Baugrundformen wie Tür, Podium, Nische usw. und
Objektklassen wie Kleider, Werkzeuge, Fahrzeuge usw. aufzeigen.
Was leistet das Bauen für das Wohnen der
Menschen?
Versuchen wir nun, solche generellen Bedeutungen des Gebauten, die
zu den spezifischen Nützlichkeiten des "Was man damit machen
kann" stets unvermeidbar hinzukommen, auf den Wohnbereich zu
übertragen. Wie schon angedeutet dienen der geläufigen
Architekturtheorie Wohnbauten der Erfüllung spezifischer
Bedürfnisse, etwa zur Erholung, zur Ernährung, zur Hygiene,
zur Geselligkeit, zur Aufbewahrung von Besitz usw.; dazu kommen
gewisse ästhetische, logistische und ökonomische
Erfordernisse. Aus psychologischer Sicht ist Gebautes ein Träger
psychischer und sozialer Strukturen und Prozesse ähnlich wie das
Genom ein Träger einer organismischen Form und das
Gedächtnis ein Träger einer psychischen Organisation ist.
In zwei Bereichen scheint Gebautes von besonderer Bedeutung zu sein:
dem der Entwicklung (vgl. Lang 1981 und 1988 b) und dem der sozialen
Bezüge. Letztere sind in unserem Zusammenhang von besonderem
Interesse. Wie schon in Beispielen angedeutet, ist ein wesentliches
Element des Bauens das Aus- und Eingrenzen. Das unmittelbare Ergebnis
des Bauens ist strukturierter Raum; seine psychosoziale Bedeutung hat
demnach mit dem Einbinden und Aussondern von Menschen, Individuen und
Gruppen zu tun. Mit andern Worten, gebaute Strukturen sind kulturelle
Regulatoren der Autonomie und der Integration von Individuen und
Gruppen in die umgebende (soziale) Welt.
Autonomie und Integration
Mit diesem Begriffspaar sei ein Rahmenkonstrukt in Form einer
grundlegenden, wertneutralen Polarität menschlicher Existenz
gekennzeichnet. Denn Autonomie oder Integration können unter
realen Bedingungen menschlichen Lebens niemals je zur Gänze
verwirklicht werden, ohne dass gerade auch die Existenz aufs Spiel
gesetzt wird. Damit wird auch deutlich, dass jede Wertung für
oder gegen den einen oder den anderen Pol allenfalls
vorübergehenden Charakter haben kann. In dieser Hinsicht
bezeichnen wir das Rahmenkonstrukt als wertneutral; nicht zu
verkennen aber ist, dass das Konstrukt nicht in einem beliebigen
Menschenbild denkbar wäre und mithin auf dieser Ebene auch
wertbehaftet ist.
Nun ist das Rahmenkonstrukt mit Inhalten anzureichern derart, dass
Gebautes in seiner regulatorischen Rolle in konkreten
Mensch-Umwelt-Transaktionen erfasst werden kann. Erwünscht ist
auch die Einbettung solcher Konkretisationen in bewährte
psychologische Konstrukte. Aufgrund theoretischer Erwägungen und
eines mannigfaltigen empirischen Materials aus einer langen Reihe von
Diplomarbeiten glauben wir, alle wesentlichen Aspekte der
Wohntätigkeit, die über das rein funktionale hinausgehen,
in drei Konzepten begrifflich fassen zu können. Methodisch
gesehen handelt es sich um Heuristiken der Forschung. Sie zielen
darauf ab, die Art und Weise des Umgangs von Menschen mit der
physischen Umwelt wie ebenso der physischen Welt mit den Menschen
ökologisch, dh in ihrer psychosozialen Bedeutung, zu erfassen
und in allgemeinere psychologische Theorien einzubinden.
Die drei Konzepte betreffen (a) die aktuelle
Befindlichkeitsregulierung des Individuums für sich
(Aktivation), (b) die längerfristige Existenzregulation im
Hinblick auf die personale und soziale Identität (Entwicklung)
und (c) die soziale Bezugsregulation (Interaktion).
Aktivationskonzept
Mit "Aktivation" beziehen wir uns auf die gleichnamigen
Konzeptionen von Motivation und Persönlichkeit, welche die
Vorstellung eines selbstregulativen und zustandsoptimierenden
Gesamtsystems von miteinander in Wechselwirkung stehenden Teilen
evoziert. Jede Wohntätigkeit (wie natürlich jede
Tätigkeit überhaupt) stützt oder verändert das
aktuelle Aktivationsniveau einer Person. Indem der Wohnende eine je
bestimmte Umgebung auswählt und gestaltet, wirken von dieser
durch ihre kollativen Eigenschaften, dh durch ihren
Komplexitätsgrad, ihre (In)kongruenzen, ihre
Aufforderungscharaktere usw., stimulierende bzw.
erregungsdämpfende Einflüsse auf den Aktor zurück.
Wohnen ist in dieser Hinsicht besonders bedeutsam, weil es mehr als
die meisten andern Tätigkeiten ein relativ hohes Mass an
Eigenbestimmtheit bietet, und zwar sowohl bei der je aktuellen
Auswahl der Situation aus einem verfügbaren Spektrum
unterschiedlich erregender oder dämpfender Umgebungen (zB Ruhe-
oder Aktivbereiche in einem Zimmer, unterschiedlich gestaltete
Zimmer, Orientierung nach Strasse oder Hof, u.dgl.), wie auch bei der
für kürzere oder längere Zeit das Leben bestimmenden
Gestaltung der Wohnumgebung durch das Individuum oder die kleine
Gruppe, insbesondere die Familie. Durch die Auswahl und Anordnung der
Dinge, die das Innere einer Wohnung prägen, aber auch durch die
Eigenschaften der baulichen Strukturen wie zB Grösse der
Räume, Massivität der Wände, Grösse der Fenster
u.dgl., wird ein äusserst komplexes Einflussfeld bestimmt, dem
kein Mensch entgehen kann. Durch seine relative Beständigkeit
übt es im wesentlichen einen stabilisierenden Einfluss auf die
darin lebenden Personen aus -- man spricht ja von der Wohnung als
Heim und Heimat --, und es ist doch zugleich immer ein Feld von
Anregungen und Aufforderungen: das Haus als Mikrokosmos.
Entwicklungskonzept
Im letztgenannten Beispiel wird schon deutlich, dass die im
Wohnbereich thematisierte Mensch-Umwelt-Einheit nur verstanden werden
kann, wenn man die wechselseitigen Beeinflussungen zwischen Mensch
und Umwelt über längere Zeiträume verfolgt. Indem das
Gebaute in der Regel zeitlich länger erstreckt ist als die
zugehörigen menschlichen Tätigkeiten -- ein Haus
überdauert Generationen, eine Stadt Kulturen, eine
Zimmereinrichtung Lebensphasen, wenn nicht immer in ihrer stofflichen
Substanz so doch in ihrer charakteristischen Form -- , ergibt sich
eine eigenartige, weit über die Zustandsregulation
hinausreichende Dialektik zwischen Mensch und Welt, die wir im
Entwicklungskonzept einzufangen versuchen (vgl. auch Lang 1988 b).
Insofern so zwischen einem Menschen und Weltteilen eine Spannung
entsteht, welche über das aktuelle Auswählen oder Gestalten
hinaus zu späteren Zeitpunkten auf den Menschen
zurückwirkt, sprechen wir von Selbstpflege oder Kultivation; der
Besitz von -- und das heisst im wesentlichen die Verfügbarkeit
über -- Haus und Dingen erhält so eine
(entwicklungs)psychologische Bedeutung von einer Tragweite, wie sie
bisher kaum thematisiert worden ist (vgl. auch Cszikszentmihalyi
& Rochberg-Halton 1981); denn Entwicklung ist nur aus dem
Verhältnis von zwei relativ voneinander unabhängigen
Entitäten zu verstehen. Anderseits ist durch den sozialen
Charakter von Haus und Dingen -- insbesondere durch die abgestufte
Zugänglichkeit der sogenannten Privatsphäre eines
Individuums oder einer Kleingruppe -- das kommunikative Geschehen
zwischen Individuen, zwischen Individuum und Gruppe und zwischen
Gruppen massiv erweitert: wir sprechen hier aus psychologischer
Perspektive zunächst von Selbstdarstellung, die aber
natürlich sozialpsychologisch und soziologisch in
Reziprozität gesehen werden muss. Besitz -- wiederum von
Gebautem und von Dingen -- schweisst nicht nur Familien und Sippen
über weite Zeiten und Räume zusammen, sondern ist auch ein
wesentlicher Träger des konkreten sozialen Geschehens in der
alltäglichen Auseinandersetzung. In welchem Ausmass in den
industrialisierten Gesellschaften Machtausübung den Umweg
über die Gestaltungs- und Verfügungsgewalt über Dinge
(und Häuser) genommen hat, ist bisher von der Psychologie
weitgehend übersehen worden. Ist bei der Selbstpflege der
repräsentative Aspekt der externalen Erkenntnis- und
Handlungsstruktur angesprochen, so bestimmt das Gestaltete bei der
Selbstdarstellung in erster Linie durch expressive und appellative
Momente den Grad der realisierten Autonomie und Integration.
Interaktionskonzept
Das dritte Konzept thematisiert demgemäss stärker den
sozialen Prozess und Bezug. Psychologisch nimmt es die wichtigen
umweltpsychologischen Themen der Privatheit und der
Territorialität auf. Diese und weitere verwandte Themen wie
Proxemics, halböffentlicher Raum, Soziopetalität und
-fugalität u.ä. sind mit dem Nachteil behaftet, dass sie
phänomenklassifizierend entstanden und daher nur schwer auf ein
gemeinsames Prinzip zu generalisieren sind. Im umweltpsychologischen
Interaktionskonzept wird die Rolle des Gestalteten und Gebauten
für die Definition und die Veränderung des
zwischenmenschlichen Bezuges untersucht. Die in den genannten
Themenbereichen eingefangenen Phänomene werden als Resultanten
von Regulationsprozessen betrachtet, in denen Raum und Objekte als
Bestandteile der externalen Erkenntnis- und Handlungsstruktur soziale
Interaktionen und Bezüge tragen. Wiederum hat sich die
Psychologie langezeit durch die Beschränkung auf Interaktionen
zwischen Menschen blindgemacht für sehr wesentliche Dimensionen
des Zusammenlebens, die bei der Analyse von Mensch-Umwelt-Einheiten
sichtbar werden.
Beispielhaft für ein ökopsychologisches Verständnis
des Sozialbezugs scheinen uns die Studien von Baum und Valins (1977
u. später). In verschiedenen Untersuchungen in
Studentenwohnheimen haben die Autoren nachgewiesen, dass nach
Zufallszuteilung zu unterschiedlichen Wohnsituationen in wenigen
Wochen völlig unterschiedliches Sozialverhalten zu beobachten
ist. Das Wohnen in zentral orientierten Strukturen mit
familienähnlichen Wohngruppen führt zu sozial
interessierten, das Wohnen in linear angeordneten Zimmerfluchten mit
homogenisierenden Grossgruppen hingegen zu sozial defensiven,
interaktionsscheuen, tendenziell misstrauischen Haltungen. Diese
unterschiedlichen Haltungen werden im Alltagsverhalten manifest, und
zwar weit über die Wohnsituation hinaus.
In welchem Ausmass räumliche und materielle Gegebenheiten
insgesamt soziale Bezüge und Prozesse tragen und bestimmen,
braucht hier nicht weiter ausgeführt werden.
Im Rahmen des Interaktionskonzeptes kommt das Inhaltliche der
Autonomie-Integrations-Regulation am direktesten zum Ausdruck;
Voraussetzung dazu ist ein Lebewesen, welches gegen
Ausseneinflüsse in gebührendem Mass und Wechsel sich sowohl
abschirmen wie auf sie eingehen kann (Aktivationskonzept) und welches
mit Veränderungen der Welt sowohl mitgehen wie in Abhebung von
ihr es selbst bleiben kann (Entwicklungskonzept).
Top of Page
Untersuchungen
im Altersheim
Die hier nur in groben Zügen vermittelte psychologische
Wohntheorie ist zur Hauptsache in bezug auf das Wohnen von Familien
entwickelt worden. Sie lässt sich in mancherlei Hinsicht auf
Wohnen in Institutionen anwenden.
Umwelt und Wohnen im Alter
Während sich in den letzten Jahrzehnten eine facettenreiche
Alterspsychologie herausgebildet hat, ist das Thema des Umweltbezugs
der Betagten zwar nicht gerade vernachlässigt worden (Lawton
1980, Carp 1987); doch nur wenige Arbeiten haben sich spezifisch mit
der institutionellen Wohnsituation von Betagten (Baltes et al. 1983,
Saup 1985 und 1986/7) oder Pflegebedürftigen (Welter 1983)
befasst. Im ganzen vermittelt diese Literatur den Eindruck, dass
Altersheimbau- und -betrieb den Charakter einer Problemlösung
angenommen haben, nämlich als das Bereitstellen einer (relativ
umfassenden) "Prothese" verstanden wird. Die gerontopsychologische
Diskussion dreht sich in diesem Bereich überwiegend um die auch
aus der Arbeitspsychologie bekannte Kontroverse bezüglich
Kongruenz -- soll die Betagtenumwelt den beschränkten
Kompetenzen des Betagten entgegenkommen? -- vs. Komplementarität
-- soll die Umwelt die Defizite der Betagten so weit wie möglich
aufzuheben versuchen? Sehr viel ist dabei die Rede von
"Bedürfnissen" der Betagten; diese werden selten expliziert,
aber (siehe unten) fast stets normativ impliziert. Dass diese Sichten
ihre Begründung im gesamten institutionellen Netz
arbeitsteiliger Gesellschafts- und Einflusstrukturen haben, kann hier
ebenfalls nur angedeutet werden. Für uns wichtig geworden ist
jedoch die Feststellung fehlender "Distanz" aller Beteiligten -- der
Planer, Architekten, Betreuer, Betagten und Angehörigen -- zum
Gebauten; während gewisse Dysfunktionalitäten für den
Betrieb meist verhältnismässig rasch erkannt und in der
Architekturentwicklung der letzten Jahre in hohem Masse behoben
worden sind, fehlt den meisten der Blick und fehlen Begriffe für
die psychologische Bedeutung des Gebauten für die Betagten und
die übrigen Beteiligten.
Wir beschreiben nachfolgend, ohne auf die vorliegende Literatur
weiter eingehen zu können, unsere unter den Leitlinien der oben
skizzierten wohnpsychologischen Heuristik durchgeführten Studien
in einem Betagtenheim einer Berner Vorortgemeinde (Details in
Bühlmann & Oberli 1987). Auch auf die Diskussion
methodischer Probleme, etwa die interessante Frage des
Verhältnisses von Beobachtungsdaten und verbal vermittelten
Befunden, können wir nicht eintreten.
Das Altersheim Aespliz: Zugangsweisen und
Befunde
Das Altersheim Aespliz ist ein "Norm"-Heim entsprechend den
Richtlinien der kantonalbernischen Fürsorgedirektion und des
Bundesamtes für Sozialversicherungen. Es wird getragen von zwei
politischen Gemeinden. In der Nähe eines Gemeindezentrums
gelegen umfasst es neben einem Stützpunkt der
Gemeindekrankenpflege und einer Wohnung für das Heimleiterpaar
42 Betagtenzimmer und die erforderlichen Betriebseinrichtungen. In
den Wettbewerbsunterlagen wird postuliert, dass das Heim "den
wesentlichen Lebens- und Gesundheitsbedürfnisse der Betagten"
entsprechen soll; es "soll ein wohnliches Zuhause bieten, die
Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten und
die Beibehaltung eines angemessenen Teils an individueller
Lebensgestaltung ermöglichen." Zusätzlich wird Wert auf
"Wirtschaftlichkeit" und "rationellen Betrieb" sowie auf einen "hohen
Grad an Nutzungsneutralität" gelegt, da sich "die
Bedürfnisse in der Altersfürsorge über längere
Zeit kaum genau festlegen" lassen.
__________________________
Abbildung 1 etwa hier
__________________________
Die Wohnräume für die Betagten liegen auf drei
Geschossen; sie sind mit den Gemeinschaftsräumen auf dem
mittleren Hauptgeschoss um einen Innenhof gruppiert. Wie dem
Grundriss des Hauptgeschosses in Abbildung 1 zu entnehmen ist, bilden
je 7 Zimmer mit einem Gruppenraum eine Wohngruppe. Unsere
Untersuchungen richteten sich mit drei Methoden zur Hauptsache auf
den heimintern-öffentlichen Bereich, dh den Eingangs- und
Aufenthaltsbereich und die Korridore und Gruppenräume; in einer
Wohngruppe wurden zudem die Zimmermöblierungen aufgenommen und
ausführliche Gespräche über die Lebenssituation
geführt.
Verhaltenskartographie: was tun die Betagten wann und wo und
mit wem?
Mit dem nachgerade "klassischen" Verfahren der
Verhaltenskartographie untersuchten wir die innerhalb der
Heimöffentlichkeit stattfindenden Tätigkeiten nach ihrer
räumlichen und zeitlichen Verteilung und in ihren sozialen
Bezügen. Die zu insgesamt 406 Zeitpunkten während zweier
Wochen erhobenen 7336 Beobachtungen wurden 14 Inhaltskategorien
zugeteilt und nach den verschiedensten Gesichtspunkten analysiert.
Sie ergeben ein reichhaltiges, wenngleich gewiss nicht umfassendes
Bild des Alltags im Altersheim.
Statt hier einige der vielen Einzelergebnisse unzulänglich
darzustellen, beschreiben wir auf der Interpretationsebene unsere
zusammenfassende Einsicht, welche die Studie mit vielen Indizien
nahelegt: nämlich dass die mit ganz beträchtlichem
materiellem und ideellem Aufwand entworfenen und ausgestatteten
heimintern-öffentlichen Bereiche nur wenig spontan und ihrer
Intention entsprechend zur Interaktion genutzt werden. Die
heiminterne "Öffentlichkeit" ist weitgehend durch
institutionalisierte, vom strukturierten Tagesablauf bestimmte
Tätigkeiten gekennzeichnet.
Etwas pauschalisierend ausgedrückt lässt sich den
Ergebnissen entnehmen, dass die Gemeinschaftsräume im Bereich
der Eingangszone mit Ausnahme der Cafeteria von den Betagten
vorwiegend zum Essen und zum Besuch von Veranstaltungen aufgesucht
werden; zu den übrigen Zeiten stehen sie nahezu leer bzw. dienen
als Arbeitsort des Personals. Die Gruppenräume -- konzeptuell
ebenfalls als interaktionsfördernd intendiert -- lassen sich mit
einer Ausnahme (vgl. unten im Abschnitt "Gruppenraum oder Korridor?")
in ihrem Tätigkeitsprofil kaum von den Korridoren unterscheiden;
dh sie erfüllen eigentlich ihre soziale Aufgabe ebenfalls nicht.
Selbstinitiierte, über das gegenseitige Beobachten und den
unumgänglichen Austausch von Höflichkeiten und
gelegentliche Spannungsäusserungen hinausgehende Interaktion
zwischen den Bewohnern findet praktisch nicht statt. Wenn Wohnen eine
soziale Tätigkeit ist, welche den Einzelnen zugleich in einer
physisch-symbolischen Heimat verankert und in eine Bezugsgruppe
einbindet, so findet dies im Betagtenheim nur rudimentär statt
oder ist allenfalls auf das Einzelzimmer zurückverlegt. In
dieser Hinsicht unterscheidet sich Wohnen in der Institution vom
Wohnen im grossen Wohnblock nur unwesentlich (vgl. Lang 1982 a und b,
Baltisberger 1984). Statistisch gesehen wohnen die Betagten in den
neueren Heimen mehrheitlich allein; in der gesamten Bevölkerung
der schweizerischen "Gross"-Städte sind es gemäss
Volkszählung 1988 44%.
Diese summarischen Aussagen müssen als vorläufig und im
Sinne von Fragen an die gängigen fürsorgerischen und
architektonischen Konzeptionen betrachtet werden. Sollten sich die
Feststellungen in weiteren Untersuchungen bestätigen lassen --
wie es dem gefühlsmässigen Eindruck des regelmässigen
Altersheimbesuchers entspricht --, so wäre zumindest angezeigt,
diesbezügliche Planungskonzepte zu überprüfen. Wenn
Einsamkeit und Vereinsamung das grosse psychosoziale Problem der
kommenden Jahrzehnte ist -- und viele Indizien sprechen dafür
--, dann ist die These zu verfolgen, es sei uns bisher nicht
gelungen, durch Bauen präventiv oder gar kompensatorisch zu
wirken. Beim jetzigen Kenntnisstand (vgl. etwa Seamon & Mugerauer
1985, Stokols & Altman 1987) sind wir dezidiert der Meinung, dies
widerlege nicht das umweltpsychologische Credo der Bedeutung des
Gebauten für den Menschen, sondern zeuge vielmehr für ein
mangelhaftes Verständnis dieser Bedeutung.
Spurensicherung: wie ist der Dialog der Betagten mit ihrer
physischen Umwelt?
Während unsere verhaltenskartographische Studie unter der
Ägide des Interaktionskonzepts durchgeführt wurde, suchten
wir uns mit einem zweiten Ansatz gewissen Aspekten des
Entwicklungskonzeptes anzunähern. Als Gegenthese zum Diktum:
Fertige Häuser machen manchmal die Menschen fertig, wäre zu
zeigen, dass in stetigem Wandel befindliche Bauten die
Lebensqualität ihrer Bewohner fördern. Sind Betagte nur
noch an den stabilisierenden Wirkungen ihrer Umgebung interessiert,
oder treten sie in einen Dialog mit ihrer Alltagsumwelt?
Vorausgesetzt natürlich, die Rahmenbedingungen des Heimlebens
gestatten überhaupt Akte der Selbstpflege und besonders der
Selbstdarstellung im gestalterischen Medium.
Im Laufe eines halben Jahres haben wir im gesamten
intern-öffentlichen Bereich des Heimes jede Woche eine
Bestandesaufnahme der räumlich-gestalterischen Variationen
vorgenommen. Alle Veränderungen und ebenfalls ihre
Rücknahmen wurden erfasst und nach den Kategorien: Dekorationen,
Hauswirtschaft, Information und Unterhaltung, Mobiliar, analysiert.
Dieses Verfahren der "Spurensicherung" wurde von den Autoren
anlässlich dieser Untersuchung entwickelt. Auch hier müssen
wir uns auf globale Befunde beschränken.
Im Untersuchungshalbjahr (mit Beginn kurz nach Bezug des neuen
Heimes) wurden insgesamt 1288 solche Veränderungen festgestellt,
je etwas über 500 in den Bereichen Mobiliar und Dekoration und
je etwas über 100 in den Bereichen Hauswirtschaft und
Information/Unterhaltung. Beeindruckend ist die Tatsache, dass
insgesamt 77% dieser Veränderungen wieder rückgängig
gemacht wurden, Möbel also beispielsweise nur vorübergehend
verschoben wurden. Bis zu einem gewissen Grad nutzen mithin die
Bewohner die Möglichkeit der Personalisierung ihrer Umgebung:
Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass bezüglich der
Häufigkeit von Veränderungen deutlich drei Zonen
unterschieden werden können: relativ am meisten in den Bereichen
vor den privaten Zimmern; etwas weniger in jenen öffentlichen
Räumen, die zu Dienstleistungen für alle Bewohner genutzt
werden (zB Cafeteria, Sitzgruppe); kaum Veränderungen findet man
in den Korridoren, Vorplätzen und Treppenhäusern.
Während die Veränderungen in der mittleren Gruppe zum
grössten Teil vom Personal ausgehen, findet sich in den sog.
Gruppenräumen, also den ausgeweiteten Korridoren oder "Dielen"
vor den Privatzimmertüren, ein gewissees Ausmass an
Selbstdarstellung mittels Dingen (Bilder, Pflanzen). Diese
"verdinglichte" Interaktion ist bemerkenswert, weil mit einer
Ausnahme das Angebot dieser Räume praktisch nicht für
persönliche Interaktionen angenommen worden ist.
Es beeindruckt also eher die "Widerständigkeit" des Gebauten
gegen Veränderung. Die Gründe dafür liegen im
konkreten Fall wohl weniger bei Einwänden von Personal und
Architekten gegen Zufügungen, welche die "Pflegeleichtigkeit"
vermindern oder die Ästhetik beeinträchtigen könnten.
Wichtiger scheint, dass es sich bei unserem Betagtenheim um eine
modern-postmoderne Architektur von hoher, bis ins Mobiliar
durchgezogener ästhetischer Qualität handelt, in der
"Fremdkörper" im Prinzip stören. Dies scheinen sich die
Bewohner ein Stück weit in einer Art Handlungs-Selbstzensur zu
eigen gemacht zu haben. Bauherr und Architekt haben ihren Einfluss
auf das Leben der Bewohner in der Architektur instrumentalisiert oder
verdinglicht.
Gesprächs- und Möblierungs-Studie: wie deuten und
definieren die Betagten ihren Umweltbezug?
In einer dritten Untersuchung gingen wir vor allem der Frage des
Verhältnisses von Privatbereich und heimintern-öffentlichem
Bereich nach. Man könnte die Frage auch im Rahmen des
Aktivationskonzeptes formulieren: welche Möglichkeiten der
Aktivationsregulierung bleiben den betagten Heimbewohnern. Dazu
setzten wir ein kombiniertes Verfahren der Aufnahme der
Zimmermöblierung und der Intensivbefragung zum Umzug und zur
Wohnsituation in Anlehnung an einen Frageraster ein. Die Autoren
hatten in einer Rolle als Umzugs- und Einrichtungsvolontäre das
Vertrauen der Bewohner gewonnen, so dass sich das damit verbundene
Eindringen in die Privatsphäre im Rahmen der Gegenseitigkeit
verantworten liess. Aus den reichhaltigen Befunden vermitteln wir
hier einen Eindruck mithilfe eines Fallberichts und einer Diskussion
der Problematik der Zimmergrundrisse.
Ein Fallbericht zur Bedeutung von Wohnstrukturen: Einem
85-jährigen Bekannten eines der Autoren war nach langer Ehe in
einem 3-Zimmerhaushalt die Ehefrau gestorben; ein
Krankenhausaufenthalt mit nachfolgender Pflegebedürftigkeit und
die Kündigung der Wohnung unmittelbar nach dem Todesfall liessen
als einzige Lösung einen Einzug in ein Betagten-Pflegeheim
zu.
"Im Vergleich zum Jahr vor dem Todesfall, wo ich regelmässig
trotz der engen Verhältnisse mit einem traditionellen
"Tee-Ritual" (Polstergruppe, weisses Tischtuch,
Sonntagsporzellangedeck, Kuchen) empfangen worden war, berichte ich
hier von meinem ersten Besuch im Pflegeheim: Der Besuch freute ihn
sehr; doch schien er zugleich sehr unglücklich und
vollständig "verloren" zu sein. In seinem Zimmer stand das Bett,
ein Nachttischchen, ein Stuhl, ein Kleiderschrank, ein kleiner
Salontisch und ein Polstersessel. Er wusste gar nicht, wie er hier
Besuch empfangen konnte. Ich musste im Polstersessel Platz nehmen. Es
war das einzige Möbelstück, das ihm von der alten Wohnung
übriggeblieben war. Weil er bei der Auflösung des Haushalts
nicht dabeigewesen war und niemand an ihn dachte, wurde nichts
gerettet, was ihm lieb gewesen war. Dieser Sessel erinnerte ihn (und
mich) wenigstens im weitesten Sinne an die früheren
Besuchssituationen. Im Gespräch beklagte er sich, wie er nicht
nur seine Frau verloren habe, sondern eigentlich alles: seine
Möbel, seine Dinge, und auch seine Freunde. Er würde gerne
wieder seine Bekannten zum Tee oder Wein einladen, aber dies sei
jetzt ja nicht mehr möglich; erstens habe er keinen Platz,
zweitens habe er keine Möbel, und drittens stehe das Bett im
gleichen Raum. Als vom Heimpersonal der "obligatorische" Tee serviert
wurde, wollte er, dass wir ihn in einer kleinen Aufenthaltsecke
draussen auf dem Korridor tranken; zwar schäme er sich, aber das
sei doch noch besser als drinnen; seiner Lebtag habe er nie mit einem
Besuch den Tee im Schlafzimmer getrunken. Er wolle niemanden mehr
treffen, sonst müsse er sagen, wie er wohne; aber er wohne ja
gar nicht mehr, er vegetiere nur noch dahin..."
____________________________
Abbildung 2 ungefähr hier
____________________________
Zimmergrundrisse: In Abbildung 2 geben wir zwei typische
Zimmergrundrisse mit den von den Bewohnern vorgenommenen
Möblierungen wieder, wie sie meist gemeinsam mit
Angehörigen und Heimleitung im voraus massgerecht geplant worden
sind. Ausser dem (obligatorischen) Bett, dem fakultativen Heimschrank
und einer Etagère (einem halbhohen Gestell) sind die
Möbel aus dem Privatbesitz der Bewohner. Eingangs- und
Schlafzonen sind von uns eingetragen.
In allen von uns untersuchten Möblierungsgrundrissen kommt
das Bestreben der Bewohner zum Ausdruck, in ihrem Privatzimmer drei
Zonen zu schaffen, um darin, so gut wie es halt geht, die
frühere Unterteilung ihrer Wohnung in Schlafzimmer, Wohnzimmer
und Eingangsbereich aufrechtzuerhalten. Wie die beiden Beispiele
zeigen, gelingt meistens eine einigermassen befriedigende Lösung
der Wohnzone. Zwar ist sie für die vielen Stunden das
Alleinseins überdimensioniert; doch ist sie in den meisten
Fällen unentbehrlich für die Besuche der Angehörigen;
die typischen Polstergruppen- und Esstischanordnungen dürften
auch ein Stück Kontinuität aus der alten Wohnung tragen
helfen.
Trotz der verhältnismässig grossen Grundfläche (ca.
25 m2; dazu kommen noch je etwa 4 m2 Nassraum und Balkon) gelingt die
Realisierung einer eigentlichen Schlafzone und einer Eingangszone in
den rechteckigen Räumen nicht. Im rechten, typischen Beispiel
scheint die Trennung von Wohn- und Schlafzone durch die ins Zimmer
herausragende Etagère einigermassen geglückt; die Folge
ist jedoch, dass ein von aussen Hereinkommender direkt ins
"Schlafzimmer" treten muss. Was für einen Spitalaufenthalt
angehen mag, wird beim Daueraufenthalt zu einer Belastung, auf die
der Bewohner typischerweise mit einer Erhöhung der Schwelle
zwischen Privatbereich und Heimöffentlichkeit antwortet; m.a.W.
die Zimmertür wird zu einer starken Barriere, welche wohl die
Besucher und das Heimpersonal gewissermassen ex officio
überschreiten dürfen, durch die andere Heimbewohner jedoch
nur ausnahmsweise zugelassen sind. Der öffentliche Charakter des
Korridor-Gruppenraums verstärkt vermutlich noch diese
psychologische Schwellenerhöhung. Im linken Beispiel anderseits
ist dank der seitlichen und nach aussen aufgehenden Eingangstür
eine rudimentäre Eingangszone mit einer Garderobe gelungen,
allerdings auf Kosten der Trennung zwischen Schlafen und Wohnen.
Ansätze zu besseren Lösungen fanden wir in den (hier nicht
dargestellten) Eckzimmern mit nicht-rechteckigen Grundrissen.
Top
of Page
Konstruktive
Architekturkritik vom Menschen aus
Im letzten Teil dieses Aufsatzes
möchten wir versuchen, unsere theoretischen Konzepte und die
unter deren Anleitung gewonnenen Erfahrungen im Sinne einer
konstruktiven Kritik nutzbar zu machen. Mit dem Ausdruck
"psychologische Architekturkritik" bezeichen wir eine
Beurteilungsweise, welche ein Gebäude oder eine Anlage und deren
reale Benutzer zusammen als eine Einheit betrachtet und deshalb die
Beurteilung auf eine Beschreibung und Deutung der vielfältigen
Wechselwirkungsprozesse zwischen dem Gebautem und den davon
betroffenen Menschen abstellt. Der Gegenstand psychologischer
Architekturkritik ist also nicht das Gebäude sondern sein
Gebrauch; nicht, was ein Haus ist, interessiert, sondern was Menschen
damit machen (können) und nicht machen (können), und was es
mit ihnen macht.
Unsere Überlegungen richten sich gewiss in erster Linie an
die reglementierenden und subventionierenden Behörden, an die
institutionellen Trägerschaften oder die planenden und
ausführenden Architekten und Ausstatter, ebensosehr aber auch an
die den Alltag bestimmenden Heimleiter und das Heimpersonal, und
nicht zuletzt an die Betagten selber und deren Bezugspersonen. Wir
gehen von der Feststellung aus, dass die Mehrzahl der uns
zugänglichen Betagten- und Pflegeheime einen ausserordentlich
hohen Qualitätsstandard in bau- und einrichtungstechnischer
Hinsicht realisieren und oft nur wenig Wünsche bezüglich
Funktionalität offen lassen. Dies sei durch die von uns betonten
psychosozialen Gesichtspunkt nicht in Frage gestellt; doch wäre
eine ausgewogenere Berücksichtigung der verschiedenen
Qualitätsebenen umso wünschenswerter, als
menschorientiertes Bauen und Wohnen oftmals weniger zusätzliche
Kosten verursacht als vor allem die Anwendung von vorhandenem Wissen
und etwas Phantasie erfordert.
Ein Rundgang mit Ausblicken
Auf dem beschränkten Raum können nur wenige Hinweise
gegeben werden. Wir greifen, indem wir einen hypothetischen Gang
durch ein Betagtenheim machen, eine Kette von Orten im Haus heraus,
an denen sich kritische Mensch-Haus-Bezüge manifestieren. Die
Darstellung ist zwangsweise verkürzt; methodisch verwertet sie
theoretisches, empirisches und anekdotisches Material. Den
Rückbezug auf die Wohntheorie können wir nur in Andeutungen
vollziehen.
Die Zimmertür
Wie im Abschnitt über die Gesprächs- und
Möblierungsstudie gezeigt wurde, scheinen die Architekten wie
die Heimbetreuer die Bedeutung der Zimmertür für den
Bewohner bei weitem zu unterschätzen; auch der typische Bewohner
selber ist nicht in der Lage, seinen Umgang mit der Türe zu
artikulieren, dh in der Tür mehr als eine Schliesseinrichtung zu
sehen. Es nützt also wenig, im heimintern-öffentlichen
Bereich viel Aufwand zu treiben mit der Absicht, soziale Prozesse zu
fördern, und gleichzeitig durch Zimmergrundriss und rein
"funktionale" Zimmertür zu bewirken, dass der Bewohner in der
Regel alles unternimmt, was eine schroffe Barierre zwischen innen und
aussen errichtet. Die Rationaliserung, der Betagte wünsche
eigentlich wenig neue Kontakte anzuküpfen, ist da oft allzu
rasch zur Hand; wenn man sie wirklich ernst nähme, müsste
man eigentlich auf Gemeinschaftsräume verzichten.
Gruppenraum oder Korridor?
Wie in der Verhaltenskartographiestudie dargelegt wurde,
funktionieren die rein architektonisch geglückt scheinenden
Gruppenräume mit vielleicht einer Ausnahme derzeit nicht.
Während in Ess-Saal und Cafeteria 73 % der täglich
beobachteten Tätigkeiten der Bewohner stattfinden (wie
erwähnt, überwiegend organisierte Tätigkeiten), ziehen
alle 5 Gruppenräume zusammen nur 7% der (spontanen)
Tätigkeiten auf sich; davon fallen mehr als die Hälfte der
beobachteten Tätigkeiten auf einen einzigen der 5
Gruppenräume, nämlich denjenigen im südwestlichen
Obergeschoss. Die Erklärung könnte darin gesucht werden,
dass sich hier zufällig eine Gruppen von Betagten gebildet hat,
die an gemeinsamem Spiel interessiert sind; es gibt aber zu denken,
dass dies der einzige Gruppenraum ist, welcher nicht gleichzeitig als
Durchgangskorridor für Personal oder Betagte zu irgendwelchen
Dienstleistungsbereichen dienen muss. Mit einem Gefühl der
Hemmung, in etwas Halbprivates einzudringen, begibt sich denn auch
der Heimbesucher und sogar ein Teil des Personals entsprechend selten
dorthin; die Personalisierung des Bereichs, speziell die bleibenden
Veränderungen, ist weitergehend als in den übrigen
Gruppenräumen. Wahrscheinlich liegen hier bedeutsame Bedingungen
für das Entstehen der geselligen Gruppenatmosphäre und
damit für die wenigstens minimale Nutzung des Raums.
Die Wohngruppe oder das Betagten-Management
Es wird zu Recht als eine Errungenschaft betrachtet, dass man von
den Schlafsälen oder Zimmerfluchten früherer Epochen zur
Idee der Wohngruppe von überschaubarer Grösse vorgestossen
ist. In der Tat ist ein "Gesetz der kleinen oder mittleren Zahl"
für viele psychosoziale Strukturen und Prozesse von
grösster Bedeutung. Man sollte sich aber nicht der Illusion
ergeben, in diesen "Gruppen" wären die Betagten eher in der
Lage, ihre persönliche Würde zu wahren und zugleich eine
intensivere soziale Integration zu verwirklichen. Wir können uns
anhand verschiedener anekdotischer Beobachtungen des Eindrucks nicht
erwehren, dass in den von uns besuchten -- durchwegs hervorragend
geführten -- Heimen der Umgang mit Idee und Realität der
"Gruppe" von weitgehend unanalysierten Annahmen ausgeht.
Vereinfachend gesagt scheint man anzunehmen, dass "Gruppe" immer
besser ist als Alleinsein, dass die grössere Gruppe besser ist
als die kleine, dass eine homogene Gruppe besser ist als eine
heterogene, dass eine lenkbare Grupe besser ist als eine
eigenständige u.dgl.m. So verständlich diese Annahmen aus
der Sicht der fürsorgerischen Aufgabenstellung erscheinen, so
sehr verdecken sie auch Widersprüche zwischen der baulich und
organisatorisch manifesten "Bevormundung" des Betagten und dem
expliziten Ziel, die Würde seiner Person zu achten, und das
heisst für uns u.a., seinen Regulationsansprüchen
bezüglich Integration und Autonomie gerecht zu werden.
Ess-Saal oder Gemeinschaftsraum?
Die im vorhergehenden Abschnitt angerissenen Fragen wurden erst im
Laufe unserer Untersuchungen erkennbar. Sie lassen sich beispielhaft
anhand einer Beobachtung in einem Pflegeheim erläutern. Wir
konnten dort zwei Stockwerke mit je ca. 24 pflegebedürftigen
Betagten vergleichen, die in Einer-, Zweier- und Viererzimmern leben.
Die beiden Stockwerke weisen mit einer Ausnahme den gleichen
Grundriss auf: im Stockwerk A gibt es einen gemeinsamen Aufenthalts-
und Essraum, im Stockwerk B an derselben Stelle zwei Patientenzimmer,
durch eine kleine Nische oder Diele mit dem Hauptkorridor verbunden.
Diese architektonische Differenz hat zur Folge, dass im Stockwerk A
alle Patienten täglich in den Ess-Saal gebracht, dort --
praktisch jeder für sich allein -- auf das Essen warten und nach
dem Essen wieder in ihre Zimmer zurückgebracht werden. Im
Stockwerk B hingegen mussten die Patienten -- zum Bedauern des
Pflegepersonals -- in ihren Zimmern essen; sie taten dies an kleinen
Tischen, allein, zu zweit oder zu viert. Die Bewohner im Stockwerk B
zeigten nun teilweise mehr spontane Kontakte untereinander als
diejenigen im Stockwerk A; in der kleinen Nische vor den beiden
zusätzlichen Zimmern hatte sich eine besonders intensive
Gemeinschaft der drei Bewohner ergeben, die über das Essen
hinaus bestand. Im ganzen machte uns das Stockwerk B den Eindruck von
relativ grösserer Selbständigkeit der Bewohner; im
Stockwerk A waren sie vermehrt auf Hilfe angewiesen. Wir betrachten
diese Unterschiede im psychosozialen Verhalten und Klima als eine
Sekundärfolge der architektonischen Unterschiede, welche teils
direkt, teils über den Umweg organisatorischer Momente
vergrösserte bzw. verkleinerte Regulations-Spielräume der
Aktivation und Interaktion mit sich bringen. Natürlich
können wir im konkreten Fall andere Faktoren nicht
ausschliessen. Immerhin wurden die Betagten nach dem Prinzip der
freiwerdenden Betten weitgehend zufällig zugeteilt; ob die
Haltung des Personals, insbesondere der über längere Zeit
die Abteilung bestimmenden leitenden Schwester, von aussen
mitgebracht oder ebenfalls durch die architektonischen Bedingungen
mitbestimmt worden ist, müssen wir offenlassen.
Top of
Page
Literatur
BALTES, Margret M.; BARON, E.M.; ORZECH, M.J. & LAGO, D.
(1983): Die Mikroökologie von Bewohnern und Personal: eine
Behavior-Mapping-Studie im Altenheim. Zeitschrift für
Gerontologie 16, 18-26.
BALTISBERGER, Ingrid (1984): Ältere Frauen in ihrem Quartier:
wie unterscheiden sich Gruss- und Hilfsverhalten älterer Frauen
in zwei unterschiedlich gebauten Quartieren voneinander?
Dipolomarbeit, Psychol. Inst. Univ. Bern.
BAUM, A. & VALINS, S. (1977): Architecture and social
behavior: psychological studies of social density. Hillsdale NJ,
Erlbaum.
BOESCH, Ernst E. (1980): Kultur und Handlung. Bern,
Huber.
BROADBENT, G.; BUNT, R. & LLORENS, T. (Eds. 1980): Meaning
and behaviour in the built environment. Chichester, Wiley.
BÜHLMANN, Kilian & LANG, Alfred (1984): Mir mache
Hüser -- was mache die Hüser mit üs? [Wir machen
Häuser -- was machen diese Häuser mit uns?] Videofilm
(12 Min.), Psychologisches Institut der Universität Bern.
BÜHLMANN, Kilian & OBERLI, Eric (1987): Das Altersheim
Aespliz - eine umweltpsychologische Architekturkritik. Diplomarbeit,
Psychol. Inst. Univ. Bern.
CARP, Frances M. (1987): Environment and aging. Pp. 329-360 in:
Stokols, D. & Altman, I. (Eds.): Handbook of environmental
psychology. Vol.I. New York, Wiley.
CSIKSZENTMIHALYI, M. & ROCHBERG-HALTON, E. (1981): The
meaning of things: domestic symbols and the self. New York,
Cambridge Univ. Press. (Dt. Übersetzung in Vorbereitung:
München, Psychologie-Verlags-Union.)
ECO, Umberto (1976): A theory of semiotics. Bloomington,
Indiana Univ.Press. (Dt.: Semiotik: Entwurf einer Theorie der
Zeichen. München, Fink, 1987.)
LANG, Alfred (1981): Vom Nachteil und Nutzen der
Gestaltpsychologie für eine Theorie der psychischen Entwicklung.
S. 154-173 in: Foppa, K. & Groner, R. (Eds.): Kognitive
Strukturen und Prozesse. Bern, Huber.
LANG, Alfred (1982 a): Die psychosoziale Bedeutung des Wohnens.
Kap. 22 in: Familienpolitik in der Schweiz. Bern, EDMZ,
62-72.
LANG, Alfred (1982 b): Besser wohnen - anders bauen.
Schweizerische Zeitschr.f. Gemeinnützigkeit 121 (4)
85-97.
LANG, Alfred (1985): Remarks and questions concerning ecological
boundaries in mentality and language. Pp. 107-114 in: SEILER H.J.
& BRETTSCHNEIDER G. (Eds.): Language invariants and mental
operations. Tübingen, Narr.
LANG, Alfred (1988 a, im Druck): Das Ökosystem Wohnen -
Familie und Wohnung. In: LÜSCHER, K. et al. (Eds.): Die
"postmoderne" Familie: familiale Strategien und Familienpolitik im
Übergang. Konstanz, Universitätsverlag.
LANG, Alfred (1988 b, im Druck): Die kopernikanische Wende steht
in der Psychologie noch aus! - Hinweise auf eine ökologische
Entwicklungspsychologie. Schweizerische Zeitschrift für
Psychologie 47 (2/3).
LANG, Alfred (1988 c, in Vorb.): The built as a regulator of
autonomy and integration: towards a theory of the dwelling activity.
Invited by Hiroshima Forum of Psychology.
LAWTON, M.P. (1980): Environment and aging. Monterey CA.,
Brooks & Cole.
RAPOPORT, Amos (1982): The meaning of the built environment - a
nonverbal communication approach. Beverly Hill, Sage.
SAUP, Winfried (1985): Zur Verbesserung der Wohnqualität in
Altenheimen; ein psychologischer Beitrag. Archiv für
Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 4, 264-277.
SAUP, Winfried (1986/7): Lack of autonomy in old-age homes: a
stress and coping study. Journal of Housing for the Eldery 4
(1) 21-36.
SEAMON, David & MUGERAUER, Robert (Eds. 1985): Dwelling,
place and environment: towards a phenomenology of person and
world. Dordrecht, Nijhoff, 1985.
STOKOLS, Daniel & ALTMAN, Irwin (Eds. 1987)): Handbook of
Environmental Psychology. 2 Vols. New York, Wiley.
UEXKÜLL, Thure von & KRISZAT, Georg (1934):
Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen.
Frankfurt, Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1983.
WELTER, Rudolf (1983): Ökologische Aspekte zur Frage der
Rehabilitationsmöglichkeiten in Pflegeheimen. Zeitschrift
für Gerontologie 16, 2-6.
Top of
Page
Legenden zu den Abbildungen:
Abbildung 1: Grundriss des Hauptgeschosses. Die dunkler
schraffierte Fläche ist "privater", die heller schraffierte
"halböffentlicher" und "öffentlicher" Bereich. Um je einen
Gruppenraum sind 7 Einzelzimmer angeordnet. Auf den bepflanzten
Innenhof geht der Blick von allen Seiten durch grosse Glasscheiben.
Die dem ganzen Heim gemeinsamen Räume sind um den Eingang von
der Strasse her zusammengefasst.
Abbildung 2: Zwei Beispiele von Zimmergrundrissen und
-möblierungen mit von uns eingetragenen hypothetischen
Zonierungen. Links Mittelzimmer Süd, rechts Standardzimmer West.
Erläuterungen im Text.
Top of
Page