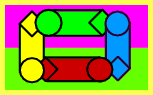Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 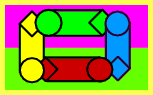 |
Edited Book Chapter 1978 |
Das Problem mit der Psychodiagnostik: Kein gutes Fundament für eine Profession! (Ein Nachwort) | 1978.03 @Ethic @SciPolPrinc @DiffPsy |
28 / 42KB Last revised 98.10.31 |
Pp. 414-426 in: Ist Psychodiagnostik verantwortbar? -Wissenschaftler und Praktiker diskutieren Anspruch, Möglichkeiten und Grenzen psychologischer Erfassungsmittel Herausgegeben von Urs Pulver, Alfred Lang & Fred W. Schmid. Verlag Hans Huber Bern Stuttgart Wien, 1978 | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Die nachstehenden Gedanken sind einmal mehr, wie das unser
Gegenstand wohl erzwingt, skizzenhaft. Ich muss auf die Behandlung
einer ganzen Reihe von Themen, die mich in der Zwischenzeit und bei
der zusammenhängenden Lektüre der vorliegenden Texte
beschäftigt haben, verzichten. Ich habe auch davon abgesehen,
verschiedene Missverständnisse, die in den Diskussionen zutage
getreten sind, zu kommentieren; der geneigte Leser wird anhand der
Texte dazu selber in der Lage sein. Was ich statt dessen versucht
habe, ist, mein Verständnis einiger grundsätzlicher Aspekte
des Problems mit der Psychodiagnostik noch einmal in einem gewissen
Zusammenhang darzulegen, so etwas wie einen roten Faden durch meine
Argumentation zu geben. Dass ich dies nach den Diskussionen der zwei
Tagungen hoffentlich besser kann als vorher, dafür danke ich
allen Teilnehmern, die so freundlich waren, auf den unerfreulichen
Dialog einzutreten.
Das Anregende, aber auch das Unbefriedigende dieses Bandes
über die Anwendbarkeit von Psychologie auf den konkreten
Menschen beruht wohl darauf, dass ein sehr weiter Bogen gespannt wird
von Methodenproblemen standardisierter Testdiagnostik bis hin zu
sozialen, politischen und ethischen Grundfragen unseres Daseins. Aus
naheliegenden Gründen besteht im allgemeinen die Tendenz, diese
Fragen als mehreren verschiedenen Disziplinen zugehörig zu
betrachten und daher sofern ihre rationale Behandlung erwünscht
ist voneinander getrennt zu bearbeiten. Versucht man dennoch ihre
umfassende Betrachtung, so ist man auf nicht-rationale Schlussweisen,
auf Analogiedenken und ähnliche Vorgehensweisen, um noch einmal
einen Ausdruck von Robert Musil aufzunehmen: auf ratioïdes
Denken verwiesen.
Nicht-Schlüssigkeit (bezogen natürlich auf rationale
Kriterien) ist solchem Denken seiner Natur gemäss einfach und
leicht nachzuweisen. Auch wenn in einigen der Beiträge aus
verständlicher Abwehrhaltung von diesem Gegenmittel Gebrauch
gemacht wird, so finde ich es doch in der Rückschau
bemerkenswert, dass so viele Angehörige einer Disziplin, welche
Wissenschaftlichkeit als Rechtfertigung für ihr Tun beansprucht,
in so weitgehendem Mass bereit sind, auch in fühlender
und ahnender Weise auf die aufgeworfenen Fragen einzugehen. Man mag
das abtun als unter dem Druck der Praxis gebildete, eigentlich
unerfreuliche Denkgewohnheiten; man mag auch altvertraute
Gegensätze. die unser Fach seit jeher belasten, dafür
verantwortlich erklären; es könnte aber auch sein, dass der
Rekurs auf solche Denkweisen dem Zeitgeist eminent verpflichtet ist,
vielleicht einem Erschrockensein über überbordende
Rationalität angesichts von reicherem Dasein entspringt. Es
scheint allen Teilnehmern klar zu sein, dass unsere
wissenschaftlich-rationalen Erkenntnisse und Methoden nur dann Sinn
machen, wenn wir sie mit Werten und Zielen konkreter Menschen in
Verbindung bringen. Zwar werde ich noch als Positivist
verdächtigt (S.43,143) offensichtlich zu unrecht (S.124); aber
alle Teilnehmer scheinen auch anzuerkennen, dass eine Chance für
die Gemeinschaft darin liegt, mit einem rationalen Vorgehen, so weit
das eben geht, einen gemeinsamen Boden zu erringen.
Wissenschaft und Praxis
Es mag Erstaunen hervorrufen, dass ich gewissermassen als ein
"Vertreter der Wissenschaft" zur Gwatter Tagung eingeladen S.97 die
Sprengung der Grenzen des Rationalen befürworte. Ich weigere
mich aber, die übliche Gegenüberstellung von Wissenschaft
und Praxis für sinnvoll zu halten. Das Verhältnis zwischen
Wissenschaft und Praxis sehe ich wie das von Teil und Ganzem.
Vertretbare Praxis in einer Welt von zusammenlebenden Menschen
muss wenigstens teilweise auf wissenschaftliche Verfahren und
Erkenntnis abstellen; vor allem aber betont Praxis das Setzen von
Werten. Auch Wissenschaft muss Werte setzen, in der Auswahl des
Gegenstandes, in der Bevorzugung bestimmter Theorien, in den
Konventionen über die tauglichen Methoden, in jedem Fall und
unvermeidlich!
Für das heikle Verhältnis zwischen Wissenschaft und
Praxis oder um die Dialektik zu betonen zwischen Sachverhalten und
Wertsetzungen gibt es vereinfachend gesehen drei grundsätzliche
Lösungsmöglichkeiten:
1) Die in unserer Kultur bisher vorwiegend praktizierte ist die "Monopolisierung" der Erkenntnis von den Sachverhalten. Wer mehr Wissen über die Sachverhalte besitzt, neigt dazu, auch mehr Kompetenz in Wertfragen für sich zu beanspruchen. Unsere Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten in einem erstaunlichen Ausmass bereit gewesen, diesen an sich unbegründeten B Anspruch zu akzeptieren. 2) Ein zweiter Weg ist die bevorzugte Lösung linker und rechter Minderheiten: es ist die "Monopolisierung" der Wertsetzung oder die Konzentration der Macht. Wer darüber bestimmt, welche Ziele wertvoll sind, der vermag in einem erstaunlichen Ausmass oft auch zu deklarieren, was die "Wahrheit" ist und was nicht. Wie viele Beispiele zeigen, ist die Wissenschaft anfälliger für Kniefälle als sie selber gern möchte. Das ,gilt verstärkt für Wissenschaft, die viel Geld kostet.
3) Die dritte Variante die einzige, die mir eine Lösung zu sein scheint ist die "liberale" oder pluralistische. Da wir Menschen nicht nur Gesellschaftswesen, sondern zugleich auch Individuen sind, müssen wir es wohl als ein Grundrecht ansehen, dass jeder seine eigenen Ziele setzen kann. Natürlich finden diese Zielsetzungen ihre Grenzen an den Zielsetzungen der Andern; die gesellschaftliche Ordnung dient genau dazu, allen möglichst weitgehend ihre Ziele zu gewähren. Dass wir die meisten Ziele gemeinsam haben, und dass sie gemeinsam besser realisierbar sind, finden die Meisten bald einmal heraus.
Für das Verhältnis zwischen Sachkenntnis und Wertsetzung
bedeutet die liberale Lösung, dass so weit wie immer
möglich jene Wissenschaft vorzuziehen ist, welche in dem Sinne
wertneutral ist, dass erst ihre Anwender darüber entscheiden,
auf welche Zielsetzung hin sie davon Gebrauch machen wollen.
Darin liegt aus meiner Sicht die einzige Garantie, dass eine
Wissenschaft wie die Psychologie auf eine menschenwürdige Weise
angewendet wird. Das ist dann der Fall, wenn die Erkenntnisse und
Verfahren der Psychologie prinzipiell jedem Menschen zur
Verfügung stehen anstatt einer ausgewählten Gruppe von
Fachleuten und denjenigen, die sich der Fachleute für ihre
Zwecke bedienen.
Das Problem mit der Psychodiagnostik
Bis vor wenigen Jahren galt die Psychodiagnostik als die
Hauptanwendung der Psychologie im praktischen Bereich diese Rolle
wird ihr jetzt von der Psychotherapie streitig gemacht. Meine
Einwände könnten ebensogut bezüglich der eingreifenden
Massnahmen vorgebracht werden; hier stehen aber die feststellenden
Tätigkeiten des Psychologen im Vordergrund. Ich möchte noch
einmal betonen, dass für mich Diagnose und Prognose,
Entscheidung und Massnahme nur Aspekte ein und derselben
psychagogischen Dienstleistung sind. So nützlich ihre getrennte
Betrachtung für didaktische Zwecke sein mag, im konkreten Fall
sind sie für den Betroffenen untrennbar ineinander verwoben. Ein
ausgewogenes Verhältnis mögen sie in guter psychologischer
Beratung bilden.
Am Beispiel der Psychodiagnostik versuche ich nun meine
Argumentation in ihren wesentlichen Zügen noch einmal
darzustellen.
1. Ich gehe von der Feststellung aus, dass die verschiedenen
verfügbaren Hilfsmittel der Diagnostik im Rahmen psychologischer
Dienstleistung zur angemessenen Beschreibung dessen, worauf es im
Sinne einer neutralen Aussenansicht der Entwicklung von Individuen
mutmasslich ankommt, nicht genügen. Das ist die Feststellung der
"Krise der Diagnostik": an sich eine chronische Krise, in den letzten
Jahren aber verdeutlicht durch die Wegwendung einer grossen Zahl
früherer Diagnostiker hin zu direkter therapeutischer
Intervention.
Diese These wurde kaum bestritten. Ein Kommentar ist aber
angezeigt bezüglich des Ausdrucks "neutrale
Aussenansicht". Auf dem Hintergrund des liberalen
Lösungsmodells der Wertfrage ist es zwingend, dass der
Diagnostiker die Bewertung der Feststellungen dem Auftraggeber
überlässt. Das ist ein anerkannter Grundsatz im Fall der
Auslese; im Fall der Beratung ist der mündige Klient der
Auftraggeber. Der Auftrag besteht in jedem Fall in der "Lieferung von
Material" ("Information"), sei es über den Probanden selbst, sei
es über weitere relevante Umstände, sei es in Rohform, sei
es mehr oder weniger weitgehend aufgearbeitet zur Vorbereitung der zu
treffenden Entscheidungen. Dieses "Material" nenne ich die
"Aussenansicht"; es mit der Innenansicht des Klienten, also seiner
erlebten Existenz, gleichzusetzen (S.197, 209), scheint nun mir
Begriffsverwirrung zu implizieren. Sicher kann diagnostisches
Material zur Differenzierung der Innenansicht beitragen; so gut, wie
es sie auch "verstellen" kann, dank des handlichen Angebots an
Jargon.
Auf die Feststellung des Ungenügens der diagnostischen
Hilfsmittel sind zweierlei Reaktionen möglich. Die bisher
vorwiegende von der antipathischen Attitüde des Typs:
"Psychisches sei grundsätzlich nicht messbar" abgesehen sind
Bemühungen zur Verbesserung der Methoden. Sehr verbreitete und
sehr intensive Bemühungen dieser Art haben nur einen sehr
partiellen Erfolg gebracht. Mir scheint deshalb, man müsste
einmal intensiver nach den Gründen dieses Misserfolgs suchen.
Zweitens könnte man dann auch nach dem Sinn der entsprechenden
Zielsetzung fragen.
2. Zur möglichen Begründung des Misserfolgs. Ich
behaupte, dass es in der Natur der Sache liegt, dass die
herkömmliche Psychodiagnostik nicht gut genug sein kann.
Zwischen den geläufigen Konzeptionen der Persönlichkeit,
auf denen die Diagnostik beruht, und einigen offensichtlichen, aber
weitgehend vernachlässigten Eigentümlichkeiten des
Individuums in der Welt besteht nämlich eine so starke
Diskrepanz, dass eine viel umfassendere Methodik des
Tatsachenfeststellens die übliche, auf konstante Personmerkmale
zentrierte Psychodiagnostik ersetzen müsste.
Ich sehe hauptsächlich drei solcher Eigentümlichkeiten,
von denen zwei in Referaten und Diskussionen der beiden Tagungen
verschiedentlich genannt worden sind, während die dritte
eigenartigerweise selten zur Sprache kommt. [1]
[1] Zwar hat Herr von Uslar in seinem Vortrag auf die Rolle der Situation, der objektiven und der wahrgenommen en, hingewiesen, er hat sich aber dann vor allem der diagnostischen Situation gewidmet.
Es sind dies:
a) das Problem der Individualität (auf dem Hintergrund nomothetischer Forschung über individuelle Differenzen, deren Aussagen allesamt populationsbezogen sind). b) das Problem der Entwicklung (angesichts von Methoden, die konstruiert sind, nur das Konstante zu erfassen). In diesem Zusammenhang möchte ich durchaus meine These, auf die Entwicklung des Individuums zu setzen (vgl. S.l26,137f.,206ff.) und Herrn Duponts Antithese von der konstanten Persönlichkeit (vgl. S.391) in die Synthese zusammenfliessen lassen, dass Stabilität und Wandel in angemessenem Verhältnis gelungenes Leben ausmachen.
c) das Problem des sogenannten Interaktionalismus, wie er etwa in Lewins (1963) berühmter Formel V = f (P,U)(Verhalten, Entwicklung , auch Persönlichkeit sei eine Funktion der psychologischen Person und der psychologischen Umwelt, vgl. auch Lang, im Druck) zum Ausdruck kommt. Dieses fundamentale Problem der Persönlichkeitspsychologie ist in den letzten Jahren sehr eingehend diskutiert worden (vgl. besonders Bowers, 1973; Endler & Magnusson, 1976; Magnusson & Endler, 1977). Man hat allerdings erst begonnen zu sehen, dass an der Wurzel dieses Problems die Vernachlässigung des ökologischen Aspekts der Psychologie liegt (vgl. Graumann, 1978). ZU einseitig hat man sich besonders in der Persönlichkeitsforschung und damit natürlich auch in der Diagnostik nur mit den Merkmalen und Verhaltensweisen der Person befasst und kaum eine systematische Methodologie entwickelt, die dem Umstand Rechnung trägt, dass keine Person anders als in einer Umwelt existieren kann, dass die Menschen diese Umwelt gestalten und beeinflussen; dass diese Umwelt auf die Menschen zurückwirkt.
Die traditionelle Psychodiagnostik missachtet meiner Meinung nach
diese drei Eigentümlichkeiten psychologischer Sachverhalte
weitgehend: die Testdiagnostik fast vollständig, die mehr
intuitive, mit projektiven Verfahren und Gespräch operierende im
günstigen Fall etwas weniger, allerdings für den Preis der
aufgegebenen Kontrollierbarkeit. Sicherlich wehren sich viele
Diskussionsteilnehmer in diesem Band mit Recht gegen meinen Vorwurf,
man missachte diese drei Probleme auch in der Praxis. Ich anerkenne
entsprechende Bemühungen durchaus; nur meine ich, dass ich so
früh den Boden der Rationalität nicht aufgeben
möchte.
Wieder so scheint es mir kann man auf diese Feststellungen mit
zweierlei Reaktionen antworten.
3. Die eine mögliche Reaktion: eine adäquatere
Psychologie anstreben; mit Approximationen zwar nie zufrieden sein,
sie aber dennoch einsetzen. Man kann einmal sagen: diese
Einwände mögen Prinzipiell richtig sein; aber Rom ist auch
nicht an einem Tag erbaut worden. Früher oder später werden
wir über eine adäquatere Psychologie verfügen, die
diesen drei Problemen gerecht wird. Früher oder später
werden wir die Persönlichkeitspsychologie in das Ganze der
Psychologie besser integriert haben, und wir werden einmal über
eine umfassende Tatsachendiagnostik verfügen, welche Person und
Umwelt und ihre Transaktionen, welche Entwicklung und
Individualität einschliesst. Inzwischen können wir
allerdings nicht warten; es warten Klienten auf unsere
Dienstleistungen, sie bedürfen unser dringend...
In diesem Zusammenhang möchte ich der Argumentation Herrn
Duponts in weiten Teilen zustimmen. Was er mit viel Feinsinn
schildert und was in vielen Einzelheiten auch in manchen anderen
Diskussionsbeiträgen, die meine Position zu relativieren
versuchten, zum Ausdruck kommt, sind in der Tat Möglichkeiten
des Vorgehens, die interessant, beachtenswert und verfolgenswert
erscheinen. Man kann das alles tun, um den verschiedenen
Einwänden Rechnung zu tragen. Vieles davon wird tatsächlich
und mit viel Einsatz getan, und es ist zweifellos respektabel. Ich
wiederhole, dass ich zu keiner Zeit die guten Intentionen der meisten
Diagnostiker und Berater in Zweifel gezogen habe.
Ich akzeptiere also diese erste Reaktion grundsätzlich; ich
finde sie sachlich angemessen und vernünftig. Weite Bereiche
meiner eigenen Forschungsund Lehrtätigkeit verstehe ich in eben
diesem Sinn. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass diese Haltung
einer Ergänzung bedarf. Mir ist mit den Jahren die
"Macher"-Attitüde ebenso suspekt geworden wie die
Anti-Erkenntnis-Emphase. Wenn etwas möglich erscheint, so
braucht es deswegen noch nicht gleich auch gut und erstrebenswert zu
sein.
4. Die andere mögliche Reaktion: Infragestellung einiger
Zielsetzungen. Ich möchte also auch die Frage nach dem Sinn
solchen Diagnostizierens stellen und diskutieren. Und da muss ich
gestehen, dass ich beim Wiederlesen der Texte dieser beiden Tagungen
keine Stelle gefunden habe und es ist mir auch aus der weiteren
Literatur keine bekannt -, wo mit einem besseren Argument für
Diagnostik plädiert wird als mit der Beteuerung: die
Entscheidungen müssten auch ohne Diagnostik getroffen werden;
mit Diagnostik seien sie zumindest nicht schlechter, vielleicht aber
in vielen Fällen etwas besser. (Nur für einige sehr
spezielle Selektionsverfahren gibt es bisher
Kosten-Nutzen-Analysen.)
Gegen Behauptungen dieser Generalität kann man schwer
argumentieren, umso mehr als es sich eigentlich um eine empirische
Frage handelte, falls man in der Lage wäre, sinnvolle Kriterien
für das "Besser-oder-Schlechter" anzugeben. Wie schwierig diese
Frage in Wirklichkeit ist, kann man nach knapp zwei Jahrzehnten
ernsthafter Psychotherapie-Erfolgsforschung vielleicht ein wenig
ahnen. (Ich empfehle beispielsweise die Lektüre des
angekündigten Buches von Glass et al.; vgl. Smith & Glass,
1977, und aber auch Gallo, 1978.) Die Bewertung von
Beratungs-Effekten dürfte nach meinem Empfinden noch um ein
Vielfaches schwieriger sein.
Auf dem Hintergrund der oben skizzierten liberalen Lösung des
Theorie-Praxis-Problems ist es jedoch unangemessen, die Frage nach
dem Sinn so allgemein zu stellen. Denn es sind natürlich
verschiedene Anwendungsweisen der Diagnostik zu unterscheiden.
Ich bedaure sehr, dass ich in den verschiedenen Diskussionen nicht
auf einer differenzierteren Sicht der Dinge beharrt und gelegentlich
sogar zur Verwischung der Begriffe beigetragen habe; ich hatte den
Eindruck, dass man sich nicht SO wenig wie übrigens die
einschlägige Literatur auf eine alles umfassende Einteilung
einigen könnte, da jeder Teilnehmer begreiflicherweise dazu
neigte, die Dinge vor allem aus seiner Sicht zu sehen. Ueber der
Diskussion der Autonomie-Problematik kam der mögliche Nutzen der
in meinem Berner Vortrag vorgeschlagenen Einteilung gar nicht zur
Sprache. Es blieb bei den ad hoc Gegenüberstellungen von
"objektiv vs. subjektiv", "Selektion vs. Beratung", Aussenansicht vs.
Innenansicht" usw. Keine dieser Polaritäten kann wirklich
befriedigen; ich füge eine weitere bei, um meine Argumentation
in plakativer Thesenform weiterführen zu können: Diagnostik
über vs. Diagnostik für das Individuum.[2]
[2] Diese Gegenüberstellung erinnert an Schallbergers (S.82ff.) Formulierung vom "interindividuellen Vergleichen" vs. der Erfassung der "intraindividuellen Organisation"; sie ist aber damit nicht identisch, weil auch interindividuelle Vergleichsbefunde für das Individuum bedeutungsvoll sein können.
5. Wird Diagnostik über Individuen gemacht in dem
Sinne, dass eine Institution auf Grund von einigen ausgewählten
Merkmalen der Person Selektions- oder Klassifikationsentscheidungen
trifft, so ist gegen die Anwendung partieller Persondiagnostik wenig
einzuwenden sofern allerdings die entscheidende Institution nicht
über eine umfassende Machtposition verfügt. Ich wehre mich
dementsprechend dagegen, dass z.B. der Staat und seine Institutionen
psychodiagnostisch unterstützte Entscheidungen treffen,
betrachte es R aber als ein gutes Recht von untereinander in echter
Konkurrenz stehenden Institutionen aller Art, dass sie mit Hilfe von
Wahrscheinlichkeitsentscheidungen beispielsweise Besten- oder
Schlechtesten-Auslese von Anwärtern oder Personal usw.
betreiben. Niemand muss sich diesen Verfahren unterziehen, es sei
denn, der damit verbundene Nutzen ist es ihm wert.
6. Etwas anderes sind Feststellungen für das
Individuum, d.h. Beiträge zur Bereicherung seiner
Innenansicht. Wie ich im Berner Vortrag dargelegt habe, scheint es
mir wesentlich auf die Art des Kontraktes zwischen Klient und Berater
anzukommen, ob man dem Klienten diese partiellen Erkenntnisse
über seine Person, die man mit der herkömmlichen Diagnostik
gewinnen kann, zumuten darf. Die Gefahr, dass dieser sie trotz bester
gegenteiliger Intention des Beraters für mehr als eine partielle
und ungenaue und mit Irrtumsmöglichkeiten gespickte
Aussenansicht nimmt, scheint mir beträchtlich. Immer dann, wenn
der Klient schlecht oder überhaupt nicht imstande ist, zwischen
den beiden Paradigmen (über vs. für Individuen) zu
unterscheiden man denke besonders an Kinder: und also dazu neigt, den
Berater mit einer Instanz zu verwechseln, sollte der beratende
Diagnostiker alarmiert sein.
Ich weiss, dass der gewissenhafte Berater diese Problematik sieht
und Einiges tut, um ihr zu begegnen, sei es in der Art der Kontrakte,
die er abschliesst, sei es durch Aufklärung des Klienten. Er
kann auf die Fehlerbehaftetheit aller Feststellungen hinweisen. Er
wird auch die Partialität der Feststellungen betonen und die
härteren Daten explizit durch weichere Impressionen
ergänzen. Als guter Berater wird er auch seine Rolle als blosser
Förderer einer eigenen Innenansicht des Klienten herausstellen,
und so weiter. Ich halte das alles für sehr erfreulich, kann
mich aber des Eindrucks nicht erwehren, dass der Berater bei der Wahl
solcher Massnahmen leicht selber in Schwierigkeiten gerät: er
kann seine Leistungen nicht in beliebigem Ausmass relativieren --
auch im Interesse des Klienten nicht -- und zugleich erwarten, dass
sie von seiner Klientele gebührend geschätzt wird. Unter
diesen Umständen ist der Berater ständig auf einer
Gratwanderung; natürlicherweise wird er dazu tendieren, die
Rolle des Diagnostikers über das Individuum
anzunehmen.
Dennoch bin ich der Meinung -- und man gestatte mir die Bemerkung,
dass ich zu keinem Zeitpunkt eine weitergehende Meinung
geäussert habe --, dass im Rahmen der Beratung auch
Psychodiagnostik für das Individuum manchmal wertvoll ist
und unter Beachtung aller erdenklichen Sorgfalt und Vorsicht
eingesetzt werden kann. Es scheint mir jedoch angesichts der
geschilderten Schwierigkeiten, man sollte diese Anwendung auf die
Nothelferfunktion begrenzen.
Damit weitet sich die Perspektive. Psychodiagnostik ist bloss das
besondere Beispiel, anhand dessen eine allgemeinere Problematik
diskutiert werden kann. Ich komme damit zu meiner zentralen
These:
Vorsicht mit der Professionalisierung der psychologischen
Beratung!
Ich frage mich also, ob es wünschbar ist, die Verbesserung
der Innenansichten von Menschen einer speziellen Profession von
Fachleuten anheimzustellen. Leider ist hier nicht der Platz, dieser
Frage ausführlich nachzugehen, noch was ich viel lieber
täte über konstruktive Alternativen nachzudenken.
Man wird mir entgegenhalten, in meiner privilegierten Position sei
ich nicht legitimiert, so zu argumentieren. Hierzu muss ich zu
bedenken geben, dass wohl privilegierte Positionen wie die meine
ursprünglich heutige Praxis könnte das häufig
vergessen lassen unter anderem zu dem Zweck eingerichtet wurden,
Gesichtspunkte jenseits von Interessenvertretung geltend zu
machen.
Der erste Teil meines Gleichnisses vom "In-der-Suppe-Rühren"
wurde durchaus meiner Intention entsprechend recht positiv
aufgenommen. Nachdenklich stimmt mich, dass kein Diskussionsredner
den zweiten Teil, um dessentwillen das Sprichwort eigentlich
bemüht worden ist, der Erwähnung wert gehalten hat:
nämlich, dass ein anderer als der Berater in der Regel die Suppe
auslöffelt...
Ich glaube, dass das Zusammenleben von Menschen ganz wesentlich
vom gegenseitigen Übernehmen von Verantwortung
füreinander getragen wird. Mich schreckt das Wachstum der
anonymen Institutionen, von Recht und Regeln in unserer Gesellschaft.
Ganz besonders starke Bedenken habe ich dagegen, den professionellen
Berater, d.h. ein gesellschaftliches "Institut", in die Entwicklung
der Persönlichkeit einzubeziehen. Wie man seit einiger Zeit
immer deutlicher sieht, sind auch ältere und etabliertere
Professionen hoch überfordert, wenn sie die Verantwortung
"für das Leben" ihrer eigentlich autonomen "Klienten" Menschen,
Nationen, Kulturen übernehmen sollten. Mir scheint, die Frage
der Verantwortung müsste von den Psychologen eingehend
diskutiert werden, und nicht nur am Beispiel der Diagnostik.
Mithin stimme ich der These zu (vgl. S.56 und 74f.) die Krise
der Diagnostik sei eigentlich eine Krise der Diagnostiker, sofern
dies heissen soll, dass hier eine Profession in einer Existenzkrise
oder richtiger wohl: in einer Geburtskrise steckt. (Die These war
natürlich von ihren Urhebern viel "psychologischer" gemeint.)
Das Instrumentarium, "die" Diagnostik, ist für gewisse Zwecke
schon recht; man hat es aber für viel weitergehende Ziele
einsetzen und zudem darauf die Existenz einer Profession
begründen wollen. Das wurde eine unbefriedigende Existenz, und
Viele sind ausgebrochen und aufgebrochen, sich ein neues
Tätigkeitsfeld zu erobern (um die gleiche Erfahrung noch einmal
zu machen?!). Ich glaube, es sind die Schwierigkeiten beim Versuch
der Etablierung einer Profession, die den Inhalt des vorliegenden
Buches ausmachen. Meine These ist, dass sich Psychodiagnostik und
psychodiagnostisch unterstützte Beratung schlecht dazu
eignen.
Zur Ausbildung
Wenn die Krise der Diagnostik eine solche Krise der
Diagnostiker ist, dann kann sie natürlich nicht durch eine
Veränderung oder Verbesserung der Ausbildung in Psychodiagnostik
überwunden werden. Eine naheliegende Aktion, aber der
grösste Fehler, den wir in dieser Situation begehen
könnten, wäre meiner Ansicht nach, die psychodiagnostische
Ausbildung noch weitergehend, als dies heute schon der Fall ist, von
der allgemeinen psychologischen Ausbildung abzutrennen und ihr
Eigenleben zu fördern. Und dasselbe gilt natürlich für
die beraterische oder die psychotherapeutische Ausbildung. Die Krise
wurde vielleicht dadurch erst möglich, dass die Diagnostik in
vielen Instituten tatsächlich ein Eigenleben geführt hat
und immer noch führt.
Auch derjenige Psychologe, der als Berater tätig sein will,
soll sich so viel wie nur möglich "Psychologie" schlechthin
aneignen: Allgemeine Psychologie, Entwicklungspsychologie,
Sozialpsychologie und auch Persönlichkeits- und
Differentialpsychologie. Gewiss soll jeder auch Verfahren des
Tatsachenfeststellens verstehen und "handhaben" lernen; aber die
personbezogenen Verfahren der traditionellen Psychodiagnostik sollten
vermehrt noch in die allgemeine Methodologie integriert werden (beide
Seiten könnten übrigens davon gewinnen, vgl. Cronbach, 1957
und 1975). Man sollte das Psychologiestudium verstehen als eine
Auseinandersetzung mit einer lebendigen Wissenschaft auf dem
Hintergrund einer lebendigen Praxis. Aber auch das beste
Psychologiestudium kann niemals die ganze Vorbereitung für eine
psychologisch fundierte Tätigkeit abgeben.
Wenn "Validierung des Diagnostikers" heissen soll, dass ein
Psychologe mit gründlichen Grundlagenkenntnissen unter Anleitung
von Praktikern und Wissenschaftlern in eine berufliche Tätigkeit
wie das psychagogische Beraten eingeübt wird, dann kann ich
dieser Formel zustimmen. Die intensive Auseinandersetzung auch mit
konkreten Menschen in ihren Lebenssituationen muss unter
Rückbezug auf das allgemeine Wissen und die Methodenkritik einen
wesentlichen Teil schon des Psychologiestudiums und mehr noch
der anschliessenden Berufseinmündung (Aufbaustudium) ausmachen.
Und natürlich muss dieser kontrollierte Vorgang der
"Brauchbarer-Machung" (wenn ich die aktive Begriffskomponente des
Ausdrucks "Validierung" so übersetzen darf) während der
ganzen Berufslaufbahn fortgesetzt werden.
Wenn aber "Validierung des Diagnostikers" die
Überprüfung seiner "Güte" und das Etikettieren der
akzeptablen Exemplare mit einer entsprechenden Marke heissen sollte,
dann müsste ich angesichts der nicht belegbaren "Brauchbarkeit"
solcher Marken mein Veto einlegen. Die psychologischen
Universitätsinstitute sind keine Berufsschulen sie können
und sollen es nicht werden, solange psychologische Tätigkeiten
so grundsätzlichen Schwierigkeiten begegnen, wie sie in diesem
Buch diskutiert worden sind.
Top of
Page