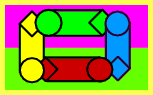Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 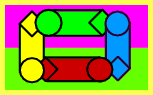 |
Edited Book Chapter 1978 (Orig. 1975) |
Diagnostik und Autonomie der Person | 1978.01 @Ethic @SciPolPrinc@DiffPsy |
27 / 42KB Last revised 98.10.31 |
Pp. 17-29 in: Ist Psychodiagnostik verantwortbar? -Wissenschaftler und Praktiker diskutieren Anspruch, Möglichkeiten und Grenzen psychologischer Erfassungsmittel Herausgegeben von Urs Pulver, Alfred Lang & Fred W. Schmid. Verlag Hans Huber Bern Stuttgart Wien, 1978 | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
[Vortrag gehalten an der Jahresversammlung der Schweizerischen
Gesellschaft für Psychologie in Bern am 12. April 1975 und
abgedruck in Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und
ihre Anwendungen 34 (3) 221-232, sowie, leicht überarbeitet
unter dem Titel: Psychodiagnostik als ethisches Dilemma, pp.
190-202 in: Johannes K. Triebe & Eberhard Ulich (Eds. 1977)
Beiträge zur Eignungsdiagnostik. Bern, Huber.]
Man kann von einer Krise der Diagnostik sprechen, weil eine ganze
Reihe von Problemen, zum Teil seit Jahrzehnten, ungelöst sind;
die Krise ist also eigentlich chronisch, aber durch gewisse
sozio-kulturelle Bedingungen unserer Zeit akzentuiert.
Man hat im allgemeinen diese Probleme der Diagnostik als
Methodenprobleme verstanden und eine unglaublich grosse Menge
Aufwand und Einsatz für Methodenentwicklungen und Testtheorie
mobilisiert. In der Tat sind Methodenprobleme im Prinzip immer
lösbar. Von methodologischen Schwierigkeiten will ich aber heute
nicht sprechen.
Denn es gibt auch Probleme substantiellerNatur,
d.h. Schwierigkeiten, die im Wesen des diagnostischen Ansatzes
liegen, und deren Überwindung also möglicherweise eine
fundamentale Neuorientierung erheischt.
Ich denke etwa daran, dass die Diagnostik, die wir seit 70 Jahren
pflegen, doch eigentlich die am besten gesicherte Erkenntnis der
modernen Psychologie verleugnet, nämlich dass Handeln stets auf
inneren und äusseren Bedingungen beruht. Mit ganz wenigen
Ausnahmen tut die Diagnostik -- Theorie und Praxis: -- so, wie wenn
die Kenntnis der inneren Bedingungen genüge.
Oder ich denke daran, dass die Diagnostik, die wir pflegen, dem
Phänomen der Entwicklung nur mit äusserst primitiven
Mitteln (z.B. mit dem IQ-Konzept oder mit altersbezogenen
Normentafeln) gerecht zu werden versucht und es häufig
weitgehend missachtet (z.B. bei vielen Diagnosen im Rahmen klinischer
Nosologien).
Für solche substantielle Probleme gibt es Lösungen
sicher nur in recht ferner Zukunft. Denn sie setzen voraus, dass wir
über eine psychologische Oekologie und über eine wirkliche
Entwicklungspsychologie verfügen. Ich glaube, die Diagnostik ist
in grandioser Verkenntnis der Realität vorgeprellt und hat die
Welt glauben gemacht, sie könne Aufgaben übernehmen,
für die sie nicht gerüstet ist.
Auf dem Hintergrund solcher Einsichten ist es zu begrüssen,
dass sich das Bewusstsein einer Krise ausbreitet. Wenigstens so
lange, als sich die Diagnostik nicht vom Ganzen der Psychologie
loslöst, besteht Hoffnung, dass sie ihre übersteigerten
Ansprüche reduziert. Diagnostiker könnten, statt immer
wieder neue Tests nach dem alten Schema zu fordern, vermehrt
versuchen, sich an den entsprechenden Entwicklungen der
Grundlagenforschung zu orientieren und diese dann auch im Binblick
auf ihre praktischen Bedürfnisse zu beeinflussen. Allerdings ist
nicht zu übersehen, dass sich in vielen Ländern eine
psychologisch-diagnostische Praxis ziemlich fest etabliert hat, die
in der Regel ziemlich . unbekümmert um die genannten
Schwierigkeiten weiterhin naive öffentliche Erwartungen
nährt und fördert.
Tatsächlich zeigt eine Umfrage unter den in der Schweiz im
Personenregister der Testkommission angeführten 830 Psychologen
ein recht konservatives Bild der Testpraxis.[1] Geantwortet
haben 237 Diagnostiker oder rund 30% der Schweizer Psychologen. Die
Antwortenden sind freilich nicht repräsentativ für
die Schweizer Psychologen; zu weitgehende Schlussfolgerungen
müssen daher vermieden werden. Diese Diagnostiker testen
immerhin nach ihren Angaben pro Monat zwischen einem und 500
Probanden, im Median 13,5 Probanden oder beinahe einen Probanden
jeden Tag [2]. Für die Durchführung und Auswertung
psychologischer Tests verwenden sie 27,5% ihrer Arbeitszeit; und rund
drei Viertel finden dies angemessen; nur 12% meinen, das sei zuviel.
Den Testresultaten messen die Antwortenden im Median ein Gewicht von
rund 25% beim Zustandekommen der Diagnose bei; wichtiger ist ihnen
allerdings noch das persönliche Gespräch mit 30%,
während auf die Lebensgeschichte des Probanden sowie auf die
Ueberlegungen und Erfahrungen des Psychologen je rund 20% fallen
[3]. Die Diagnostiker beurteilen die Zukunft ihrer
Tätigkeit recht zuversichtlich: fast zwei Drittel meinen, die
Testdiagnostik werde in Zukunft ein ungefähr ähnliches
Ansehen bewahren; ungefähr ein Achtel erwartet sogar eine
Ausweitung ihrer Bedeutung. Während im allgemeinen kaum
Unterschiede zwischen den Antworten aus der deutschen und der
französischen Schweiz festgestellt werden, ist man in dieser
Hinsicht in der Romandie doch etwas weniger optimistisch.
Fussnoten
Wenn ich dann noch die Liste der meistverwendeten Teste anschaue,
dann muss ich gestehen, dass mich dieses Bild der Testpraxis mit
einiger Sorge erfüllt.[4] Hat sich diese Form der
Anwendung von Psychologie, die unter Laien nicht selten als ihre
Hauptanwendung gilt, schon so weit von der sie fundierenden
Wissenschaft losgelöst, dass sie Erkenntnisse und Kritik dieser
Wissenschaft kaum noch berücksichtigt? Haben wir eine solche
Trennung der Wissenschaft und ihrer Anwendung einfach resignierend
hinzunehmen? Soll psychologische Dienstleistung, die sich der
Diagnostik bedient, eine Art "Kunsthandwerk" sein, gegründet auf
Praxis und Autoritäten? Oder erfordert solche Beschäftigung
mit dem Menschen die Fundierung in einer Wissenschaft vom
Menschen?
Solche Ueberlegungen veranlassen mich, hier auf einen dritten
Problemkreis näher einzugehen, der zwar auch substantielle und
methodische Schwierigkeiten betrifft, in erster Linie aber in die
Frage mündet, ob und wie Diagnostik betrieben werden soll: also
den ethischen Aspekt betrifft. Im Unterschied zu den
methodischen und den substantiellen Aspekten sind hier Lösungen
nicht von einer rascheren oder langsameren Weiterentwicklung der
Psychologie zu erwarten, sondern diese Probleme können jederzeit
diskutiert werden. Lösungen bringen hier entweder einen Wandel
des vorherrschenden Menschenbildes in unserer Kultur oder aber eine
Selbstbeschränkung der Diagnostik. Sozio-kulturelle
Veränderungen betreffen in erster Linie Wertsetzungen; mit
Wissenschaft können Lösungen sozialer Probleme zwar
vorbereitet, nicht aber getroffen werden. Ich bringe also meine
Gedanken zur Krise der Diagnostik nicht als Wissenschaftler vor,
sondern als ein informiertes Mitglied unserer Gesellschaft, das sich
fragt, ob diese Art der Anwendung von Psychologie zur Lösung von
Problemen wirklich beiträgt.
Lassen Sie mich meine Kritik in die folgende These zusammenfassen:
Professionell betriebene psychologische Diagnostik und Autonomie
der Person sind antagonistisch.
Diese These möchte ich zunächst als eine wertfreie
Feststellung eines Sachverhalts verstanden wissen. Sobald man
allerdinge konkrete Vorstellungen über die Autonomie der Person
entwickelt und einen hohen Grad an Autonomie für wertvoll
erachtet, so stellt sich die Frage nach der Bewertung der Diagnostik.
Lassen Sie mich im Folgenden zunächst also von solchen Wertungen
abstrahieren. Darauf ist am Schluss zurückzukommen. Vielmehr
möchte ich versuchen, meine These zu differenzieren und damit
natürlich auch zu relativieren. Gilt die Feststellung für
jede Art Diagnostik, oder kann man verschiedene Arten von Diagnostik
unterscheiden, für die der Widerspruch zur Autonomie der Person
unterschiedlicher Natur oder Stärke ist?
Zur Beantwortung muss ich zunächst mein Verständnis von
psychologischer Diagnostik darstellen.
Der Ausdruck Diagnostik bezeichnet eine Hauptmethode der
angewandten Differentialpsychologie. Der Ansatz der psychologischen
Diagnostik ist in Analogie zur medizinischen Diagnostik entstanden;
der Begriff wurde daher wohl immer etwas enger gefasst als von den
Erfordernissen angewandter Psychologie her nötig wäre. Denn
allgemein heisst Diagnostik zunächst einfach: Feststellen eines
Sachverhaltes; nicht notwendig eines Sachverhaltes über
Personen. Ferner ist Diagnostik natürlich nicht Selbstzweck,
sondern man diagnostiziert stets im Hinblick auf etwas, insofern man
je nach dem festgestellten Sachverhalt unterschiedlich mit diesem
Sachverhalt umgehen wird. Psychologische Diagnostik bereitet
Entscheidungen über Interventionen, Massnahmen, Beratungen,
Therapie usf. vor.
Ich würde also etwa definieren: Als angewandte
Differentialpsychologie meint Diagnostik das geregelte Sammeln von
Daten über Individuen derart, dass Entscheidungen
gerechtfertigt sind, welche den Lebenslauf, die Entwicklung
dieser Individuen, in intendierter Art beeinflussen.
In dieser Definition stecken wenigstens vier Fragen, auf die ich
nun näher eingehen will:
1. Wer intendiert die Beeinflussung des Lebenslaufs7 2. Welche Art Daten werden gesammelt?
3. Wie werden die Entscheidungen gerechtfertigt?
4. Wer trifft die Entscheidungen?
Im Bewusstsein schrecklicher Vereinfachung versuche ich, jede
dieser Fragen mit zwei oder drei idealtypischen Antworten zu
versehen. Ich weiss, dass der konkrete Fall nie ausschliesslich im
einen oder im andern Typus untergebracht werden kann;
nichtsdestoweniger scheinen mir die Unterscheidungen geeignet,
gewisse grundlegende Paradigmata von Diagnostik herauszuarbeiten,
welche unterschiedliche ethische Implikationen haben.
1. Wer intendiert die Beeinflussung des Lebenslaufs?
In Frage kommen der Proband selbst, der Diagnostiker oder ein
Dritter als Auftraggeber. In jedem Fall wird zwischen Proband und
Diagnostiker eine Art Kontrakt geschlossen, in den meisten
Fällen mehr implizit als explizit. Den Probanden interessiert
dabei wenig, in welch heiklem Verhältnis manchmal Auftraggeber
und Diagnostiker zueinander stehen. Für den Probanden ist
vielmehr entscheidend, ob er den Kontrakt mit dem Diagnostiker frei
von sich aus eingeht, oder ob ihm ein solcher Kontrakt von aussen
aufgezwungen wird. Es gibt völlig freie Kontrakte: der
Proband sucht den Berater auf und unterzieht sich dem von diesem
vorgeschlagenen diagnostischen Verfahren. Es gibt aber auch
völlig aufgezwungene Kontrakte. Legalistisch gesehen
mögen sie nicht allzu häufig sein (z.B. gerichtlich
angeordnete Begutachtung); im Erleben des Probanden sind sie aber
wohl nicht so selten, sei es in der klinisch-psychologischen
Diagnostik, in erziehungsberaterischen Abklärungen oder in
schulischen und betrieblichen Selektionsfragen. Immerhin dürfte
es angezeigt sein, eine dritte Kontraktform zu unterscheiden, den
bedingt freien Kontrakt, bei welchem der Proband freiwillig
ein bestimmtes Ziel anstrebt, zu dessen Erreichung er aber
gezwungenermassen die Bedingung einer diagnostischen Abklärung
eingehen muss.
2. Welche Art Daten werden gesammelt?
Selbstverständlich entscheidet der Diagnostiker auf Grund der
Fragestellung des Kontrakts darüber, was für Daten er
über den Probanden braucht und wie er sie erhebt. Es scheint mir
aber für das Verhältnis zwischen Proband und Diagnostiker
von entscheidender Bedeutung, ob der Diagnostiker seine Daten ad
hoc, d.h. aus seiner persönlichen Perspektive, sammelt, oder
ob der Diagnostiker seine Daten über den Probanden zu
rechtfertigen versucht, indem er Methoden verwendet, deren Ergebnisse
von seiner Person unabhängig sind. Also entweder Daten über
den Probanden, die dieser Diagnostiker allein durch seine Person
rechtfertigt, oder Daten, die objektiv, d.h. soweit reliabel
sind, als irgendein anderer Diagnostiker sie auch erheben
könnte.
Pulver (Kap.3) plädiert für Sowohl-als-Auch, und, wenn
ich ihn richtig verstehe, für eine nicht wieder auflösbare
Vermengung der beiden Arten von Daten. Ohne zunächst dafür
oder dagegen Stellung nehmen zu wollen, möchte ich zu bedenken
geben, dass nach Vermengung die Gesamtdaten nur den Charakter von ad
hoc-Daten haben und mithin nur Schlüsse zulassen, die dieser
Diagnostiker allein durch seine Person rechtfertigen kann.
3. Wie werden die Entscheidungen gerechtfertigt?
In der Praxis sind oft Daten und Entscheidungen nicht sauber zu
trennen; manchmal werden auch mehrere zyklische Phasen des
Datensammelns und des Entscheidens durchlaufen (vgl. etwa Kaminski,
1970), was die Situation kompliziert. Aber zumindest begrifflich,
vielleicht besser auch praktisch, ist die Unterscheidung wichtig,
weil auf Grund derselben Daten verschiedenartige Entscheidungen oder
dieselben Entscheidungen auf unterschiedliche Weise oder durch
unterschiedliche Entscheidungsträger getroffen werden
können. Beispielsweise kann ein knappes Schulreifetestresultat
verbunden mit der Feststellung einer eher schwächlichen
Konstitution und verhältnismassig günstigen familiären
Verhältnissen zu durchaus unterschiedlichen
Einschulungsentscheiden führen: bei den Eltern, bei der
Kindergärtnerin, beim Schulpsychologen, bei verschiedenen
Schulpsychologen oder sogar beim selben Schulpsychologien, der im
Rahmen unterschiedlicher Tendenzen zweier Beratungsstellen arbeitet.
Aehnlich wie die Daten können auch die Entscheidungen nach dem
Grad der intersubjektiven Invarianz, mit der sie aus den Daten
hervorgehen, charakterisiert werden. Entweder sind die Entscheidungen
in den Daten als solchen enthalten und müssen nur unter Beizug
allgemeiner oder differentieller psychologischer
Gesetzmässigkeiten (z.B. in der Form von
Validitätsgleichungen) expliziert werden: man spricht dann von
aktuarischen Entscheidungen. Oder jemand muss die Daten
zusammen mit seinen persönlichen Erfahrungen in einem
intuitiv-klinischen Verfahren verarbeiten und so zu einer hier
und jetzt einmaligen Entscheidung kommen.
4. Wer trifft die Entscheidungen?
In Frage kommen der Proband selbst, der Diagnostiker, ein Dritter
oder ein automatisches Verfahren. Wieder ist es für den
Probanden von geringer Bedeutung, ob der Andere, der über ihn
entscheidet, der Diagnostiker selbst oder eine Drittperson ist.
Man kann also drei Antworten geben:
a) Der Proband bleibt autonom: es wird ihm vom Diagnostiker Information vorgelegt, die gesammelten Daten in ursprünglicher oder in verarbeiteter Form zusammen mit weiterem relevanten Material wie Bezugsnormen oder Erfahrungen anderer Personen; aber der Proband selber ist es, der daraus die Schlussfolgerungen zieht. b) Bei heteronomer Entscheidung ist zu unterscheiden zwischen einem institutionalisierten und einem personalisierten Verfahren. Im heteronom-institutionellen Fall geht die Entscheidung aus den Daten und dem beigezogenen Bezugsmaterial automatisch hervor, wenn ein im voraus festgelegtes Entscheidungsverfahren durchgespielt wird. Beispielsweise sind Schulnoten Daten; der Schiiler wird nicht promoviert, wenn sein nach Vorschrift gewichteter Durchschnitt nicht 4,0 erreicht. Eine multiple Regressionsgleichung aus mehreren Testprädiktoren auf ein Selektionskriterium bringt ebenfalls heteronom-institutionelle Entscheidungen hervor.
c) Weitaus die meisten Institutionen delegieren jedoch die Aufgabe des Entscheidens an Personen, die angesichts eines Datenmaterials, sei es ad hoc oder objektiv oder gemischt, in einem intuitiven oder quasi-aktuarischen Prozedere die Entscheidung treffen.
Die vier Fragen und ihre 10 Antworten sind natürlich nicht
unabhängig voneinander. Es ergeben sich prinzipiell 36
Paradigmata von Diagnostik; aber etwa die Hälfte davon
sind sinnlos, weil beispielsweise intuitives Vorgehen in
heteronom-institutionellen Entscheiden unmöglich oder
aktuarisches Vorgehen bei ad hoc-Daten unsinnig sind (vgl. Tabelle
1). Dennoch wird gerade Letzteres recht häufig praktiziert, etwa
bei Selektion auf Grund von Schulnoten.
Tab. 1: Übersicht über die 36 Paradigmata der
Diagnostik (vgl. Text)
VD = Validitätsdilemma, MD = Machtdilemma
Kontrakt | Entscheidungsträger | Datensammlung |
|---|
ad hoc | "objektiv" |
|---|
Entscheidungsweise | Entscheidungsweise |
|---|
intuitiv | aktuarisch | intuitiv | aktuarisch |
|---|
frei | autonom | Ideal pers. Ber. | -- | fundierte Beratung | VD |
|---|
heteronom-persönl. | Vertrauens-Verhältnis | -- | VD | VD |
|---|
heteronom-institut. | -- | -- | -- | -- |
|---|
bedingt frei | autonom | Machtgefälle | -- | VD+MD | VD |
|---|
heteronom-persönl. | Machtgefälle | (Selektions-Praxis) | VD+MD | VD |
|---|
heteronom-institut. | -- | -- | -- | VD verschärft |
|---|
aufgezwungen | autonom | -- | -- | -- | -- |
|---|
heteronom-persönl. | Expertenurteile | (z.B. Schulpromotion) | Expertenmacht | Totalitarismus |
|---|
heteronom-institut. | -- | -- | -- | Totalitarismus |
|---|
Einige weitere Fälle möchte ich herausgreifen:
Wenn der Gerichtsgutachten um sein Expertenurteil gebeten wird, so
diagnostiziert er in der Regel in einem aufgezwungenen
Kontrakt auf Grund von ad hoc-Daten in intuitiver
Weise, und er repräsentiert in seiner Person die
entscheidende Institution weitgehend. Hier entsteht ein
ausgesprochenes Machtgefälle zwischen Diagnostiker und Proband,
das im analogen Fall beim bedingt freien und sogar beim
freien Kontrakt nur wenig gemildert ist. Denn der Diagnostiker
kann Willkür üben sowohl beim Datensammeln wie auch beim
Verarbeiten. Der Proband kann wenig mehr tun als sich diesem
"Besserwisser" anvertrauen. Der Diagnostiker rechtfertigt seine
Empfehlungen oder Entscheidungen letztlich aus seiner
persönlichen Autorität, ohne allerdings dafür
persönliche Verantwortung zu übernehmen. Der Proband kann
nie wissen, wie weit die Entscheidungen des Diagnostikers durch
dessen Interessen bestimmt sind. Ausweichen kann er seinen
Empfehlungen nur im freien Kontrakt. Aber auch da muss ihn das
Gefühl des Ausgeliefertseins an einen unkontrollierbaren
Mehrwisser plagen. Eine Einbusse in seinem Selbstwertgefühl ist
in vielen Fällen für den Probanden die Folge: denn befolgt
er den Rat des Diagnostikers, so hat er gewissermassen "aus der Hand
des Experten" gelebt; schlägt er ihn aus und die Entwicklung
gibt dem Diagnostiker recht, so ist erst recht sein
Selbstwertgefühl angeschlagen und seine Unfähigkeit, aus
sich selbst heraus zu leben, demonstriert.
Bei ad hoc-Daten ist eigentlich nur der Fall der
intuitiven und autonomen Entscheidung im freien
Kontrakt vertretbar. Man könnte ihn als Idealfall
persönlicher Beratung darstellen. Etwas problematisch macht ihn
bloss die Möglichkeit von Widersprüchen zwischen der
Datenaufbereitung verschiedener Diagnostiker.
Alle übrigen Fälle bei ad hoc-Daten -- und das gilt auch
bei objektiven Daten, sobald die Entscheidung intuitiv ist! --
führen grundsätzlich in ein bedenkliches Dilemma
zwischen Zufall und Willkür. Ich nenne es das
Machtdilemma, weil der Proband dem Diagnostiker ausgeliefert
ist und/oder keine Möglichkeit hat herauszufinden, ob die
Entscheidung oder Empfehlung bloss zufällig so herauskommt oder
ob sie der Diagnostiker im Hinblick auf seine eigenen Interessen und
Ziele so steuert. Man muss dabei dem Diagnostiker durchaus nicht
notwendig Manipulation unterstellen; aber auch der Diagnostiker ist
ein Mensch, auch er unterliegt den Mechanismen der Sozialwahrnehmung
und der Dissonanzreduktion; häufig ist er Angestellter einer
interessierten Institution, oft sogar des Staates. Aus der Sicht des
Diagnostikers stellt sich eigentlich das Machtdilemma sogar
verschärft: er ist versucht, die Datensammlung, die
Datenauslese, die Datenverarbeitung genau so anzulegen, dass die
Dinge gerade zueinander und zu seinen Zielsetzungen passen; er kann
leicht sagen und die meisten Diagnostiker werden das durchaus mit
gutem Gewissen tun! -, er handle im besten Interesse seines
Probanden. Aber genau das ist der Kern des ethischen Problems: was
der Diagnostiker ad hoc zusammenstellt und/oder intuitiv entscheidet
ist von niemandem, und insbesondere nicht vom Probanden selbst,
nachprüfbar, weil es bloss aus der Person dieses Diagnostikers
gerechtfertigt ist.
Sie werden nun einwenden, das sei doch schliesslich bei allen
Dienstleistungen von Professionen wie Aerzten, Anwälten,
Architekten usf. genau so der Fall. Die arbeitsteilige Gesellschaft
beruht ja darauf, dass es Leute gibt, die über gewisse Dinge
besser Bescheid wissen als alle andern. Mir scheint, dieser Einwand
übersieht einen fundamentalen Unterschied zwischen
Dienstleistungen bezüglich Einzelfunktionen und solchen, die
gewissermassen die ganze Person betreffen. Es ist sinnvoll,
Einzelentscheide an Experten zu delegieren; in der Regel ist der
Erfolg solcher Entscheidungen hinterher beurteilbar und leider mit
einigen Ausnahmen! sind die professionellen Experten flir
Fehlentscheide haftbar. Nicht so bei typischen psychologischen
Dienstleistungen: betroffen ist in der Regel die gesamte
Persönlichkeitsentwicklung des Probanden; bis ein
allfälliger Schaden erkennbar wird, ist eine Wiedergutmachung
schwer oder unmöglich und jedenfalls sind Lebensabschnitte
"vertan". Eine Uebernahme der Verantwortung durch den Psychologen ist
rhetorisch.
Die Fälle von Diagnostik auf Grund von objektiven
Daten sind In der heutigen Praxis sehr viel seltener. Auf die
Forderung dieser Paradigmata zielen die
Methodenvorbesserungsvorschläge der meisten Testtheoretiker ab.
Sie führen jedoch in ein zweites Dilemma zwischen dem Zufall
und dem Schicksal, das ich das Validitätsdilemma
nennen möchte.
Verfügten wir über psychodiagnostische Verfahren mit
vollständiger Validität, so wäre dies aus dem
Gesichtspunkt des testtheoretisch orientierten Diagnostikers ideal,
für den Probanden jedoch unerträglich, da ihm jede
Wahlfreiheit entzogen wäre. Die diagnostischen Verfahren,
über die wir tatsächlich verfügen, eröffnen
andererseits wieder dem Zufall das Feld. Das ist aus der Sicht des
Diagnostikers, insbesondere bei institutionellen, aber auch
bei persönlich-heteronomen Entscheidungen im Rahmen von
Wahrscheinlichkeitsüberlegungen durchaus sinnvoll. Aus der Sicht
des Probanden stellt sich das Problem anders! Eine Entscheidung, die
im Sinne einer Prädiktion mit der Wahrscheinlichkeit p getroffen
wird, ist für den Probanden nicht zu p% richtig; sondern sie
wird sich einmal als entweder 100% richtig oder 100% falsch
herausstellen. Das Dilemma besteht für alle Prädiktionen,
die mit Validität irgendwo zwischen r = 0 und r = 1 gemacht
werden. Je kleiner die Validität, desto weniger sinnvoll ist es
für den Probanden, die Prädiktion zu berücksichtigen,
obwohl für die entscheidende Institution beispielsweise durchaus
noch ein Selektionsgewinn gegeben sein kann. Je grösser
andererseits die Validität, desto weniger sinnvoll ist es
für den Probanden, die Prädiktion nicht zu
berücksichtigen. Denn eine valide Prädiktion zu
missachten hiesse doch eigentlich das Schicksal herausfordern. Eine
valide Prädiktion zu beachten heisst jedoch wiederum seine
Autonomie aufzugeben, aus dritter Hand zu leben. Das
Validitätsdilemma stellt sich nicht grundsätzlich anders,
ob die Entscheidungsweise nun heteronom oder autonom ist und der
Kontrakt aufgezwungen oder frei.
Versucht man nun, dem Validitätsdilemma auszuweichen, indem
man wie dies auch von Pulver (Kap.3) vorgeschlagen wird bewusst die
unvollständige Validität des Verfahrens in Kauf nimmt und
die Lücke zur Rechtfertigung der Entscheidung von Seiten des
Diagnostikers durch ein intuitives und also
heteronom-persönliches Verfahren oder durch den Beizug von ad
hoc-Daten überbrückt, so fällt man notwendig wieder
ins Machtdilemma.
Die psychodiagnostische Praxis führt also in manchen
Fällen in ein Dilemma zwischen zwei Dilemmata.
Schlussbemerkung
Ich bin kein Kulturphilosoph. Aber ich kann nicht umhin, die Frage
der Autonomie der Person als die mutmassliche zentrale Frage unserer
Zeit zu betrachten. Dafür zeugen nicht nur die Entwicklung in
der Frage der Partizipation oder die weltweiten Autarkiebestrebungen
oder Anarchismus und Drogensucht (wenn ich nicht befriedigend autonom
leben kann, kann ich ebensogut mein Leben wegwerfen), sondern ganz
besonders auch eine fundamentale Gegensätzlichkeit zwischen der
sozialistischen und der im Westen vorherrschenden Weltanschauung:
nämlich ob letzten Endes das Individuum für die
Gemeinschaft oder die Gemeinschaft für das Individuum da sein
soll.
Meine persönliche Wertung ist eindeutig für eine starke
Autonomie der Person. Ich weiss, dass ich nicht ohne Gemeinschaft
leben kann; immerhin kann ich es in einer reduzierten Gemeinschaft.
Eine umfassende und mehr oder weniger durchorganisierte Gemeinschaft,
der ich in keiner Weise ausweichen kann, macht mir aber Angst, legt
mir soviel Sachzwang und/oder durch andere Personen verkörperte
Macht auf, dass mir wenig Spass am Leben bleibt. Mancher versucht,
wenn er der Macht nicht ausweichen kann, nach Möglichkeit selber
über solche Macht zu verfügen. Setzt er sich über den
Machtanspruch des Andern hinweg, so wird sich erweisen, welcher
Anspruch stärker ist. Ich zweifle, dass auf diesem Weg eine
lebenswerte Gemeinschaft möglich ist.
Meine Alternative: ich werte die Autonomie der Person hoch und
sehe ihre Begrenzung im Autonomieanspruch des Andern, den ich achten
muss, wenn ich meinen eigenen Autonomieanspruch erfüllt haben
will. Jede Einschränkung der Autonomie in einem angeblich
überindividuellen Interesse bedarf der Rechtfertigung durch
einen interindividuellen Konsens.
Auf die Diagnostik bezogen heisst das, dass ich all jene
Paradigmata, wo entweder der Kontrakt oder die Entscheidung autonom
erfolgen, für verhältnismässig unproblematisch halte;
es bleibt allenfalls abzuklären, inwieweit solche diagnostischen
Praktiken ihren Aufwand wert sind. Bei allen andern Paradigmata
jedoch, d.h. sobald der Kontrakt eingeschränkt oder gar
unausweichlich ist oder die Entscheidungsträger andere Personen
sind, ergibt sich ein unlösbares doppeltes Dilemma:
Entweder erfolgt die Datensammlung objektiv und die
Entscheidung aktuarisch: dann bin ich entweder meinem Schicksal (im
Falle vollständiger Validität des Verfahrens) oder dem
Zufall (im Falle unvollständiger Validität) ausgeliefert;
oder die Entscheidungsgrundlage, also die Daten, oder die
Entscheidung selbst, sind bloss durch Personen gerechtfertigt: dann
bin ich wieder entweder dem Zufall oder dem Machtanspruch des
Diagnostikers bzw. dessen der hinter ihm steht ausgeliefert.
Entweder dem Machtdilemma oder dem Validitätsdilemma ist
nicht auszuweichen. Allemal sind das Welten -- Schicksal, Zufall oder
Willkür --, die ich nicht für anstrebenswert halte.
Insofern die diagnostische Praxis dazu beiträgt, solche Welten
zu fördern, möchte ich dafür plädieren, dass man
Diagnostik nicht als ein hauptsächliches Anwendungsgebiet der
Psychologie pflegt.
Fussnoten <<<<
[1] Umfrage zur Anwendung psychologischer Tests in der
Schweiz, durchgeführt von K.Belser und Th.Pfäffli unter der
Leitung von F.Stoll und A.Lang im Januar 1975. Vgl. Kurzbericht von
A.Lang und F.Stoll (1976). Der ausführliche Bericht ist
vergriffen.
[2] Falls etwa 600 Diagnostiker in der Schweiz in
ähnlicher Weise arbeiten, so ergabe das 600 x 13,s x 12 oder
rund 100'000 Getestete pro Jahr, d.h. ungefähr einen ganzen
Jahrgang der Schweizer Bevölkerung.
[3] Man kann also sagen, dass zumindest im Selbsturteil
der Diagnostiker die Forderung Pulvers nach nicht blindem Testen
durchaus erfüllt ist.
[4] Vgl. den Beitrag von F.Stoll in diesem Band
(Kap.18).
Top of
Page