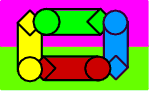Alfred Lang | University of Bern, Switzerland | 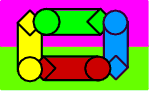 |
Conference Presentation 1994 |
Grenzbereiche und Experimentieren:Fakten und Experimente im Wohnbereich | 1994.10 @DwellPrax @DwellTheo |
16 / 22KB Last revised 98.10.26 |
Kurzvortrag am 14.2.1994 zum 15. interdisziplinären Kontaktseminar des Collegium Generale der Universität Bern zum Thema "Grenzbereiche" | © 1998 by Alfred Lang |
info@langpapers.org |
Scientific and educational use permitted |
Home || |
Meine verehrten Damen und Herren
Das Collegium Generale hat für uns eine Hierarchie von Titeln
erfunden, die uns vielleicht eine Annäherung an unser Thema
ermöglichen.
(1) Fragen wir nach dem Sinn von Grenzbereichen, so scheint mir die Antwort darin zu liegen, dass es jene Bereiche sind, wo Systeme sich sowohl erhalten wie auch erneuern. Wenn die Unterscheidungüberhaupt trägt, scheinen sie mir eigentlich wichtiger als die sogenannten Kernbereiche. Wenn wir Grenzbereiche zu Grenzen degenerieren lassen, wie bei den Grenzen zwischen unseren Grundstücken durch eine Entweder-Oder-Logik, geschehen manchmal seltsame Dinge, wie in dem Bild, das Grenzen auch als verbindende Kräfte demonstriert. Aber sie geschehen eben leider normalerweise nicht.
Grenzbereiche sind zugleich Risiken und Chancen. Die Membranen von Zellen, die Häute von Organismen, die Ränder von Territorien aller Art, die brüchigen Dammbauten der Moralsysteme, die Laufgitter, in welche die wissenschaftlichen Disziplinen ihre Studierenden setzen. Kein System kann gedeihen, das die Risiken zur Gänze scheut und damit die Chancen verpasst. Kein System kann auch bestehen, das die Risiken zur Gänze missachtet und damit die Chancen überdehnt.
(2) Damit sind wir, betrachten wir Systeme in ihrer Entwicklung, bei den Bedingungen für Wege und Irrwege für Daseinsformen. Was ist ein Irrweg, was ein gangbarer und erwünschter Weg? Wie kann man zwischen ihnen unterscheiden, bevor sie stattfinden? Verstehen wir ein System, wenn wir eingreifen? Kennen wir die relevanten Tatsachen und ihre Zusammenhänge? Haben wir eine gute Theorie, nämlich eine, die unser Handeln Irrwege vermeiden und Wege finden lässt? Damit sind wir bei Fakten und beim Experiment.
(3) Über das Experiment gibt es meines Erachtens oft seltsam einschränkende Vorstellungen. Manche Wissenschaftler behaupten, dass Experiment sei als die ideale Form wissenschaftlicher Forschung die wiederholbare Beobachtung von in einer Modellwelt arrangierten Wirkungen von kontrollierten Ursachen. Sein Zweck sei die Entscheidung über Hypothesen, mithin die Klärung von Theorien, mit denen man anschliessend in der wirklichen Welt operieren könne.
Nun bin ich freilich nicht so sicher, ob sich zwischen
Modellwelten und Realwelten so einfach und klar
unterscheiden lässt. Immer dann, wenn ein System durch
beobachtenden Eingriff potentiell verändert wird, geht es ja
nicht an, von der experimentellen Modellwelt, die genau solche
Veränderungen um jeden Preis zu verhindern trachtet, auf
eine allgemeinere Welt zu generalisieren, in der solches genau einen
wesentlichen Sinn ausmacht.
Wir brauchen also für evolutive und historische Welten einen
weiteren Experiment-Begriff. Ich denke wir müssen
einsehen, dass solche evolutiven Welten selber auch experimentieren.
Das ist für biotische Systeme, die Evolution der Arten
heute allgemein anerkannt. Der Grenzbereich ist dann der Ort und die
Zeit, oder jene Rahmenbedingungen, unter welchen neue Arten
entstehen. Hier geht die Natur, anthropomorphisierend beschrieben,
Risiken ein und gibt sich Chancen zu Innovation. Man weiss heute mit
einiger Sicherheit, dass dies bevorzugt oder fast ausschliesslich in
relativ abgeschlossenen ökologischen Nischen geschehen muss.
Natürlich entstehen Abarten laufend im normalen Lebensbereich
einer Art; aber unter dem Konkurrenzdruck der dort bewährten Art
haben sie kaum Überlebenschancen. Unter geringerem
Konkurrenzdruck können sie sich jedoch stabilisieren und
gegebenenfalls etwas später ihre Ursprungsart aus dem Felde
drängen. MaW, die "Natur" experimentiert hier, nicht im
Labor, sondern in einer Nische; und das Resultat ist nicht eine
Modellwelt an der die Realwelt Mass nimmt, sondern es wird, im
Erfolgsfall, zur Realwelt selbst.
Es scheint, dass wir im kulturellen Feld, das heisst jener
Daseinsformen, die unter zusammenlebenden Menschen gebildet und
tradiert werden, solche Mechanismen der Innovation, solches
Experimentieren in vivo kennen. Beispiel: das Modell der
Marktwirtschaft. Und während einige sich um geschützte
Nischen bemühen, drängen andere auf deren Vermeidung oder
Abschaffung, weil sie in ihrer Meinung zu wenig innovativ sind. Aber
ich will nicht das bioevolutive Geschehen zum Modell für
kulturelle Evolution nehmen, sondern nur als Denkhintergrund, weil
wir es beträchtlich besser verstehen als die Entwicklung von
Gesellschaften. Es kann uns als Heuristik dienen.
Vielmehr will ich Ihnen nun zwei "Experimente" aus dem Wohnbereich
schildern. Zwei eher problematische, dafür wirkliche
Experimente. Sie sollen zeigen, dass wir mit der Idee des
Experimentieren in vivo in unserer Kultur vermutlich doch eher
seltsam umgehen. Urteilen Sie selbst.
Ein verzerrtes und ein blindes
Experiment
ein verzerrtes "Experiment": "Karthago", ein
Abkömmling von Bolo-Bolo
Der Zürcher Gemeinderat, also das Stadtparlament, hat letzte
Woche und vorausgehend eine heftige Auseinandersetzung "die Geister
geschieden", "ein Testfall", wie die NZZ ihren ausführlichen
Lokalteil-Leitartikel titelte, der sogar den 10-Millionen-Postraub
vom Ehrenplatz verdrängte. Es handelt sich auch, aber durchaus
nicht nur, um einen Teil des Wahlkampfes zwischen bürgerlich und
rot-grün, da der Fall schon letztes Jahr und früher
Schlagzeilen produzierte.
"Karthago", so nennt sich eine Gruppe entfernter Abkömmlinge
der Jugendbewegung von 1980, als unter anderem am Stauffacher
unbelegte Häuser besetzt und neben einigen gewaltsamen realen
Begegnungen mit der Obrigkeit auch Projekte für eine
menschlichere Gesellschaft geträumt worden sind. Rund 20
Personen, die inzwischen in die Jahre gekommen sind, haben vor
einigen Jahren eine Genossenschaft gegründet und planen seither
die Errichtung einer Wohngemeinschaft im Sinne eines Grosshaushaltes
für rund 40 Personen. Mit ihrem Projekt wollen sie der
Vereinzelung der Menschen entgegenwirken und, durchaus im Sinne eines
eingangs beschriebenen Realexperiments Lebensformen, die andern im
Sinne von Vorbild oder Antivorbild zugute kommen können.
Mit ihrer Realutopie haben sie es nicht leicht. Einerseits
geniessen sie eine gewisse Unterstützung der Stadtbehörden,
welche sie beraten und ihnen ein Grundstück in einer Vorstadt im
Baurecht angeboten und die Durchführung eines
Architekturwettbewerbs organisiert haben. Aber genau das hat
vielleicht den politischen Widerstand gestärkt. Unter allerlei
unschönen Begleiterscheinungen werden die "Karthager" mit der
Hausbesetzer- und Drogenszene in Verbindung gebracht. Und ob die
grosszügig bemessenen Gemeinschaftsräume nicht vielleicht
für für im Quartier unerwünschte Veranstaltungen
benützt werden könnten. Ein eilends ausgearbeitetes
Gegenprojekt nach dem Fam iliensiedlungsmuster von rechter Seite ist
dann freilich im Parlament nicht zu Zuge gekommen.
Die "Karthago"-Gruppe hat also in gewisser Hinsicht die Chance
ihre alt-neuen Ideen menschlicher Formen des Zusammenlebens in einer
kleinen Wirklichkeit auf die Probe zu stellen. Freilich ist es ein
Experiment unter beträchtlich eingeschränkten, wenn nicht
verzerrten Bedingungen. Es wird schwer sein, für Beobachter, zu
entscheiden, ob eine bestimmte Leistung oder Dysfunktion später
im Alltag des Projekt seine ihm gemässen Rahmenbedingungen
gefunden haben wird, oder ob es unter alle den Kompromissen sich
selbst längst widerlegen musste.
Es erfüllt mich schon mit seltsamen Gefühlen der
Unverhältnismässigkeit, wenn ich bedenke, wie leicht unser
angeblich doch so schwerfälliges politisches System bereit ist,
durch einen Gesetzesbeschluss die Lebensvoraussetzungen von 7
Millionen Menschen manchmal sehr massiv zu beeinflussen und sich den
selbstbezahlten Bemühungen von 40 Freiwilligen so massiv zu
widersetzen versucht.
ein "blindes" "Experiment": Alleinwohnen, die
jungen wollen es so
Das ist umso bedenklicher, als wir gleichzeit in grandiosem
Masstab "experimentieren" freilich blind, indem wir unserere
Lebensformen ändern, mit massiven Folgen, und so tun, wie wenn
das wie ein Erdbeden über unsere Machtlosigkeit
hereinbräche. Bestenfalls erfassen wir das Phänomen
statistisch und starren wie gebannt auf deren Gang.
Vom Einzelfall "Karthago" wenden wir den Blick auf Entwicklungen
der Lebensformen in unserer Gesellschaft insgesamt. Folie
Haushaltgrösse 1900-1990. Von 1900 bis nach dem 2. Weltkrieg
zählten zwei Drittel der privaten Haushalte drei oder mehr
Personen und nur ein Drittel zwei oder eine, überwiegend
ältere Menschen. Heute ist die Situation genau umgekehrt: nur
ein Drittel der Haushalte zählt drei oder mehr Personen und je
ein Drittel sind etweder Ein- oder Zweipersonenhaushalte. Wie Sie der
Grafik entnehmen können, haben die sehr grossen Wophngruppen
oder Familien verhältnismässig kontinuierlich abgenommen,
die Zunahme der Ein- und Zweipersonenhaushalte aber eigentlich erst
in den 60er und 70er Jahren. Der Trend hat sich seit 1980 relativ
abgeflacht, absolut aber geht er weiter. Den sogenannten
Normalhaushalt, Eltern mit Kind oder Kindern, gibt es gerade auch
noch zu einem guten Drittel aller Haushalte.
Das Bild wäre noch dahin zu ergänzen, dass sie die
durchschnittliche Netto-Wohnfläche pro Person seit 1950 von rund
25 auf rund 50 qm verdoppelt hat. Natürlich ist sie
verhältnismässig ungleich verteilt.
Ich habe Grund anzunehmen, dass ich mit solchen Statistiken Ihre
Gemüter in zwei Gruppen dividiere.
Die einen werden sich sagen: so what? That's the ways it is. Wir
sind jung und unabhängig; warum sollen wir uns selbst in die
Zwangskisten der Familien verurteilen; und bitte, wir können und
wollen es uns leisten. Es ist unsere freie Entscheidung.
Die andern werden mehr oder weniger sorgenvoll Bedenken hin- und
herwiegen und vielleicht etwas von traditionellen Familienwerten
murmeln. Sie werden an den unsinnigen Resourcenverschleiss denken,
der nicht nur hektische Arbeit geschafft, sondern auch die
Städte chaotisch und das Land zur Vorstadt gemacht hat. Zu
schweigen von der Isolierung der Individuen, der Vorstufe zu ihrer
Vereinsamung.
Wir sind nicht vereinsamt, sagen die jungen Alleinwohnenden. Nicht
ohne Recht. Zwar fehlen die entsprechenden demographischen Daten. Die
ersten Einzelbefunde, die wir sammeln konnten, legen die Vermutung
nahe, dass Alleinwohnende nicht selten einen Teil ihrer Wohnzeit in
den Wohnungen anderer Alleinwohnenden verbringen.
Wozu denn das Alleinwohnen, werden die Konservativen fragen. Das
macht ja den Ressourcenverschleiss nur noch absurder.
Aber es geht mir nicht um das Gegeneinanderausspielen von
Bewertungen. Vielmehr interessiert mich, an diesen Beispielen zu
bedenken, ob und wie unsere Gesellschaft real experimentieren kann
und will. Und ob auch die Voraussetzungen zum Experimentieren
bestehen, nämlich eine einigermassen umfassende Kenntnis der
Sachlage einerseits und und eine neugierige Beobachtungshaltung
anderseits, welche bereit ist, dem Experiment seinen Nischenraum
zuzugestehen und die Resultate frei zu würdigen und nicht nach
Interessenlage auf die eine oder andere Weise vorwegzunehmen.
Die Zeit erlaubt nicht, die Voraussetzungen und möglichen
Konsequenzen dieses epochalen Vorgangs hier zu erörtern. Ich
denke aber, er hat und wird tiefer in unser Leben und in das der
kommenden Generationen eingreifen als hunderte von Erscheinungen,
denen wir umfangreiche Medienaktionen und aufwendige
Forschungsprogramme widmen.
Bauen und Wohnen im
psychosozialen System -- drei Thesen
Lassen Sie m ich vielmehr in drei Thesen etwas von dem
zusammenfassen, was unser Verständnis des Wohnens
charakterisiert, seit wir uns gesagt haben, es muss gründlichere
Gründe dafür geben, dass Menschen auf der ganzen Welt bauen
und wohnen, und dies in sehr unterschiedlichen Formen.
1. Wir sollten Wohneinheiten und Wohnanlagen nicht länger
nur als Instrumente zur Befriedigung von sog. Grundbedürfnissen
von Individuen auffassen, sondern vielmehr sehen und nutzen lernen,
in welcher Weise Gebautes und Gestaltetes im Raum analog zum Skelett
die eigentliche Grundstruktur des sozialen Körpers
ist.
Die gängige Vorstellung ist, dass uns Bauten und Wohnungen
dienen, und zwar rein funktionell, allenfalls ästhetisch. Sie
schützen uns vor schlechtem Wetter, versammeln unserene Besitz,
und zeigen allenfalls, wer wir sind oder sein möchten.
Leider haben sich wissenschaftliche Zugänge zum Wohnen,
sofern sie überhaupt den Bereich der Wohnung als
funktionsfähige technische Einrichtung und als
Investitionsobjekt überstiegen haben, diese Auffassung zu eigen
gemacht. Wenn Soziologen oder Psychologen sich um Wohnen
kümmern, fragen sie die Bewohner, ob sie mit der Wohnung
zufrieden sind oder was sie gerne hätten.
Es ist kaum zur Kenntnis genommen worden, dass die
Instrumentalisierung der Wohnungen zur Befriedigung von
Grundbedürfnissen nicht nur widersprüchlich -- wenn die
Wohnung zugleich die Grundbedürfnisse nach Geselligkeit und nach
Rückzug auf sich selbst erfüllen soll -- sondern vor allem
auch zirkulär ist. Denn es kann ja wohl nicht um biologische
Grundbedürfnisse gehen wie Hunger und Durst, die man
unabhängig von ihren Verhaltensmanifestationen zB physiologisch
dingfestmachen kann. Vielmehr müssen es abgeleitete, sog.
Sekundärbedürfnisse sei, die aber -- wie im prinzipö
jede Sucht -- auf Grund von Gewohnheitsbildung zustande kommen. Damit
erklärt man alles und nichts. Und wenn es, wie unser Verhalten
zeigt, ein Bedürfnis nach immer mehr Wohnfläche wirklich
geben sollte, dann werden halt die Wohnungen immer grösser
solange bis die ganze Erdoberfläche überbaut ist oder es
sonst nicht mehr weitergeht.
Der positive Aspekte der These führt tief in anthropologische
Fragen. -->Diskussion
2. Demnach bauen und wohnen wir nicht (oder jedenfalls nicht in
erster Linie), weil es uns das Leben angenehmer und sicherer macht
(es macht es ja wohl auch komplizierter und gefährdeter);
vielmehr könnten wir mit unserer flexibilisierten
Instinktausstattung wohl kaum ohne diese kulturelle Zeichensysteme
im Verband zusammenleben. Von diesen sind Raumstrukturierung
und Herstellung, Auswahl und Umgang mit Dingen im
zwischen-menschlichen Geschehen das Grundlegende; die Sprache und
andere spezialisiertere Symbolsysteme setzen es voraus, verfeinern es
und stören aber nicht selten auch sein Wirken, indem sie es in
einschränkenden Hinsichten umdeuten.
3. Mit den in unseren Gesellschaften oder Kulturen "gewohnten"
Raumstrukturen, mit den "vertrauten" Rollen der Dinge als Angebote
und Aufforderungen zu erwartungserfüllenden oder -versagenden
Handlungen, mit dem in solchen Gewohnheitensystemen ebenfalls
angelegten Freiraum zu Alternativen und Entwicklungen gehen wir wohl
heutzutage wenig förderlich für die Qualität des
Zusammenlebens um. Durch ihre weitgehende Funktionalisierung,
Ökonomisierung und gelegentliche Ästhetisierung haben wir
sie vielmehr zu äusserst effektiven Herrschaftsmitteln verkommen
lassen, welche das soziale Interaktionsgeschehen höchst
einseitig bestimmen.
Top of
Page